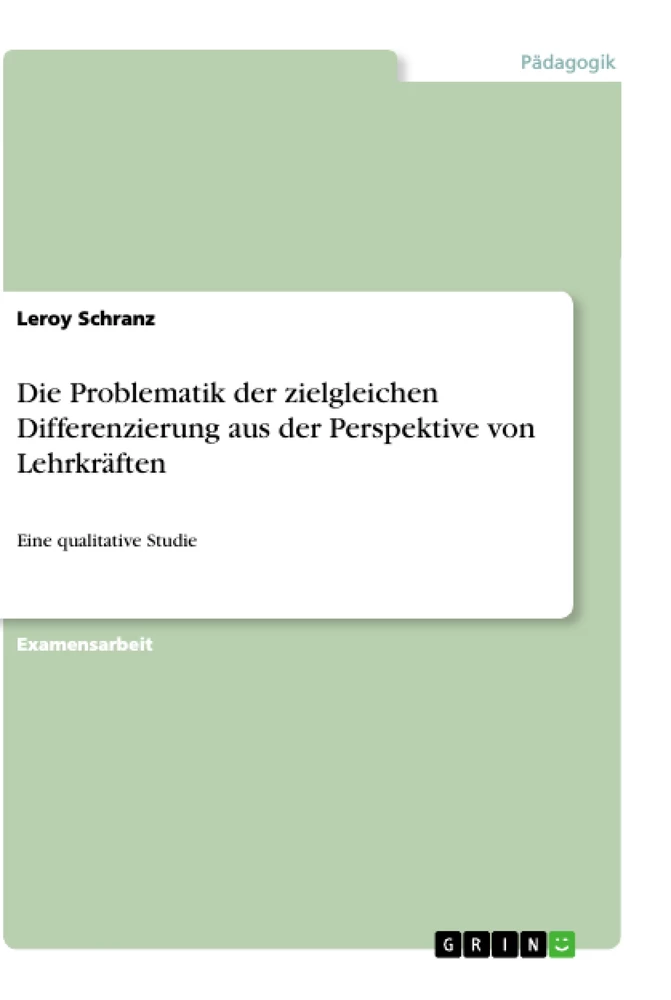Welche Chancen und Problematiken eröffnet die zielgleiche Differenzierung als Handlungspraxis von Lehrkräften im gemeinsamen Unterricht in Sachsen-Anhalt, mit besonderer Betrachtung des Instrumentarium Nachteilsausgleich? Im Kontext der zielgleichen Differenzierung sind Lehrende widersprüchlichen Zielsetzungen ausgesetzt. Die Untersuchung bedarf daher zwingend theoretischer Vorüberlegungen.
Die Untersuchung beschäftigt sich zunächst mit den Adressaten von Bildungsprozessen: den Schülerinnen und Schülern. Über das Phänomen der Heterogenität, in dem Unterschiede zwischen Lernenden im deutschen Bildungssystem charakterisiert werden, wird an erster Stelle ergründet, wie individuelle Merkmalsunterschiede zwischen Lernenden entstehen und welcher Umgang mit diesen programmiert wird.
Den Nachteilsausgleich in dem Konzept der Inneren Differenzierung zu verorten, wird die Aufgabe des folgenden Kapitels, in dessen Zusammenhang die Problematik von zielgleicher Differenzierung perspektivisch aufgearbeitet wird. Das abschließende theoretische Kapitel versucht die zuvor erarbeiteten Erkenntnisse in den Untersuchungsrahmen dieser Studie einzuordnen: den gemeinsamen Unterricht in Sachsen-Anhalt. Schließlich wird die Methode vorgestellt und anschließend werden die Ergebnisse systematisch ausgewertet und diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 HETEROGENITÄT
- 2.1 DAS PHÄNOMEN HETEROGENITÄT
- 2.2 VIER TRANSFORMATIONEN VON HETEROGENITÄT NACH BUDDE (2017)
- 2.3 SCHULLEISTUNGEN UND LEISTUNG ALS ZENTRALE HETEROGENITÄTSKATEGORIE IM
RAHMEN DES ZIELGLEICHEN UNTERRICHTS - 3 DIFFERENZIERUNG ALS METHODE UM HETEROGENITÄT ZU BEGEGNEN
- 3.1 DIE UNTERSCHEIDUNG VON ÄUBERER UND INNERER DIFFERENZIERUNG
- 3.2 HOMOGENISIERUNG DURCH ÄUBERE DIFFERENZIERUNG
- 3.3 DAS KONZEPT DER INNEREN DIFFERENZIERUNG
- 3.3.1 ZIELDIFFERENTE DIFFERENZIERUNG IM SCHULISCHEN KONTEXT
- 3.3.2 MODELLE UND FORMEN INNERER DIFFERENZIERUNGSMAẞNAHMEN
- 3.4 NACHTEILSAUSGLEICH
- 3.4.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG UND RECHTLICHE GRUNDLAGEN
- 3.4.2 NACHTEILSAUSGLEICH ALS PÄDAGOGISCHES GRUNDPRINZIP
- 3.4.3 NACHTEILSAUSGLEICHE ALS FORMEN ZIELGLEICHER DIFFERENZIERUNG
- 3.4.4 WIE SOLL MIT ZIELDIFFERENTEN DIFFERENZIERUNGSMAẞNAHMEN UMGEGANGEN
WERDEN? - 3.4.5 GEWÄHRUNG EINES NACHTEILSAUSGLEICHS
- 3.4.6 FORMEN DES NACHTEILSAUSGLEICHS
- 4 DER GEMEINSAME UNTERRICHT ALS ZIELPERSPEKTIVE FÜR
INKLUSIVEN
UNTERRICHT - 4.1 GEMEINSAMER UNTERRICHT ALS BAUSTEIN INKLUSIVER BILDUNG?
- 4.2 LANDESÜBERGREIFENDE GRUNDSÄTZE DES GEMEINSAMEN UNTERRICHTS
- 4.3 GEMEINSAMER UNTERRICHT IN SACHSEN-ANHALT
- 5 METHODE
- 5.1 STICHPROBE
- 5.2 UNTERSUCHUNGSINSTRUMENT UND UNTERSUCHUNGSMATERIAL
- 5.3 DURCHFÜHRUNG
- 5.4 AUSWERTUNGSMETHODE
- 6 ERGEBNISSE
- 6.1 HETEROGENITÄT DER LERNGRUPPEN
- 6.2 GRUNDSÄTZLICHER UMGANG MIT HETEROGENITÄT
- 6.3 DIFFERENZIERUNGSPRAXIS ALS REAKTION AUF DIE HETEROGENITÄT DER LERNENDEN
- 6.3.1 ALLGEMEINE DIFFERENZIERUNGSPRAXIS
- 6.3.2 NACHTEILSAUSGLEICH
- 6.4 CHANCEN UND PROBLEMATIKEN IN DER DIFFERENZIERUNGSPRAXIS DER LEHRENDEN
- 6.4.1 CHANCEN
- 6.4.2 PROBLEMATIKEN
- 6.4.2.1 ALLGEMEINE PROBLEMATIKEN DER DIFFERENZIERUNGSPRAXIS
- 6.4.2.2 PROBLEMATIKEN DER NACHTEILSAUSGLEICHSPRAXIS
- Das Konzept der Heterogenität und seine Bedeutung für den zielgleichen Unterricht
- Differenzierungsformen und deren Rolle bei der Bewältigung von Heterogenität
- Nachteilsausgleich als Instrumentarium der zielgleichen Differenzierung im Gemeinsamen Unterricht
- Chancen und Probleme in der Praxis der zielgleichen Differenzierung
- Bedeutung des Gemeinsamen Unterrichts für die Inklusion und die Rolle von Lehrkräften bei der Gestaltung eines inklusiven Bildungssystems
- Kapitel 1: Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der wissenschaftlichen Hausarbeit ein und stellt die Relevanz des Nachteilsausgleichs im Kontext des Gemeinsamen Unterrichts in Sachsen-Anhalt dar. Es werden die Forschungsfragen und die Struktur der Arbeit erläutert.
- Kapitel 2: Heterogenität: Dieses Kapitel beleuchtet das Phänomen der Heterogenität in der Bildung und analysiert die Entstehung individueller Unterschiede zwischen Lernenden. Es werden verschiedene Transformationen der Heterogenitätsdebatte sowie die Bedeutung von Schulleistungen und Leistung im Rahmen des zielgleichen Unterrichts betrachtet.
- Kapitel 3: Differenzierung als Methode um Heterogenität zu begegnen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Differenzierung als Methode, um Heterogenität im Unterricht zu begegnen. Es werden die Unterscheidung zwischen äußerer und innerer Differenzierung sowie die Problematik der Zieldifferenzierung im schulischen Kontext erörtert. Des Weiteren wird der Nachteilsausgleich als ein Instrumentarium der inneren Differenzierung betrachtet, wobei die rechtlichen Grundlagen und die Bedeutung als pädagogisches Grundprinzip beleuchtet werden.
- Kapitel 4: Der Gemeinsame Unterricht als Zielperspektive für inklusiven Unterricht: Dieses Kapitel untersucht den Gemeinsamen Unterricht als Bausteine inklusiven Bildungssystems. Es werden landesspezifische Grundsätze des Gemeinsamen Unterrichts sowie die Situation in Sachsen-Anhalt betrachtet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit untersucht die Problematik der zielgleichen Differenzierung aus der Perspektive von Lehrkräften an Förderschulen. Im Mittelpunkt steht die qualitative Untersuchung des Instrumentariums „Nachteilsausgleich“ im Kontext des Gemeinsamen Unterrichts in Sachsen-Anhalt. Die Arbeit analysiert die Chancen und Herausforderungen, die sich aus der Implementierung des Nachteilsausgleichs in der Praxis für Lehrkräfte ergeben.Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Diese wissenschaftliche Hausarbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der inklusiven Bildung, dem Gemeinsamen Unterricht, der Heterogenität und der zielgleichen Differenzierung. Im Fokus steht die Untersuchung des Nachteilsausgleichs als Instrumentarium der inneren Differenzierung und seine Bedeutung für die Praxis von Lehrkräften.- Quote paper
- Leroy Schranz (Author), 2017, Die Problematik der zielgleichen Differenzierung aus der Perspektive von Lehrkräften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/967043