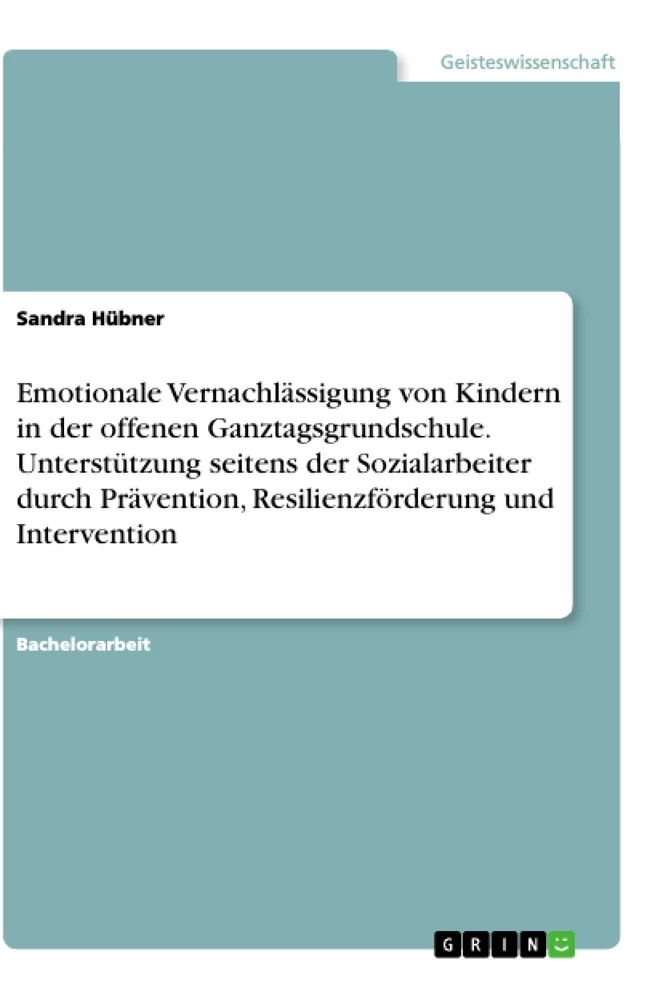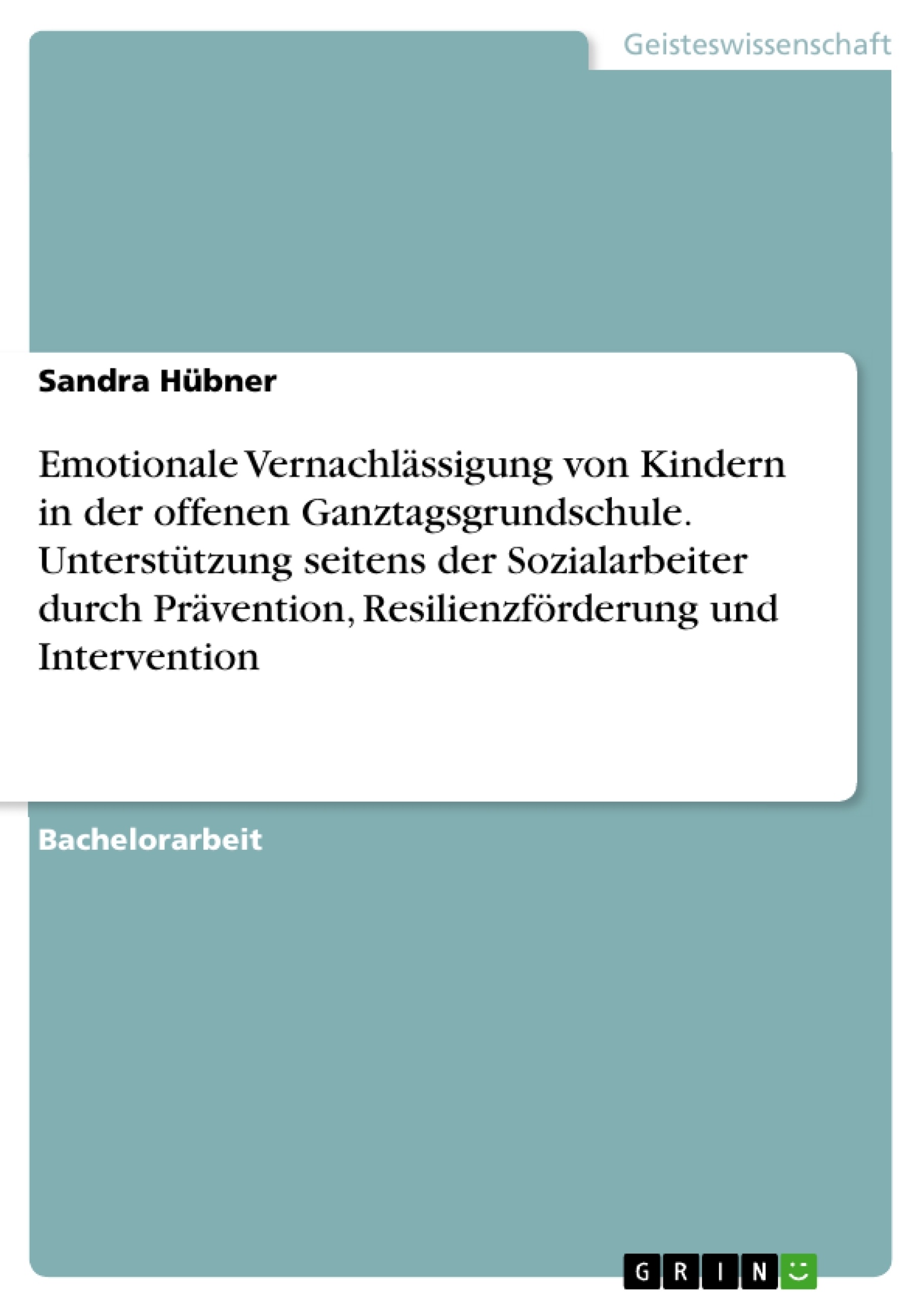Die vorliegende Bachelorarbeit hat die emotionale Vernachlässigung bei Grundschulkindern zum Thema. Seit Beginn der Forschung auf diesem Gebiet in den 1990er Jahren wird angenommen, dass Prävention/Intervention und Resilienzförderung sich positiv auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Beim empirischen Vorgang kam der Mixed-Method-Ansatz mit dem qualitativen und quantitativen Forschungsstrang zum Einsatz. Der qualitative Forschungsstrang wurde jedoch aufgrund der sensiblen Thematik nicht weiterverfolgt. Im quantitativen Forschungsstrang wurden zwei Online-Umfragen in den jeweiligen Zielgruppen, erwachsene Betroffene und Pädagogen, durchgeführt. Die-se bestätigen, dass diverse Unterstützungsmöglichkeiten in Kooperation zwischen Grundschule und offener Ganztagsschule einen positiven Einfluss auf Schüler mit einer emotionalen Vernachlässigung haben. In der vorliegenden Arbeit werden Möglichkeiten zur Einordnung der Symptomatik möglicherweise emotional vernachlässigten Kindern und Unterstützungsmöglichkeiten, insbesondere im OGS-Bereich, aufgezeigt.
Zu Beginn der Thesis erfolgt die Einleitung mit der Übersicht zur Problemstellung des gewählten Themas. Dabei findet eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit bisherigen Forschungsergebnissen und Begründung zum gewählten Thema, statt. Im weiteren Verlauf wird das Hauptziel mit Nebenzielen in Form von genannten ZG und deren Leitfragen zur angehenden Empirie dieser The-sis benannt. Dazu sind im Anschluss die forschungsrelevanten Hypothesen zu finden. Zum Schluss rundet eine Beschreibung zur Vorgehensweise der vorliegenden Thesis diesen Punkt ab.
Das Hauptziel der Bachelorthesis im Rahmen des Fernstudiums liegt in der Beantwortung der folgenden Forschungsfrage: „Welche Möglichkeiten der Unterstützung haben Sozialarbeiter in einer offenen Ganztagsgrundschule Kinder zu unterstützen, welche emotional von ihren Eltern vernachlässigt werden?“ Die Nebenziele der Thesis werden anhand weiterer ZG und deren Forschungsfragen benannt. Bei diesen drei Zielgruppen wird empirisch vorgegangen, um das oben genannte Hauptziel, zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Danksagung
- II. Abstract
- III. Inhaltsverzeichnis
- IV. Abkürzungsverzeichnis
- V. Abbildungsverzeichnis
- VI. Tabellenverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Ziel der Arbeit
- 1.3. Vorgehensweise
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1. Vernachlässigung
- 2.1.1. Emotionale Vernachlässigung
- 2.1.2. Symptome des Kindes elterlicher emotionaler Vernachlässigung
- 2.1.3. Langzeitfolgen emotionaler Vernachlässigung
- 2.2. Grundlagen zum Kindeswohl und Kinderschutz
- 2.2.1. Definition und Beschreibung
- 2.2.2. Gefährdung des Kindeswohls
- 2.2.3. Rechtliche Grundlagen
- 2.2.4. Rechtliche Anwendung bei Kindeswohlgefährdung in der Ganztagsschule
- 2.3. Grundbedürfnisse und Entwicklung des Kindes
- 2.3.1. Grundbedürfnisse - angelehnt an die Maslowsche Bedürfnispyramide
- 2.3.2. Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung nach Erik H. Erikson
- 2.3.3. Kognitive Entwicklungsphasen nach Jean Piaget
- 2.3.4. Fünf Säulen der Entwicklungsarbeit nach Tschöpe-Scheffler
- 2.4. Lebensort - offene Ganztagsschule
- 2.4.1. Offene Ganztagsgrundschule
- 2.4.2. Lebensort Schule für Ganztagsgrundschüler
- 2.4.3. Handlungsfelder des Pädagogischen Personals
- 2.4.4. Kooperation/Netzwerkarbeit
- 2.5. Mögliche Unterstützungen des Kindes seitens Sozialarbeiter
- 2.5.1. Prävention und Intervention
- 2.5.2. Resilienz
- 2.1. Vernachlässigung
- 3. Empirischer Teil - Methodik der Forschung
- 3.1. Mixed-Method-Ansatz
- 3.2. Qualitativer Forschungsstrang
- 3.3. Quantitativer Forschungsstrang
- 3.4. Darstellung der Ergebnisse
- 3.5. Triangulation - Meta-Inferenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die emotionale Vernachlässigung bei Grundschulkindern und die Möglichkeiten der Unterstützung durch Sozialarbeiter*innen in der offenen Ganztagsschule. Ziel ist es, den Einfluss von Prävention, Intervention und Resilienzförderung auf die Entwicklung der Kinder zu beleuchten und Handlungsempfehlungen für die Praxis zu formulieren.
- Emotionale Vernachlässigung bei Grundschulkindern
- Rollen und Aufgaben von Sozialarbeiter*innen in der OGS
- Prävention und Intervention im Kontext emotionaler Vernachlässigung
- Förderung von Resilienz bei betroffenen Kindern
- Kooperation zwischen Schule und anderen Institutionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der emotionalen Vernachlässigung bei Grundschulkindern ein und beschreibt die Problemstellung. Es werden das Ziel der Arbeit und die gewählte Vorgehensweise erläutert, um den Rahmen der Untersuchung abzustecken und den Lesenden einen Überblick über den Aufbau der Arbeit zu geben. Die Problemstellung wird deutlich herausgearbeitet und die Notwendigkeit der Forschungsarbeit begründet.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert den Begriff der Vernachlässigung, insbesondere der emotionalen Vernachlässigung, und beschreibt detailliert die damit verbundenen Symptome, Langzeitfolgen und die rechtlichen Grundlagen des Kinderschutzes. Es werden zudem relevante Entwicklungstheorien (z.B. Maslow, Erikson, Piaget) und das Konzept der Resilienz eingebunden, um ein umfassendes Verständnis der Thematik zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf den Bedürfnissen von Kindern und den Herausforderungen, die durch emotionale Vernachlässigung entstehen.
3. Empirischer Teil - Methodik der Forschung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert den gewählten Mixed-Methods-Ansatz und detailliert den quantitativen Forschungsstrang mit der Durchführung und Auswertung von Online-Umfragen bei erwachsenen Betroffenen und Pädagog*innen. Die gewählte Methode wird detailliert begründet und die Limitationen transparent gemacht. Die Kapitel beschreibt die Datenerhebung, die Auswahl der Stichprobe, die verwendeten Messinstrumente und die statistischen Auswertungsverfahren.
Schlüsselwörter
Emotionale Vernachlässigung, Grundschulkind, offene Ganztagsschule (OGS), Sozialarbeit, Prävention, Intervention, Resilienz, Kindeswohl, Kinderschutz, Kooperation, Netzwerkarbeit, empirische Forschung, quantitative Methoden, Online-Umfrage.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Emotionale Vernachlässigung bei Grundschulkindern und die Rolle der Sozialarbeit in der offenen Ganztagsschule
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die emotionale Vernachlässigung bei Grundschulkindern und die Möglichkeiten der Unterstützung durch Sozialarbeiter*innen in der offenen Ganztagsschule (OGS). Sie beleuchtet den Einfluss von Prävention, Intervention und Resilienzförderung auf die Entwicklung der Kinder und formuliert Handlungsempfehlungen für die Praxis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: emotionale Vernachlässigung bei Grundschulkindern, die Rollen und Aufgaben von Sozialarbeiter*innen in der OGS, Prävention und Intervention im Kontext emotionaler Vernachlässigung, Förderung von Resilienz bei betroffenen Kindern und die Kooperation zwischen Schule und anderen Institutionen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: Eine Einleitung, die die Problemstellung, das Ziel und die Vorgehensweise beschreibt; einen theoretischen Teil, der die relevanten Grundlagen zu emotionaler Vernachlässigung, Kinderschutz, Entwicklungspsychologie und der Rolle der OGS beleuchtet; und einen empirischen Teil, der die Methodik der Forschung (Mixed-Methods-Ansatz) und die Ergebnisse der Untersuchung darstellt.
Welche Methoden wurden in der empirischen Untersuchung verwendet?
Die Arbeit verwendet einen Mixed-Methods-Ansatz. Der qualitative Forschungsstrang und der quantitative Forschungsstrang werden mit Online-Umfragen bei Erwachsenen (Betroffenen und Pädagog*innen) untersucht. Die Ergebnisse werden mittels Triangulation und Meta-Inferenzen ausgewertet. Die Methodik wird detailliert beschrieben und die Limitationen transparent gemacht.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene theoretische Grundlagen, darunter Definitionen und Beschreibungen von Vernachlässigung (insbesondere emotionaler Vernachlässigung), rechtliche Grundlagen des Kinderschutzes, Entwicklungstheorien von Maslow, Erikson und Piaget, das Konzept der Resilienz und die Besonderheiten des Lebensortes "Offene Ganztagsschule".
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Der empirische Teil der Arbeit präsentiert die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Datenanalyse. Die detaillierte Darstellung der Ergebnisse und deren Interpretation sind im Kapitel "Darstellung der Ergebnisse" zu finden. Die Ergebnisse werden im Kontext der Forschungsfrage interpretiert und diskutiert.
Welche Handlungsempfehlungen werden gegeben?
Die Arbeit leitet aus den Ergebnissen Handlungsempfehlungen für die Praxis ab, die sich an Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen und andere Akteure im Bereich des Kinderschutzes richten. Diese Empfehlungen zielen darauf ab, die Unterstützung von Kindern mit emotionaler Vernachlässigung in der OGS zu verbessern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter: Emotionale Vernachlässigung, Grundschulkind, offene Ganztagsschule (OGS), Sozialarbeit, Prävention, Intervention, Resilienz, Kindeswohl, Kinderschutz, Kooperation, Netzwerkarbeit, empirische Forschung, quantitative Methoden, Online-Umfrage.
- Citar trabajo
- Sandra Hübner (Autor), 2020, Emotionale Vernachlässigung von Kindern in der offenen Ganztagsgrundschule. Unterstützung seitens der Sozialarbeiter durch Prävention, Resilienzförderung und Intervention, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/972546