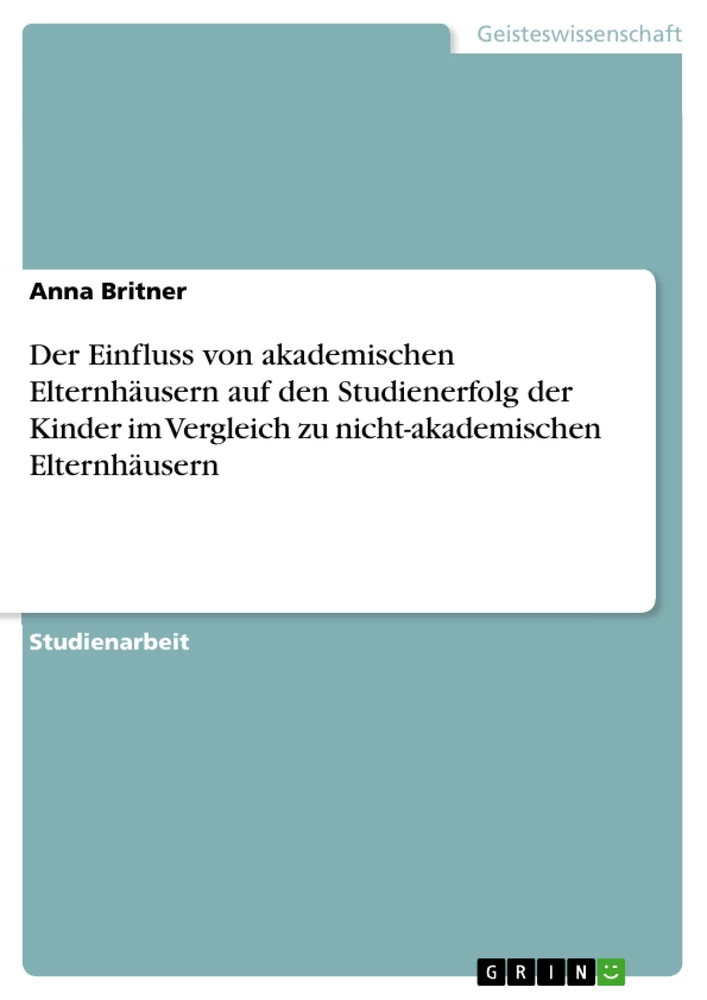In dieser Studienarbeit geht es um den Zusammenhang des Bildungsgrades eines Elternhauses und dem Studienerfolg von deren Kinder. Neben der Betrachtung von aktuellen Zahlen zur Zusammensetzung der Studierenden nach Bildungsgrad des Elternhauses, wird zahlreiche Literatur hinzugezogen, um letztlich die Frage zu beantworten, ob ein akademisches Elternhaus im Vergleich zu einem nicht-akademischen Elternhaus zum Studienerfolg ihrer Kinder beiträgt. Das Ergebnis kennzeichnet sich durch eine klare Position: nämlich dass dem so ist. Aus welchen Gründen ein akademisches Elternhaus im Vergleich zu einem nicht-akademischen Elternhaus zum Studienerfolg ihrer Kinder beiträgt und wie schwer es ist, diesem Teufelskreis zu entfliehen, können Sie in dieser Arbeit nachlesen.
In dieser Studienarbeit wird die 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (2017) als Grundlage verwendet, um im Kapitel 3 aktuelle Zahlen von Studierenden in Deutschland aufzuzeigen. Demnach richtet sich auch die Definition von Studierenden danach. In der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (2017) basiert die Grundgesamtheit der befragten Studierenden auf deutschen bzw. bundesinländischen Studierenden. Dies bedeutet, dass die/der Studierende/r eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder ihre/seine Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben hat und an einer deutschen Hochschule immatrikuliert ist mit der Absicht, ihren/seinen Studienabschluss in Deutschland zu absolvieren.
Die Unterscheidung zwischen Hochschule und Universität ist für diese Studienarbeit nicht relevant. Zur Vereinfachung wird in diesem Zusammenhang lediglich von Hochschule gesprochen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Studierende
- Studienerfolg
- Bildungsherkunft
- AkademikerInnenfamilien
- NichtakademikerInnenfamilien
- Studierende in Deutschland
- Fragestellung
- Theoretische Erklärungsansätze
- Bourdieu: Kapitaltheorie
- Boudon: Bildungswegentscheidungstheorie
- Hürden für Studierende aus NichtakademikerInnenfamilien
- Ökonomische Herausforderungen
- Kulturelle Herausforderungen
- Soziale Herausforderungen
- Ergebnisse
- Diskussion
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit zielt darauf ab, die Hürden aufzuzeigen, die Studierende aus verschiedenen Bildungsherkünften im deutschen Bildungssystem erleben. Insbesondere soll der Zusammenhang zwischen einem akademischen oder nicht-akademischen Elternhaus und dem Studienerfolg beleuchtet werden.
- Untersuchung der Auswirkungen der Bildungsherkunft auf den Studienerfolg
- Analyse von Hürden, die Studierende aus NichtakademikerInnenfamilien im Studium erleben
- Anwendung theoretischer Konzepte wie Bourdieus Kapitaltheorie und Boudons Bildungswegentscheidungstheorie
- Relevanz von ökonomischen, kulturellen und sozialen Faktoren für den Studienerfolg
- Bedeutung der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem ein und beleuchtet die Bedeutung der Bildungsherkunft für den Studienerfolg. Die Begriffsklärung definiert die zentralen Begriffe Studierende, Studienerfolg und Bildungsherkunft im Kontext der Studienarbeit. Das Kapitel "Studierende in Deutschland" präsentiert aktuelle Daten zur Bildungsherkunft von Studierenden in Deutschland. Die Fragestellung der Arbeit wird im darauf folgenden Kapitel erläutert. Im Kapitel "Theoretische Erklärungsansätze" werden Bourdieus Kapitaltheorie und Boudons Bildungswegentscheidungstheorie vorgestellt, die als theoretische Grundlage für die Analyse der Bildungsherkunft dienen. Das Kapitel "Hürden für Studierende aus NichtakademikerInnenfamilien" beschäftigt sich mit den ökonomischen, kulturellen und sozialen Herausforderungen, die Studierende aus NichtakademikerInnenfamilien im Studium erleben.
Schlüsselwörter
Die Studienarbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Bildungsherkunft, des Studienerfolgs und der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem. Wichtige Konzepte sind dabei die Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu und die Bildungswegentscheidungstheorie von Raymond Boudon. Weitere wichtige Themen sind die Analyse der Hürden, die Studierende aus NichtakademikerInnenfamilien im Studium erleben, sowie die Bedeutung von ökonomischen, kulturellen und sozialen Faktoren für den Studienerfolg.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat das Elternhaus auf den Studienerfolg?
Die Arbeit zeigt auf, dass Kinder aus akademischen Haushalten signifikant höhere Chancen auf einen Studienerfolg haben als Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien.
Was besagt Bourdieus Kapitaltheorie in diesem Kontext?
Sie erklärt, dass ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital der Eltern den Bildungsweg der Kinder maßgeblich erleichtert.
Welche Hürden erleben Studierende aus Nicht-Akademikerfamilien?
Dazu gehören finanzielle Engpässe, fehlende Netzwerke (soziales Kapital) und das Gefühl der Fremdheit im universitären Umfeld (kulturelles Kapital).
Was ist die Bildungswegentscheidungstheorie nach Boudon?
Sie unterscheidet zwischen primären Herkunftseffekten (Leistung) und sekundären Effekten (Abwägung von Kosten und Nutzen der Bildung).
Welche Datenquelle wird in der Arbeit genutzt?
Die Analyse basiert unter anderem auf der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (2017).
- Arbeit zitieren
- Anna Britner (Autor:in), 2020, Der Einfluss von akademischen Elternhäusern auf den Studienerfolg der Kinder im Vergleich zu nicht-akademischen Elternhäusern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/977884