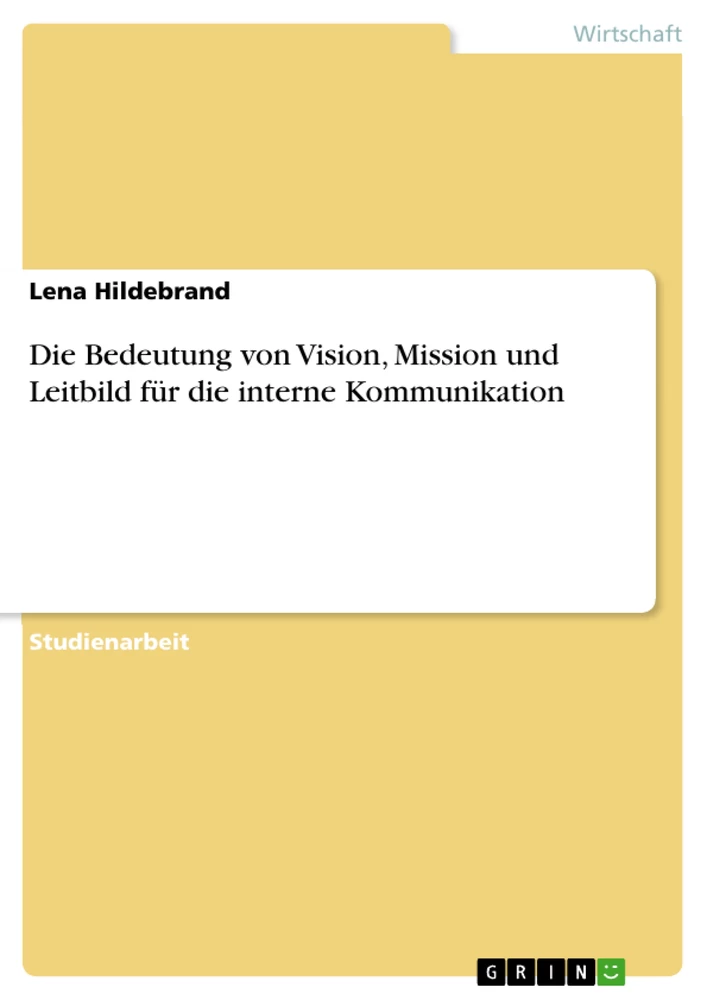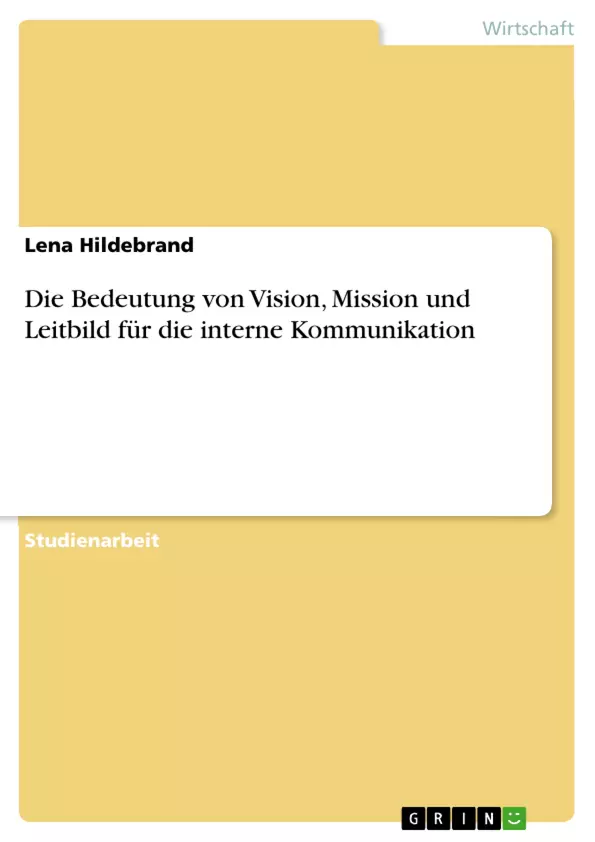Die Arbeit versucht zu beantworten, welches Begriffsverständnis sich für Vision, Mission und Leitbild aus dem aktuellen Literaturbestand ableiten lässt. Darüber hinaus soll die vorliegende Arbeit Querverbindungen zu zentralen unternehmensinternen Konzepten und Leitgrößen, wie beispielsweise der Unternehmenskultur, aufzeigen. Die zweite Forschungsfrage lautet daher: Welche Querverbindungen gibt es zwischen, Vision, Mission, Leitbild und weiteren zentralen unternehmensinternen Leitgrößen und Konzepten? Weiterhin soll ein Überblick über die Kernfunktionen gegeben werden, die Vision, Mission und Leitbild in einem Unternehmen haben und aufgezeigt werden, welche Bedeutung diese für die interne Unternehmenskommunikation haben. Hieraus ergibt sich eine dritte Forschungsfrage: Wie stehen die Ziele und Funktionen von Vision, Mission und Leitbild mit denen der internen Kommunikation in Verbindung?
In der aktuellen VUCA-Welt – welche von Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit geprägt ist, ist es von zunehmender Bedeutung, Mitarbeitern die Richtung zu weisen und Unsicherheiten zu nehmen. Hierzu leisten Visionen, Missionen und Leitbilder einen entscheidenden Beitrag. Werden die Werte und Ziele der Organisation über ein Leitbild klar und überzeugend kommuniziert, dann werden Zusammenhänge klar und die übergeordnete Strategie sowie die Ziele sowohl unter gewohnten als auch sich verändernden Rahmenbedingungen von den Mitarbeitern verstanden und verinnerlicht. Eine solche Sinnstruktur, die Orientierung bietet, ermöglicht einen Beitrag aller Organisationsmitglieder zur Wertschöpfung und der erfolgreichen Strategieumsetzung, was letztlich die Existenz einer Organisation sichert. Auf die vielfältigen Funktionen und Ziele der drei Leitgrößen Vision, Mission und Leitbild und ihre Beziehung zur internen Kommunikation in Organisationen soll in der vorliegenden Arbeit näher eingegangen werden. Alle Ausführungen sollen sich dabei hauptsächlich auf Unternehmen als in der Praxis am stärksten vertretener Organisationstyp beziehen, um eine möglichst hohe Praxisrelevanz zu schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Relevanz des Themas
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Einordnung von Vision, Mission und Leitbild in den übergeordneten Unternehmenskontext
- Zusammenhang von Vision, Mission und Leitbild und Querverbindungen zu weiteren unternehmensinternen Konzepten
- Leitbilder als normatives Management-Instrument
- Vision (Leitmotto)
- Mission (Leitmotiv)
- Werte und Grundsätze (Leitsätze)
- Zusammenfassende Leitbild-Definition
- Bedeutung von Leitbildern für die interne Kommunikation
- Zentrale Ziele und Funktionen interner Kommunikation: Status quo
- Die Innenwirkung von Leitbildern und Implikationen für die interne Kommunikation
- Orientierung
- Identifikation, Integration und Verständnis
- Motivation und Mobilisierung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Vision, Mission und Leitbild für die interne Kommunikation in Unternehmen. Sie untersucht den Zusammenhang dieser Konzepte und ihre Relevanz für die Gestaltung einer effektiven und nachhaltigen internen Kommunikation. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung von Leitbildern als strategisches Instrument zur Orientierung, Identifikation, Integration, Motivation und Mobilisierung der Mitarbeiter.
- Die Rolle von Vision, Mission und Leitbild im Unternehmenskontext
- Die Verbindung von Leitbildern mit anderen unternehmensinternen Konzepten
- Die Auswirkungen von Leitbildern auf die interne Kommunikation
- Die Bedeutung von Leitbildern für die Mitarbeitermotivation und -bindung
- Die Herausforderungen und Chancen der Implementierung von Leitbildern in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problemstellung und Relevanz des Themas, sowie die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel analysiert die Einordnung von Vision, Mission und Leitbild in den übergeordneten Unternehmenskontext und beleuchtet den Zusammenhang mit anderen unternehmensinternen Konzepten. In Kapitel drei werden die zentralen Ziele und Funktionen interner Kommunikation im Status quo sowie die Auswirkungen von Leitbildern auf die interne Kommunikation, insbesondere in Bezug auf Orientierung, Identifikation, Integration, Motivation und Mobilisierung, näher betrachtet. Das Fazit bietet einen Ausblick auf die zukünftige Relevanz des Themas und mögliche Weiterentwicklungen.
Schlüsselwörter
Vision, Mission, Leitbild, Interne Kommunikation, Unternehmenskultur, Mitarbeitermotivation, Orientierung, Identifikation, Integration, Strategie, Führung, Kommunikation, VUCA-Welt
- Quote paper
- Lena Hildebrand (Author), 2020, Die Bedeutung von Vision, Mission und Leitbild für die interne Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978552