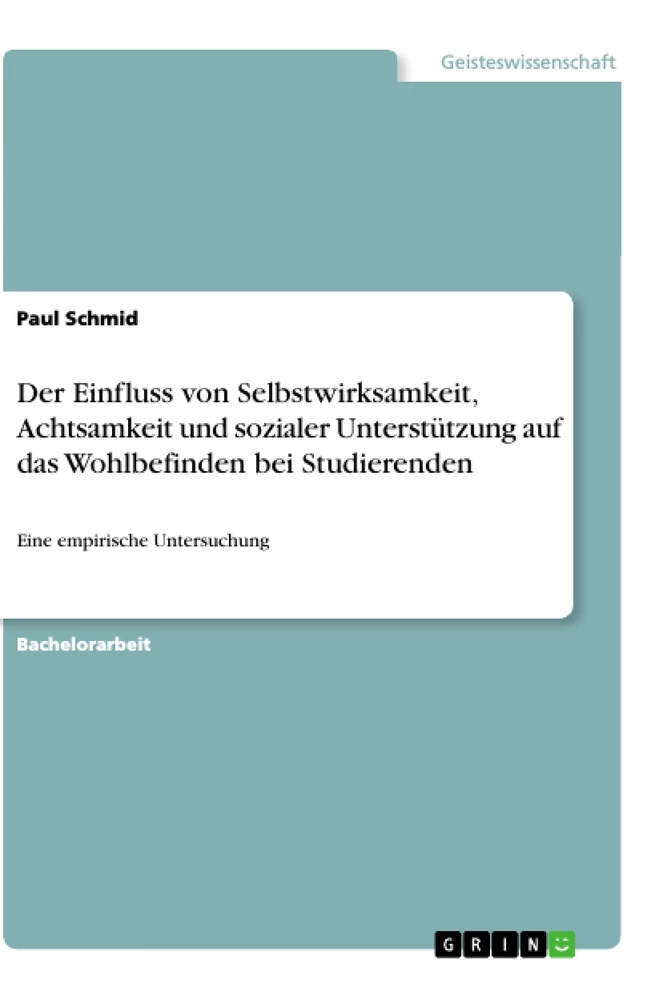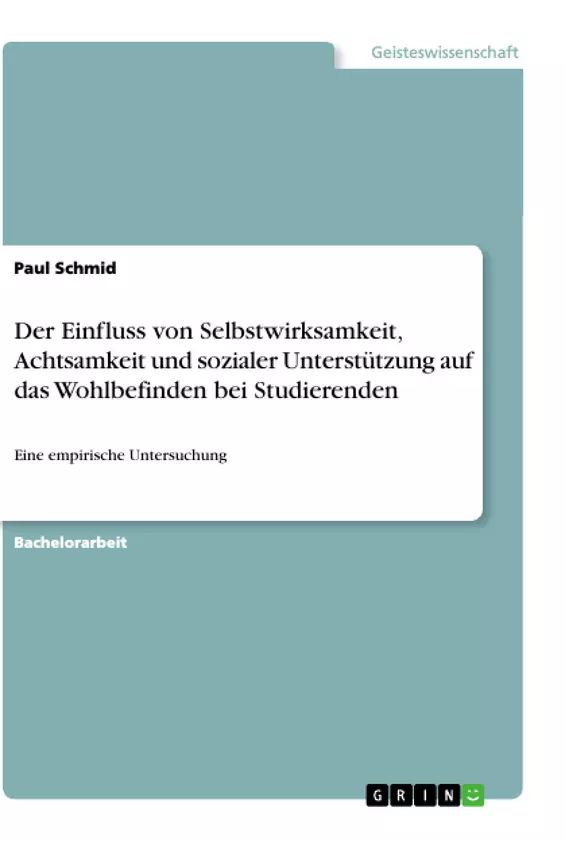Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss dreier Subkonstrukte von Resilienz, im Genaueren Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit und sozialer Unterstützung, auf das Wohlbefinden bei Studierenden. Hierfür wurden mittels eines Online-Fragebogens Daten von insgesamt 124 Studenten gesammelt. Die Stichprobe setzt sich aus 66 männlichen und 58 weiblichen Versuchspersonen mit einem Durchschnittsalter von 23.43 Jahren zusammen.
Die Psychologie als großes wissenschaftliches Feld setzt sich mit unterschiedlichsten Themen auseinander, weshalb sie in verschiedene Gebiete aufgeteilt ist. Einige wichtige Bereiche, wie beispielsweise die Klinische Psychologie, konzentrieren sich darauf, negative Zustände der menschlichen Psyche, wie psychische Krankheiten oder mangelnde Stressbewältigung, zu neutralisieren. In den letzten Jahrzehnten hat sich laut Duckworth, Steen und Seligman (2005) aus der Humanistischen Psychologie die Positive Psychologie entwickelt, welche eine neue und wichtige Sichtweise bietet. Sie beschäftigt sich mit den positiven menschlichen Eigenschaften und versucht Methoden zu vermitteln, durch die man zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben gelangt.
In der Positiven Psychologie ist man darum bemüht, dass der Mensch sich trotz schwieriger Umstände positiv entwickelt und ein gutes Wohlbefinden aufbaut. Dieser Prozess der gesunden Entwicklung trotz großer Belastungen gelingt durch die Fähigkeit der Resilienz. Resilienz ist die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Stressfolgen umgehen zu können. Geht man nach der Definition, liegt der Gedanke nahe, dass Resilienz das subjektive Wohlbefinden fördert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Resilienz
- 2.1.1 Achtsamkeit
- 2.1.2 Soziale Unterstützung
- 2.1.3 Selbstwirksamkeit
- 2.2 Wohlbefinden
- 2.3 Aktueller Forschungsstand und Forschungsfrage
- 2.1 Resilienz
- 3 Methode
- 3.1 Hypothesen
- 3.2 Stichprobenbeschreibung
- 3.3 Untersuchungsdesign
- 3.4 Operationalisierung
- 3.4.1 Achtsamkeit
- 3.4.2 Soziale Unterstützung
- 3.4.3 Selbstwirksamkeit
- 3.4.4 Wohlbefinden
- 3.5 Durchführung
- 3.5.1 Generierung der Stichprobe und Datenerhebung
- 3.5.2 Angewandte statistische Verfahren
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Deskriptive Ergebnisse
- 4.2 Hypothesenprüfung
- 4.2.1 Einfluss der Subkonstrukte von Resilienz auf das Wohlbefinden
- 5 Diskussion
- 5.1 Zusammenfassung und inhaltliche Einordnung
- 5.2 Kritische Würdigung
- 5.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss verschiedener Resilienzfaktoren auf das Wohlbefinden von Studierenden. Ziel der Arbeit ist es, die Auswirkungen von Achtsamkeit, sozialer Unterstützung und Selbstwirksamkeit auf das subjektive Wohlbefinden von Studierenden zu untersuchen und deren relative Bedeutung für die psychische Gesundheit in dieser Lebensphase zu erforschen.
- Resilienz und ihre Subkonstrukte (Achtsamkeit, soziale Unterstützung, Selbstwirksamkeit)
- Subjektives Wohlbefinden von Studierenden
- Einflussfaktoren auf das Wohlbefinden in der Studienzeit
- Empirische Untersuchung mithilfe quantitativer Methoden
- Analyse der Bedeutung der untersuchten Resilienzfaktoren für die psychische Gesundheit von Studierenden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Wohlbefinden von Studierenden vor und führt in die Forschungsfrage ein. Kapitel 2 erläutert die theoretischen Grundlagen der Arbeit, indem es die Konstrukte Resilienz, Achtsamkeit, soziale Unterstützung, Selbstwirksamkeit und Wohlbefinden definiert und deren Relevanz für das Studium beleuchtet. Kapitel 3 beschreibt die Methodik der Studie, inklusive der Hypothesenformulierung, Stichprobenbeschreibung, Untersuchungsdesign, Operationalisierung der Variablen und der angewendeten statistischen Verfahren. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel 4 dargestellt, wobei die deskriptiven Ergebnisse sowie die Hypothesenprüfung im Fokus stehen. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse diskutiert und in den Kontext der Literatur eingeordnet. Abschließend werden die Limitationen der Studie reflektiert und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsmöglichkeiten gegeben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Resilienz, Achtsamkeit, soziale Unterstützung, Selbstwirksamkeit, Wohlbefinden, Studierende, psychische Gesundheit, empirische Untersuchung, quantitative Methoden, Regressionsanalyse.
- Quote paper
- Paul Schmid (Author), 2018, Der Einfluss von Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit und sozialer Unterstützung auf das Wohlbefinden bei Studierenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/981156