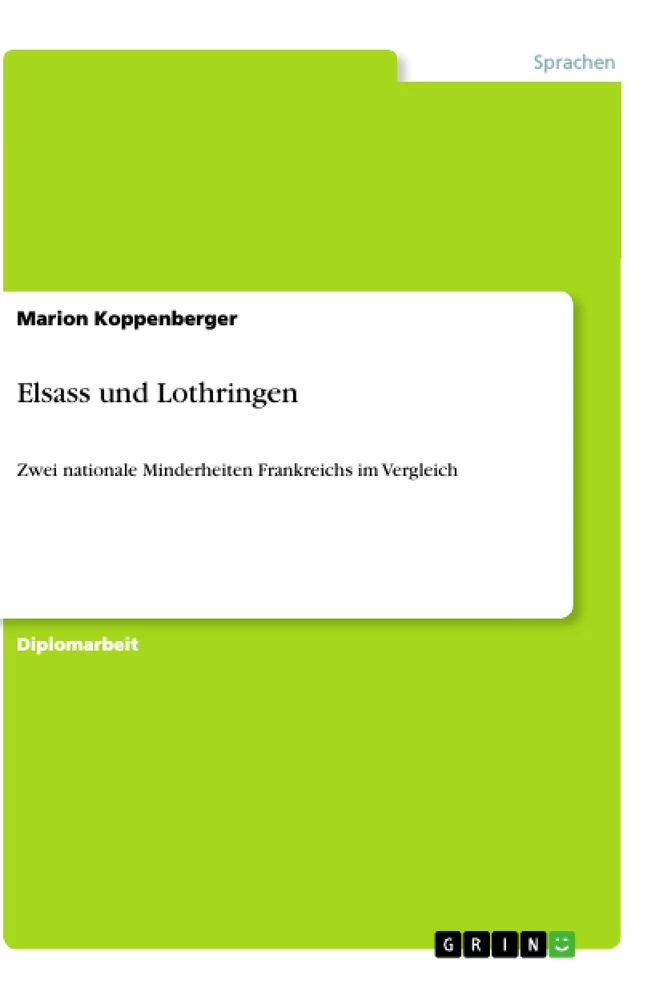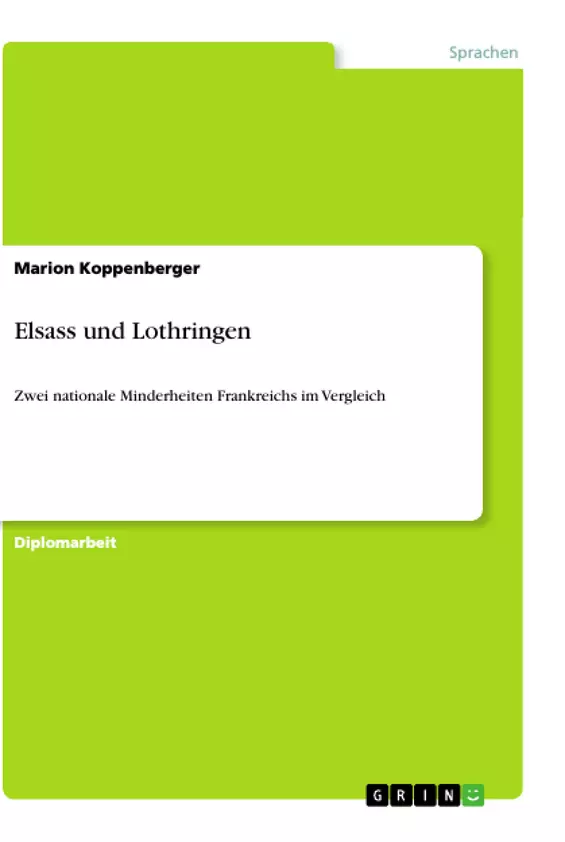Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, wie sich die aktuelle Sprachsituation im Elsass und in Lothringen darstellt und wie es zu deren Entstehen kam, um abschließend einen Vergleich zwischen dem Elsass und Ost-Lothringen anzustellen, zwei Gebieten, die sich aufgrund ihrer Kultur und Geschichte ähneln und sich dennoch, wie sich herausstellen wird, auf so unterschiedliche Weise entwickelten.
Frankreich zählt zu den Ländern Europas mit den meisten sprachlichen Minderheiten, erkennt jedoch keine von ihnen offiziell an, was es für die jeweilige Bevölkerungsgruppe schwierig macht, ihr Recht auf Sprache und Kultur zu leben, weshalb die meisten dieser Regionalsprachen und -kulturen Frankreichs mehr und mehr verfallen.
Bei einem Teil der Minderheiten, die an den Grenzen des Hexagone angesiedelt sind, wird die jeweilige Regionalsprache auch im Nachbarstaat gesprochen, entweder ebenfalls als Sprache einer Minderheit oder wie im Falle meiner beiden Untersuchungsgebiete als Staatssprache. Bekanntlich sind Grenzegebiete meist Konfliktgebiete, einerseits auf politisch-militärischer, andererseits aber auch auf sprachlicher und soziokultureller Ebene. Sowohl das Elsass, als auch der germanophone Teil Lothringens sind schon seit Jahrhunderten beides, denn aus den kriegerischen Auseinandersetzungen um die beiden Gebiete erwuchs den Völkern mit der germanischen Sprache und Kultur, die sich dennoch als Franzosen fühlen, ein identitärer Konflikt, der sich seit 1945 vor allem über sprachliche Belange abspielt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation
- Ziel der Arbeit
- Literaturübersicht
- Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Die Sprachkontaktforschung
- Bilinguismus
- Soziolinguistische Ansätze
- Nordamerikanischer Ansatz - die Domäne
- Katalanischer und okzitanischer Ansatz
- Ethnolinguistischer Ansatz
- Sozialpsychologische Perspektive
- Die Attitüde
- Das Stereotyp
- Die Identität
- Modelle zur Spracherhaltung und -umstellung
- Sprachökologische Variablen
- Ethnolinguistische Vitalität
- Der Begriff: Minderheit
- Staatssprachen, Dialekte und Minderheitensprachen
- sprachlich-kulturelle Minderheit, Nationalität und Nation
- Vier fundamentale Kriterien für Minderheiten
- Dialektale Gliederung
- Elsass
- Ost-Lothringen
- Historische Grundlagen
- Getrennte Wege bis zur Einverleibung durch Frankreich
- Elsass: Die Zeit bis zum Anschluss an Frankreich
- Elsass: Die Zeit bis zur Französischen Revolution (1648 - 1789)
- Lothringen: Die Zeit bis zum Anschluss an Frankreich
- Lothringen: Die Zeit bis zur Französischen Revolution (1735 - 1789)
- Von der Französischen Revolution bis zum Anschluss ans deutsche Reich (1789 - 1870)
- Die Zeit beim Deutschen Reich (1870-1918)
- Die Zwischenkriegszeit (1918 - 1939)
- Der 2. Weltkrieg (1940 - 1945)
- Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg
- Getrennte Wege bis zur Einverleibung durch Frankreich
- Methodische Vorgehensweise
- Forschungsfrage und Hypothesen
- Ethnolinguistische Indikatoren
- Status
- Demographie
- Institutionelle Stützung
- der offizielle Bereich
- die Kirche
- die Medien
- die Schule
- Vereine zur Förderung der Regionalsprache und -kultur
- Funktionale Verteilung
- Domäne Familie und Freundeskreis
- Domäne Öffentlichkeit
- Domäne Arbeitsplatz
- Domäne Schule
- Domäne Mediengebrauch
- Einstellungen zur Minderheitensprache und ihrer Sprecher
- Bedeutungen des Elsässischen
- Sprecherattitüden
- Der Dialekt im Individualbereich
- Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Situation
- Ethnolinguistische Indikatoren
- Status
- Demographie
- Institutionelle Stützung
- der offizielle Bereich
- die Kirche
- die Medien
- die Schule
- Vereine zur Förderung der Regionalsprache und -kultur
- Funktionale Verteilung
- Domäne Familie und Freundeskreis
- Domäne Öffentlichkeit
- Domäne Arbeitsplatz
- Domäne Schule
- Domäne Mediengebrauch
- Einstellungen zur Minderheitensprache und ihrer Sprecher
- Bedeutungen des Lothringer Platts
- Sprecherattitüden
- Der Dialekt im Individualbereich
- Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Situation
- Hypothese 1-Ethnolinguistische Vitalität
- Hypothese 2 - Funktionale Verteilung
- Hypothese 3 - Stereotype und Attitüden
- abschließende Überlegungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Sprachsituation im Elsass und im germanophonen Lothringen, zwei Regionen Frankreichs mit einer starken deutschen Sprach- und Kulturtradition. Das Ziel der Arbeit ist es, die aktuelle Sprachsituation in beiden Regionen zu beschreiben, ihren Ursprung zu beleuchten und einen Vergleich zwischen den beiden Regionen durchzuführen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, wie sich die Geschichte und die politische Situation auf die Entwicklung und den Status der regionalen Sprachen ausgewirkt haben.
- Die sprachliche Situation in den Regionen Elsass und Lothringen
- Der Einfluss historischer Ereignisse auf die Entwicklung der Sprachen
- Die Rolle von Politik und Gesellschaft in der Förderung oder Unterdrückung der regionalen Sprachen
- Soziolinguistische und ethnolinguistische Aspekte der Sprachverwendung
- Der Vergleich der Situation im Elsass und Lothringen im Hinblick auf den Status und die Vitalität der regionalen Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in die Thematik der sprachlichen Minderheiten in Frankreich ein und stellt die Motivation sowie das Ziel der Arbeit vor. Der Fokus liegt auf den Regionen Elsass und Lothringen und ihrer Geschichte im Kontext der französischen Sprachpolitik.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel behandelt die relevanten theoretischen Konzepte, die für die Analyse der Situation im Elsass und Lothringen notwendig sind. Dazu gehören die Sprachkontaktforschung, der Bilinguismus, das Konzept der Minderheit und Modelle zur Spracherhaltung und -umstellung.
- Charakterisierung der allgemeinen Situation in den Untersuchungsgebieten: Dieses Kapitel bietet eine allgemeine Übersicht der Sprachsituation in den Regionen Elsass und Lothringen, einschließlich ihrer dialektalen Gliederung und einer kurzen Darstellung der historischen Entwicklung.
- Wissenschaftliche Argumentation: Dieses Kapitel erläutert die methodische Vorgehensweise und stellt die Forschungsfrage sowie die Hypothesen der Arbeit vor.
- Elsass: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der Sprachsituation im Elsass. Es werden die ethnolinguistischen Indikatoren, die funktionale Verteilung der regionalen Sprache und die Einstellungen der Bevölkerung zur Sprache und ihren Sprechern untersucht.
- Ost-Lothringen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Sprachsituation im germanophonen Lothringen. Es werden die ethnolinguistischen Indikatoren, die funktionale Verteilung der regionalen Sprache und die Einstellungen der Bevölkerung zur Sprache und ihren Sprechern untersucht.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Themenfeld der sprachlichen Minderheiten in Frankreich, insbesondere im Elsass und im germanophonen Lothringen. Die Schlüsselwörter umfassen die Begriffe Sprachkontakt, Bilinguismus, Minderheitensprache, Dialekt, Ethnolinguistik, Soziolinguistik, Sprachpolitik, Spracherhaltung, Sprachwandel, Identitätsbildung und Kulturkontakt. Weitere wichtige Begriffe sind Diglossie, Sprachvitalität, Stereotypen, Attitüden und Funktionale Verteilung.
- Citation du texte
- Marion Koppenberger (Auteur), 2003, Elsass und Lothringen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992875