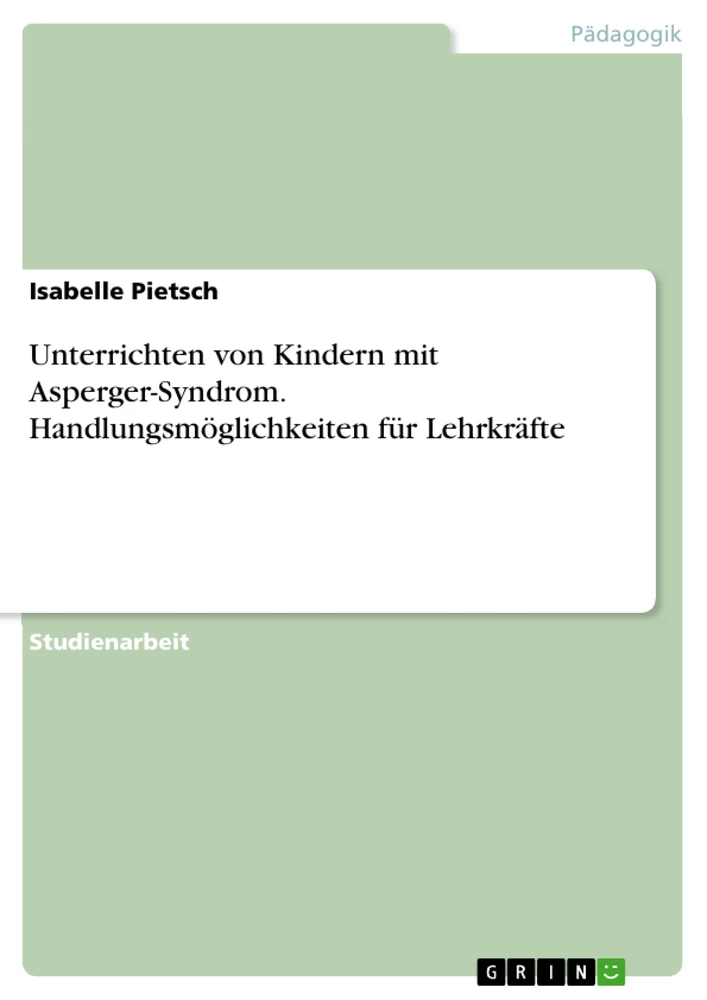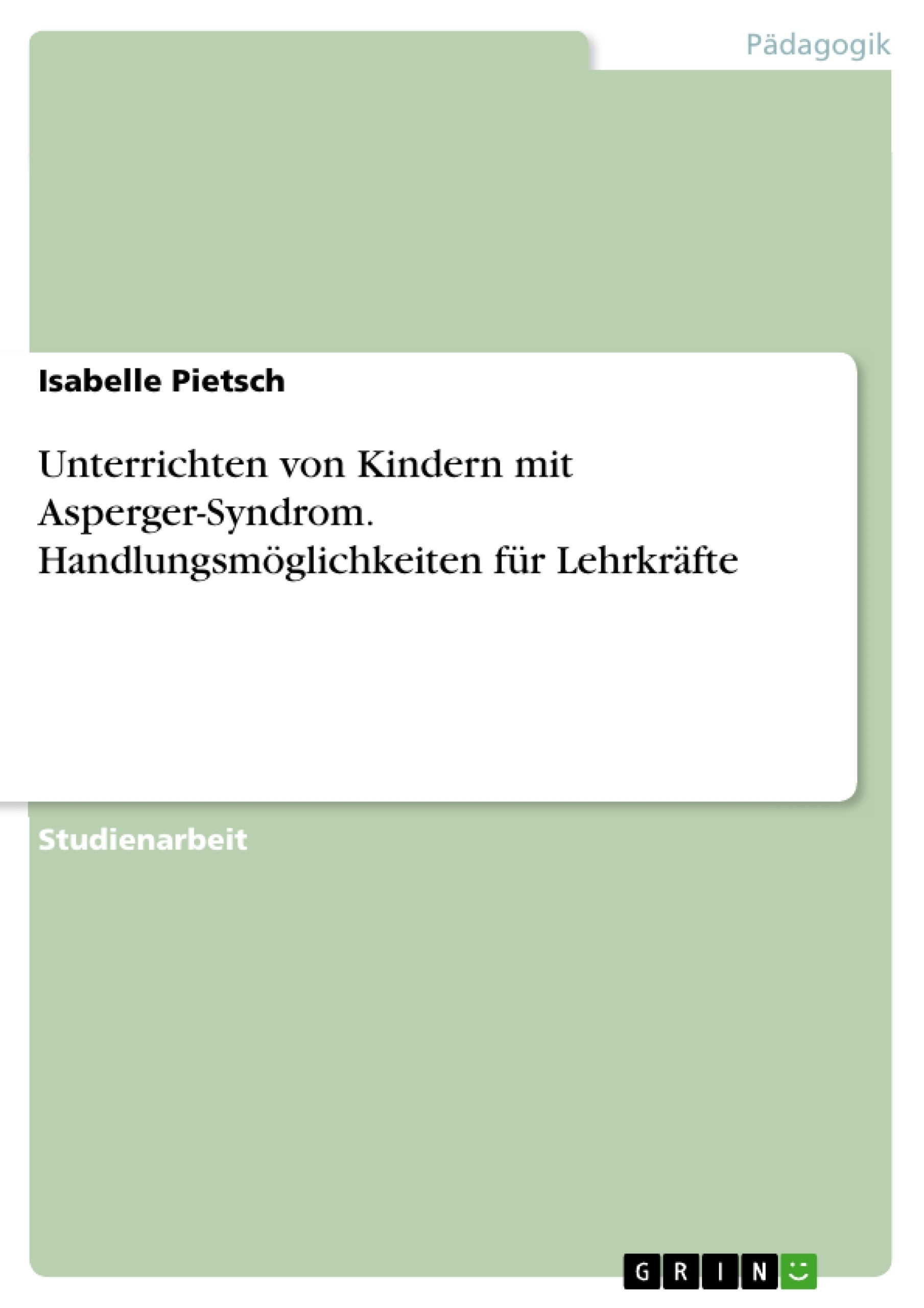Diese Arbeit beschäftigt sich mit Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte beim Unterrichten von Kindern mit dem Asperger-Syndrom.
Jedes Kind ist einzigartig! Schon lange wird eine gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung gefordert. Durch den Besuch einer allgemeinen Schule können Kinder mit einer Behinderung gesellschaftliche Teilhabe und Integration in die Gemeinschaft erfahren.
Beim Besuch einer Förderschule könnten Chancenungleichheiten, Diskriminierung und Herabwürdigung für das betreffende Kind entstehen. Daher ist Inklusion und Integration heutzutage nicht mehr wegzudenken, bringt jedoch einige Herausforderungen mit sich. Vieles muss sich ändern damit erfolgreiche Inklusion funktionieren kann.
Lehrkräfte müssen sich Fort- und Weiterbilden, damit der Umgang mit Heterogenität gelingt. Außerdem muss die Organisation in der Schule und die Lehr- und Bildungspläne überarbeitet werden. Da es viele verschiedene Behinderungen bei Kindern gibt, habe ich mich in der vorliegenden Arbeit auf das Asperger-Syndrom, eine Störung des autistischen Spektrums fokussiert. Doch worauf muss eine Lehrkraft beim Umgang mit Kindern mit Asperger-Syndrom achten?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fallbeispiel
- 3. Asperger-Syndrom - Einordnung in das autistische Spektrum
- 3.1. Übersicht über das autistische Spektrum
- 3.2. Asperger-Syndrom
- 3.2.1. Einschränkungen in der Kommunikation
- 3.2.2. Einschränkungen in der motorischen Entwicklung
- 3.2.3. Einschränkungen in der sozialen Interaktion
- 3.2.4. Ausgeprägte Interessen
- 4. Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte
- 4.1. Bezug zu den sozialen, motorischen und kommunikativen Beeinträchtigungen
- 4.2. Klassensituation
- 4.3. Räumliche Voraussetzungen
- 4.3.1. Gestaltung des Klassenraums
- 4.3.2. Gestaltung der Schule
- 4.4. Nachteilsausgleiche
- 4.5. Organisation von Aufgaben und Abläufen
- 4.6. Personal
- 4.6.1. Lehrpersonal
- 4.6.2. Integrationshelfer/Schulbegleiter
- 5. Beurteilung des Fallbeispiels vor theoretischem Hintergrund
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte im Umgang mit Kindern mit Asperger-Syndrom im inklusiven Schulkontext. Sie beleuchtet die spezifischen Bedürfnisse dieser Kinder und zeigt auf, wie ein adäquates pädagogisches Vorgehen aussehen kann.
- Das Asperger-Syndrom und seine Einordnung im autistischen Spektrum
- Spezifische Herausforderungen im Unterricht von Kindern mit Asperger-Syndrom
- Gestaltung des Klassenraums und der Schule zur Förderung von Kindern mit Asperger-Syndrom
- Organisation von Aufgaben und Abläufen für Kinder mit Asperger-Syndrom
- Rollen und Aufgaben des Lehrpersonals und weiterer Unterstützungssysteme
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Inklusion und die Herausforderungen im Umgang mit Kindern mit Behinderungen ein. Sie fokussiert sich auf das Asperger-Syndrom als eine Störung des autistischen Spektrums und benennt die Zielsetzung der Arbeit: die Darstellung von Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte im Umgang mit betroffenen Kindern. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit von Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte und der Anpassung von Organisation und Lehrplänen für einen erfolgreichen inklusiven Ansatz. Das Fallbeispiel von Jonas dient als anschauliche Einführung in die Thematik.
2. Fallbeispiel: Dieses Kapitel präsentiert den Fall von Jonas, einem zehnjährigen Jungen mit Asperger-Syndrom, der eine Förderschule besucht. Es beschreibt detailliert Jonas' Verhalten, seine Stärken und Schwächen, seine sozialen Interaktionen und seine Reaktionen auf bestimmte Situationen. Die Beschreibung von Jonas' Alltag und seinen Reaktionen auf Veränderungen, wie den Besuch seiner Mutter, illustriert die Herausforderungen im Umgang mit Kindern mit Asperger-Syndrom und dient als Basis für die späteren Ausführungen zu Handlungsmöglichkeiten. Die strukturierte Umgebung der Förderschule und die unterstützenden Maßnahmen der Lehrkraft werden ebenfalls hervorgehoben.
3. Asperger-Syndrom - Einordnung in das autistische Spektrum: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über das autistische Spektrum und positioniert das Asperger-Syndrom innerhalb dieses Spektrums. Es erläutert die verschiedenen Formen des Autismus (Frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom, atypischer Autismus) und hebt die Heterogenität der Symptomatik hervor. Es wird betont, dass es kein „typisches“ Bild eines Autisten gibt und die Ausprägung der Symptome stark variieren kann. Der Abschnitt dient dazu, ein grundlegendes Verständnis des Asperger-Syndroms und seiner vielschichtigen Auswirkungen zu schaffen, um die nachfolgenden Ausführungen zu Handlungsempfehlungen zu fundieren.
Schlüsselwörter
Asperger-Syndrom, Autistisches Spektrum, Inklusion, Handlungsoptionen, Lehrkräfte, sonderpädagogische Förderung, Klassenzimmergestaltung, Schulorganisation, soziale Interaktion, Kommunikation, motorische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte im Umgang mit Kindern mit Asperger-Syndrom
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet eine umfassende Übersicht zu den Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte im Umgang mit Kindern mit Asperger-Syndrom im inklusiven Schulkontext. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Ein Fallbeispiel eines Kindes mit Asperger-Syndrom dient als praxisrelevante Grundlage.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: Die Einordnung des Asperger-Syndroms im autistischen Spektrum, die spezifischen Herausforderungen im Unterricht von Kindern mit Asperger-Syndrom (Beeinträchtigungen in Kommunikation, Motorik und sozialer Interaktion), die Gestaltung des Klassenraums und der Schule zur optimalen Förderung, die Organisation von Aufgaben und Abläufen, die Rollen und Aufgaben des Lehrpersonals und weiterer Unterstützungssysteme (z.B. Integrationshelfer).
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument ist strukturiert in Kapitel: Einleitung, Fallbeispiel (Jonas), Einordnung des Asperger-Syndroms ins autistische Spektrum, Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte (inkl. Unterkapitel zu Klassenzimmergestaltung, Schulorganisation, Nachteilsausgleich etc.) und Beurteilung des Fallbeispiels vor theoretischem Hintergrund. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst.
Welches Fallbeispiel wird verwendet?
Das Dokument verwendet das Fallbeispiel von Jonas, einem zehnjährigen Jungen mit Asperger-Syndrom, der eine Förderschule besucht. Sein Alltag, seine Stärken und Schwächen, seine sozialen Interaktionen und Reaktionen auf verschiedene Situationen werden detailliert beschrieben, um die Herausforderungen im Umgang mit Kindern mit Asperger-Syndrom zu veranschaulichen.
Welche Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt verschiedene Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, die sich auf die sozialen, motorischen und kommunikativen Beeinträchtigungen von Kindern mit Asperger-Syndrom beziehen. Es geht auf die Gestaltung des Klassenraums und der Schule ein, die Organisation von Aufgaben und Abläufen, den Einsatz von Nachteilsausgleichen und die Rolle des Lehrpersonals sowie weiterer Unterstützungssysteme (Integrationshelfer/Schulbegleiter).
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Asperger-Syndrom, Autistisches Spektrum, Inklusion, Handlungsoptionen, Lehrkräfte, sonderpädagogische Förderung, Klassenzimmergestaltung, Schulorganisation, soziale Interaktion, Kommunikation, motorische Entwicklung.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich primär an Lehrkräfte, die mit Kindern mit Asperger-Syndrom arbeiten oder dies in Zukunft tun werden. Es kann auch für Auszubildende im pädagogischen Bereich, Sonderpädagogen und alle Interessierten hilfreich sein, die mehr über die Inklusion von Kindern mit Asperger-Syndrom erfahren möchten.
Wo finde ich mehr Informationen zum Asperger-Syndrom?
Das Dokument dient als Einführung. Für weiterführende Informationen zum Asperger-Syndrom empfiehlt es sich, Fachliteratur zu konsultieren oder sich an spezialisierte Institutionen und Beratungsstellen zu wenden.
- Quote paper
- Isabelle Pietsch (Author), 2021, Unterrichten von Kindern mit Asperger-Syndrom. Handlungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/997434