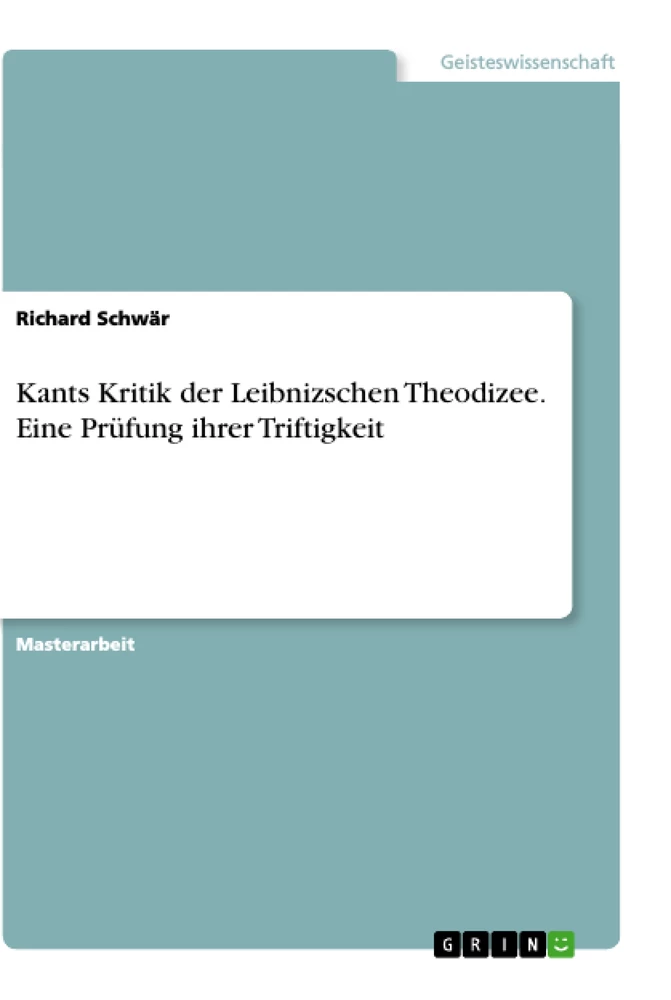Wie lässt sich das Vorhandensein des Übels und des Bösen in der Welt mit dem Glauben an einen allwissenden, allmächtigen und allgütigen Gott vereinbaren? Warum gibt es Naturkatastrophen, Krankheiten, Verbrechen und himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn Gott doch davon weiß und dies alles verhindern könnte?
Die vorliegende Arbeit widmet sich den Bemühungen des großen Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz, auf diese Fragen, die sich allen Menschen stellen, welche die Welt als Schöpfung verstehen, eine Antwort zu finden. Leibniz selbst führte für das zu lösende Problem die Bezeichnung „Theodizee“ ein, d. h. die Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt. Die Analyse seiner gleichnamigen Abhandlung, in der er versucht, Wissenschaft und Glauben zu versöhnen, steht im Mittelpunkt des ersten Teils dieser Arbeit.
Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Kritik Immanuel Kants an der optimistischen Lösung von Leibniz, der davon überzeugt ist, dass sich Glaube und Vernunft versöhnen lassen und somit das Theodizee-Problem lösbar ist. Kant dagegen erklärt alle bisherigen Versuche in der Theodizee für gescheitert, weil diese die Begrenztheit der theoretischen Vernunft missachten. Dennoch hält auch er am Gottesglauben fest und entwickelt einen Gegenentwurf, für den er den Titel „authentische“ Theodizee beansprucht. Da Kants Lösung auf seiner Moralphilosophie basiert, wird diese im zweiten Hauptteil in ihren Grundzügen vorgestellt.
Inwieweit Kants Kritik berechtigt ist, wird im letzten Kapitel untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Theodizee von Leibniz
- 2.1. Die Vereinbarkeit von Glaube und Vernunft
- 2.2. Das Theorem von der besten aller möglichen Welten
- 2.2.1 Die bestmögliche Welt und die Theodizee
- 2.2.2 Die Privationstheorie
- 2.3. Freiheit und Notwendigkeit
- 2.3.1 Vorherwissen Gottes und menschliche Freiheit
- 2.3.2. Die Fiktion einer absoluten Indifferenz
- 2.3.3 Abwehr des Nezessitarismus Spinozas
- 2.3.4 Freiheit und malum morale
- 3. Kants Theodizeekritik
- 3.1 Kants Schrift „Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee“
- 3.2 Definition
- 3.3 Das Zweckwidrige
- 3.3.1 Die Heiligkeit Gottes
- 3.3.2 Die Güte Gottes
- 3.3.3 Die Gerechtigkeit Gottes
- 3.4 Ergebnis der Rechtfertigungsversuche
- 3.5 Kunstweisheit und moralische Weisheit
- 3.5.1 Kunstweisheit
- 3.5.2 Exkurs: Sittengesetz und Freiheit
- 3.5.3 Moralische Weisheit
- 3.6 Doktrinale und authentische Theodizee
- 3.6.1 Theodizee oder Anthropodizee?
- 3.6.2 Das Postulat vom Dasein Gottes nach der Kritik der praktischen Vernunft
- 3.6.3 Der moralische Gottesbeweis in der Kritik der Urteilskraft
- 3.6.4 Das Postulat von der Unsterblichkeit der Seele
- 3.6.5 Der epistemische Status der Postulate
- 3.6.5 Der Ursprung des Bösen
- 3.6.6 Der Sieg des Guten und das Reich Gottes auf Erden
- 3.6.7 Kants moralische Theodizee
- 3.6.8 Hiob als Vertreter einer authentischen Theodizee
- 3.6.9 Berechtigung von Kants Theodizee
- 4. Resümee: Wie zutreffend ist Kants Kritik an der Leibnizschen Theodizee?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit Immanuel Kants Kritik an Gottfried Wilhelm Leibniz’ Theodizee. Sie analysiert Kants Argumentation und untersucht, ob seine Kritik an der Leibnizschen Rechtfertigung der göttlichen Güte in einer Welt voller Leid zutreffend ist. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die philosophischen Grundlagen der Theodizee-Debatte aufzuzeigen und Kants Beitrag zu dieser Diskussion zu beleuchten.
- Vereinbarkeit von Glaube und Vernunft
- Das Problem des Übels in der Welt
- Die beste aller möglichen Welten
- Freiheit und Notwendigkeit
- Kants Kritik der traditionellen Theodizee
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung nach der Vereinbarkeit von Gottes Güte mit dem Vorhandensein des Übels in der Welt vor und skizziert den historischen Kontext der Theodizee-Debatte. Sie zeigt auf, dass die Frage nach dem Ursprung und Sinn des Übels im Judentum und Christentum unterschiedliche Bedeutungen und Antworten erfahren hat.
Kapitel 2 widmet sich Leibniz’ Theodizee und analysiert seine Argumente zur Vereinbarkeit von Glaube und Vernunft. Es erläutert die zentralen Elemente der Leibnizschen Theodizee, wie das Theorem von der besten aller möglichen Welten und die Privationstheorie.
Kapitel 3 behandelt Kants Kritik an der Leibnizschen Theodizee und analysiert seine zentrale Schrift "Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee". Es wird Kants Argumentation gegen die Zweckwidrigkeit der Welt und seine Definition der "moralischen Weisheit" erläutert.
Kapitel 4 fasst die zentralen Argumente der Arbeit zusammen und bewertet die Stichhaltigkeit von Kants Kritik an der Leibnizschen Theodizee.
Schlüsselwörter
Die Masterarbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen und Themen: Theodizee, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Übel, Freiheit, Notwendigkeit, Gottes Güte, Vernunft, Glaube, Moral, Sittengesetz, beste aller möglichen Welten, Privationstheorie, Rechtfertigung des Leidens.
- Quote paper
- Richard Schwär (Author), 2008, Kants Kritik der Leibnizschen Theodizee. Eine Prüfung ihrer Triftigkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1007277