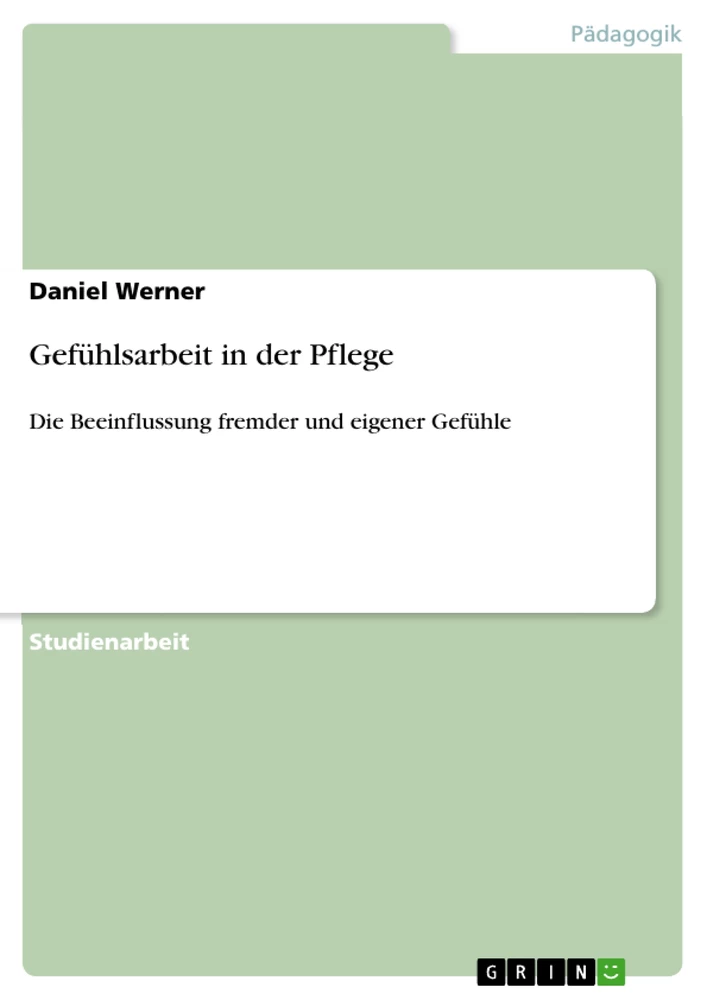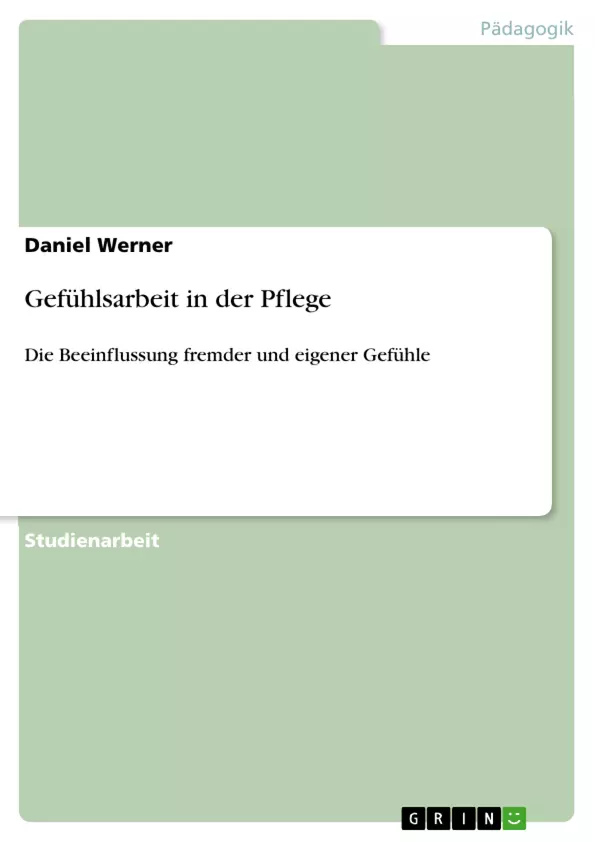„Schwester Biljana kommt zur Frühschicht auf ihre Altenpflegestation. Nach der Übergabe schaut sie zunächst in alle Zimmer ihres Pflegebereiches. Im Zimmer von Frau Meier und Frau Schmidt bemerkt sie sogleich einen beißenden Geruch. Sie weiß: Frau Meier, eine Bewohnerin mit demenzieller Erkrankung hatte diese Nacht wieder Durchfall. Nachdem sie sich einen ersten Eindruck darüber verschafft hat, welche Bewohner bereits wach sind und welche heute etwas länger schlafen wollen, geht sie erneut zu Frau Meier, um die Bettwäsche und die Einlage zu wechseln. Sie berührt sie sanft am Arm: „Guten Morgen, Frau Meierli. Ich wechsle jetzt den Bettbezug und wasche Sie dann gleich auch. Ist das in Ordnung?“ Frau Meier brummelt fortwährend unflätige Worte vor sich hin, während Schwester Biljana ihre Arbeit verrichtet. „Dankeschön, Meierli, ist gut, ist gut.“ Schwester Biljana verzieht etwas das Gesicht, als sie das Ausmaß des Durchfalls erkennt. Bevor sie mit dem Waschlappen den After wäscht sagt sie: „Aufgepasst, jetzt wird es ein klein bisschen kalt“. Nach dem Waschen gibt Schwester Biljana Frau Meier mit der Schnabeltasse Tee ein. Frau Meier drückt jedoch ihre Lippen zusammen. „Wenn Sie nicht trinken, kriegen Sie eine Infusion - wissen Sie das!?“ Nach etwas Widerstand trinkt Frau Meier einige Schlückchen.“ (BÖHLE, Fritz, GLASER, Jürgen, 2006, S. 59)
Nach einer kurzen Begriffsklärung in dem Kapitel zwei soll in dem dritten Kapitel auf drei verschiedene emotionstheoretische Modelle eingegangen werden. Dabei soll die Theorie von James-Lange, die Theorie von Cannon-Bard und die Theorie von Lazarus-Schachter näher betrachtet werden. Im Hauptteil, dem vierten Kapitel, dieser Arbeit geht es um das Pflegepersonal-Patienten-Verhältnis. Die Erwartungen, die an das Pflegepersonal gestellt werden und die Belastungen die daraus erfolgen, sind enorm und oft unterschätzt. Daraus resultiert bei vielen Pflegenden eine Gefühlsarmut, die sich auf den Patienten überträgt. Welche Gründe das, außer der Überbelastung noch haben kann, soll unter Punkt 4.3 erörtert werden. Zu einem kurzen Exkurs in die Psychotherapie soll aufgrund der Literatur von Claudia Bischoff-Wanner die Übertragbarkeit der psychotherapeutischen Beziehungsmodelle auf die Pflege exemplarisch untersucht werden. In einem letzten Punkt sollen die drei Ebenen der Gefühlsarbeit von Arlie Hochschildt erläutert werden. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf die Zukunft dieser Thematik.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung
- Emotionen
- Ekel
- Pflegeprozess
- Drei Emotionstheorien
- Die James-Lange-Theorie
- Die Cannon-Bard-Theorie
- Die Lazarus-Schachter-Theorie
- Die Arbeit mit Gefühlen in der Pflege
- Die Erwartungen an das Pflegepersonal
- Die Belastungen in der Pflege
- Die Auswirkungen mangelnder Gefühlsarbeit und deren Gründe
- Die Übertragbarkeit von psychotherapeutischen Beziehungsmodellen auf die Pflege nach Bischoff-Wanner
- Drei Ebenen der Gefühlsarbeit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Gefühlsarbeit im Pflegekontext. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Belastungen, denen Pflegepersonal im Umgang mit eigenen und fremden Emotionen begegnet. Die Arbeit analysiert verschiedene emotionstheoretische Modelle und deren Relevanz für die Praxis. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die emotionale Dynamik in der Pflege zu schaffen und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen.
- Emotionstheorien und deren Anwendung in der Pflege
- Belastungen und Herausforderungen für Pflegepersonal im Umgang mit Emotionen
- Auswirkungen mangelnder Gefühlsarbeit auf Patienten und Pflegekräfte
- Übertragbarkeit psychotherapeutischer Modelle auf die Pflege
- Ebenen der Gefühlsarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt anhand eines einleitenden Beispiels in die Thematik der Gefühlsarbeit in der Pflege ein und gibt einen Überblick über die Struktur und den Inhalt der Arbeit. Sie skizziert die zentralen Fragen, die im Laufe der Arbeit behandelt werden, und verweist auf die methodischen Ansätze.
Begriffsklärung: Dieses Kapitel klärt grundlegende Begriffe wie Emotionen, Ekel und Pflegeprozess. Es bietet umfassende Definitionen, differenziert zwischen Emotionen und Gefühlen und beschreibt Ekel als eigenständige Empfindung. Der Pflegeprozess wird als dynamischer Problemlösungs- und Beziehungsprozess definiert, der an den sich verändernden Zustand des Patienten angepasst werden muss. Diese Begriffsklärung legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel.
Drei Emotionstheorien: Dieses Kapitel stellt drei bedeutende Emotionstheorien vor: die James-Lange-Theorie, die Cannon-Bard-Theorie und die Lazarus-Schachter-Theorie. Es analysiert die jeweiligen Annahmen und Unterschiede dieser Theorien und erörtert deren Implikationen für das Verständnis von Emotionen im Pflegekontext. Der Vergleich der Theorien ermöglicht eine differenzierte Perspektive auf die Entstehung und das Erleben von Emotionen.
Die Arbeit mit Gefühlen in der Pflege: Der Hauptteil der Arbeit befasst sich mit dem komplexen Zusammenspiel von Gefühlen im Pflegealltag. Er analysiert die hohen Erwartungen an Pflegekräfte, die daraus resultierenden Belastungen und die potenziellen Folgen mangelnder Gefühlsarbeit. Es wird diskutiert, wie sich emotionale Erschöpfung auf das Pflegepersonal und die Patienten auswirkt und welche Faktoren dazu beitragen. Die Übertragbarkeit psychotherapeutischer Beziehungsmodelle auf die Pflege wird anhand von Bischoff-Wanners Arbeiten exemplarisch untersucht. Schliesslich werden die drei Ebenen der Gefühlsarbeit nach Arlie Hochschildt erläutert und in den Kontext der Pflege eingeordnet. Die Kapitel verbindet eine umfassende Analyse der Herausforderungen und Chancen im Umgang mit Emotionen im Pflegekontext.
Schlüsselwörter
Gefühlsarbeit, Pflege, Emotionen, Ekel, Pflegeprozess, James-Lange-Theorie, Cannon-Bard-Theorie, Lazarus-Schachter-Theorie, Belastungen, Erwartungen, Patienten-Pflegekraft-Beziehung, Psychotherapie, Bischoff-Wanner, Hochschild.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Gefühlsarbeit in der Pflege
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Gefühlsarbeit im Pflegekontext. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Belastungen für Pflegepersonal im Umgang mit eigenen und fremden Emotionen, analysiert verschiedene emotionstheoretische Modelle und deren Relevanz für die Praxis und zeigt mögliche Lösungsansätze auf.
Welche Emotionstheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt drei bedeutende Emotionstheorien: die James-Lange-Theorie, die Cannon-Bard-Theorie und die Lazarus-Schachter-Theorie. Diese werden vorgestellt, verglichen und hinsichtlich ihrer Implikationen für den Pflegekontext analysiert.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit klärt grundlegende Begriffe wie Emotionen, Ekel und Pflegeprozess. Es wird zwischen Emotionen und Gefühlen differenziert und der Pflegeprozess als dynamischer Problemlösungs- und Beziehungsprozess definiert.
Welche Herausforderungen und Belastungen für Pflegekräfte werden angesprochen?
Die Arbeit analysiert die hohen Erwartungen an Pflegekräfte, die daraus resultierenden Belastungen und die potenziellen Folgen mangelnder Gefühlsarbeit. Es wird diskutiert, wie sich emotionale Erschöpfung auf das Pflegepersonal und die Patienten auswirkt und welche Faktoren dazu beitragen.
Wie werden psychotherapeutische Modelle in den Pflegekontext eingeordnet?
Die Übertragbarkeit psychotherapeutischer Beziehungsmodelle auf die Pflege wird anhand von Bischoff-Wanners Arbeiten exemplarisch untersucht. Die Arbeit erläutert zudem die drei Ebenen der Gefühlsarbeit nach Arlie Hochschild und ordnet diese in den Kontext der Pflege ein.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Begriffsklärung (Emotionen, Ekel, Pflegeprozess), drei Emotionstheorien (James-Lange, Cannon-Bard, Lazarus-Schachter), Die Arbeit mit Gefühlen in der Pflege (Erwartungen, Belastungen, Auswirkungen mangelnder Gefühlsarbeit, Übertragbarkeit psychotherapeutischer Modelle, Ebenen der Gefühlsarbeit) und Fazit/Ausblick.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gefühlsarbeit, Pflege, Emotionen, Ekel, Pflegeprozess, James-Lange-Theorie, Cannon-Bard-Theorie, Lazarus-Schachter-Theorie, Belastungen, Erwartungen, Patienten-Pflegekraft-Beziehung, Psychotherapie, Bischoff-Wanner, Hochschild.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein besseres Verständnis für die emotionale Dynamik in der Pflege zu schaffen und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Sie untersucht die Bedeutung von Gefühlsarbeit im Pflegekontext und beleuchtet die Herausforderungen und Belastungen im Umgang mit eigenen und fremden Emotionen.
- Citation du texte
- Daniel Werner (Auteur), 2009, Gefühlsarbeit in der Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/125061