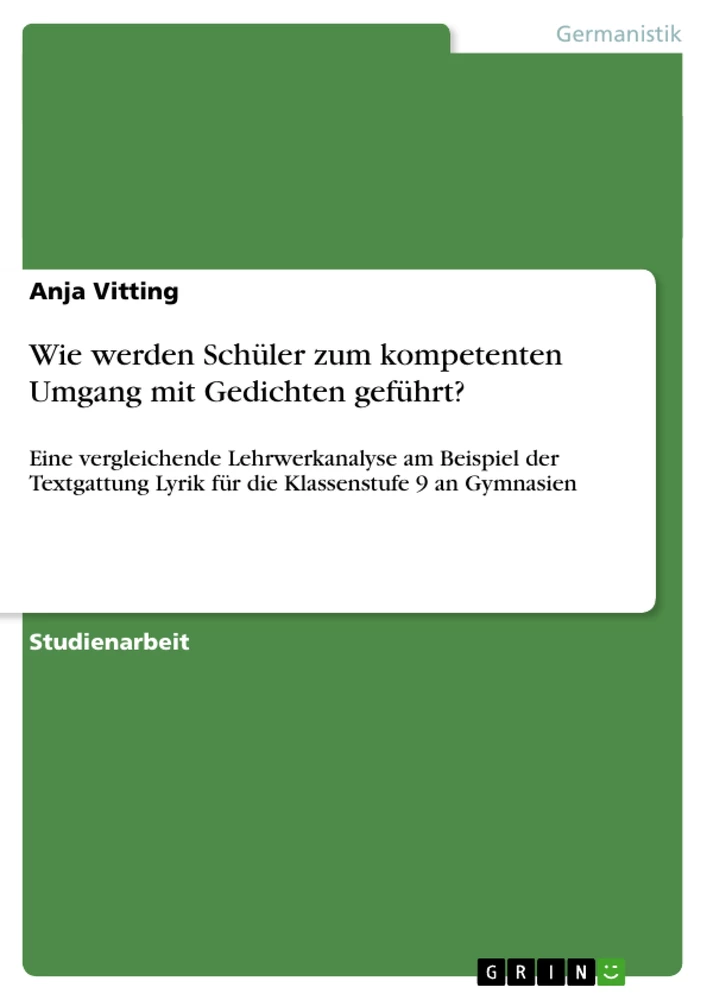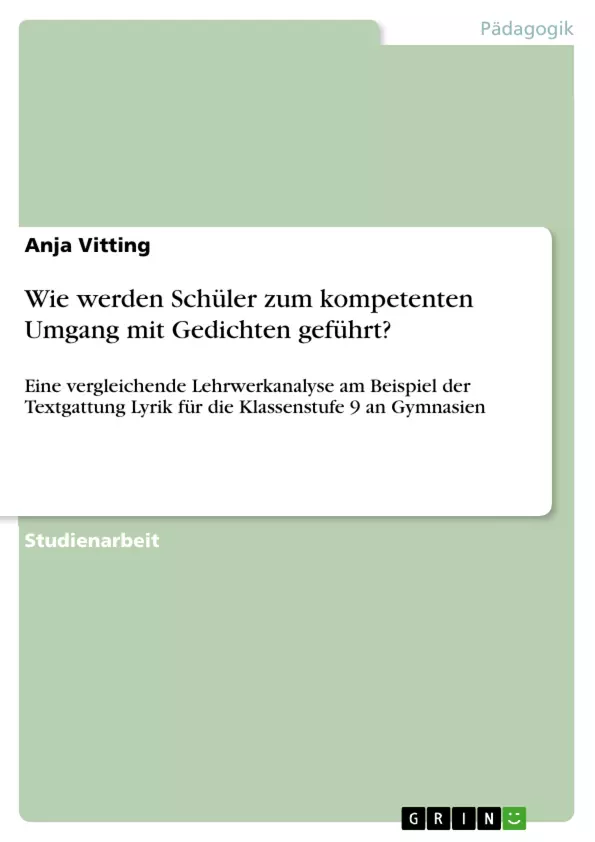In den vergangenen Jahrzehnten wurden lyrische Werke im Deutschunterricht immer wieder als Basis für analytische Interpretationen des Typus Inhalt-Form-Einheit missbraucht, die vor allem das Herexerzieren epochentypischer und formaler Merkmale unter der Überschrift des poetischen Lernens als wesentlichen Erkenntnisertrag in den Mittelpunkt setzten. Den Schülern hat diese Art und Weise des Umgangs, eines Zerpflückens und Zurechtbiegens der Werke, das Interesse an Gedichten weitestgehend verdorben. Neuere Konzeptionen des Lyrikunterrichts geben seit den 1980ern durch imaginative Zugänge, handlungs- und produktionsorientierte Verfahren sowie Integration von Schülervorwissen und -interesse eine andere Richtung an, die vor allem Akzente auf eine Verstehensleistung setzt. Dabei steht nicht das, was „der Autor uns sagen möchte“ im Vordergrund – es geht vielmehr um die Relativierung eigener und fremder Subjektivität , die Textwirkung auf den Leser und Beschreibung von Besonderheiten, die mit Zitaten aus dem Text belegt werden sollen. Darüber hinaus soll der Schüler durch kreative und operative Verfahren selbst tätig werden. Die vorliegende Hausarbeit wird sich im Folgenden damit beschäftigen, wie – ausgehend von verschiedenen didaktischen Positionen und den Vorgaben des Thüringer Lehrplans – die Schüler nun eigentlich zu einem kompetenten Umgang mit lyrischen Werken in den verschiedenen Lehrbüchern geführt werden. Was sollen die Schüler lernen und wie wird es ihnen beigebracht? Geht es mehr um Produktion oder Rezeption? Herrschen induktive oder deduktive Aufgaben vor und wie viel Freiheit steht den Schülern beim Entwickeln von Lösungsansätzen zur Verfügung? Als Untersuchungsgrundlage dieser Arbeit dienen jeweils ausgewählte Subtitel zum Themenkomplex „Gedichte“ der Lehrbücher „Deutsch vernetzt“ (roter Band: Literatur und Medien) und „Deutsch plus“ für die 9. Jahrgangsstufe.
Dabei konzentriert sich die vorliegende Arbeit im Wesentlichen auf eine vergleichende und exemplarische Analyse der Aufgabenstellung und versucht, in der Zusammenschau aller Erträge ein Muster aufzuzeigen, aus dem sich die Konzeption der Lehrbücher und daraus folgend der Umgang mit Lyrik ableiten lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Fachdidaktische Diskussion zum Umgang mit lyrischen Werken
- Zur Lehrwerkkonzeption in Deutsch vernetzt und Deutsch plus
- Thematische Sequenzierung
- Die Kapitelkonzeption
- Aufgabenanalyse
- Deutsch plus
- Einführungsseite
- Endlich erwachsen?
- Lebenswege
- ,,Du..." - Liebesgedichte
- Deutsch vernetzt
- Einführungsseite
- Fundstücke
- Erinnerte Orte
- Wenn man zurückkommt
- Auswertung der Ergebnisse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Lehrwerke „Deutsch vernetzt“ und „Deutsch plus“ für die 9. Jahrgangsstufe im Hinblick auf ihre Konzeption des Umgangs mit lyrischen Texten. Ziel ist es, zu untersuchen, wie diese Lehrwerke Schüler zu einem kompetenten Umgang mit Gedichten führen wollen. Dabei werden die didaktischen Ansätze der Lehrwerke, die Auswahl der Gedichte, die Aufgabenformate und die Lernziele im Detail betrachtet.
- Didaktische Ansätze im Lyrikunterricht
- Vergleichende Analyse der Lehrwerke „Deutsch vernetzt“ und „Deutsch plus“
- Analyse der Aufgabenformate und Lernziele
- Rezeption und Produktion von Gedichten im Unterricht
- Entwicklung von Kompetenzen im Umgang mit lyrischen Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Umgangs mit Gedichten im Deutschunterricht dar und skizziert die Ziele der Arbeit. Sie beleuchtet die Kritik an traditionellen Interpretationsmethoden und die Bedeutung neuerer Konzeptionen, die auf Verstehen und kreativen Umgang mit Gedichten setzen.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über die fachdidaktische Diskussion zum Umgang mit lyrischen Werken. Es werden verschiedene Ansätze und Methoden des Lyrikunterrichts vorgestellt, von der werkimmanenten Herangehensweise der 1960er Jahre bis hin zu neueren Konzeptionen, die auf handlungs- und produktionsorientierte Verfahren setzen.
Kapitel 3 analysiert die Lehrwerkkonzeptionen von „Deutsch vernetzt“ und „Deutsch plus“. Es werden die thematische Sequenzierung, die Kapitelkonzeption und die Aufgabenanalyse der beiden Lehrwerke im Detail betrachtet. Dabei wird der Fokus auf die Auswahl der Gedichte, die Aufgabenstellungen und die Lernziele gelegt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Umgang mit Gedichten im Deutschunterricht, die Lehrwerkanalyse, die Fachdidaktik Deutsch, die Konzeption von Lehrwerken, die Aufgabenanalyse, die Rezeption und Produktion von Gedichten, die Entwicklung von Kompetenzen im Umgang mit lyrischen Texten, die Vergleichende Analyse von Lehrwerken, die didaktischen Ansätze im Lyrikunterricht und die thematische Sequenzierung.
- Quote paper
- Anja Vitting (Author), 2009, Wie werden Schüler zum kompetenten Umgang mit Gedichten geführt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/126628