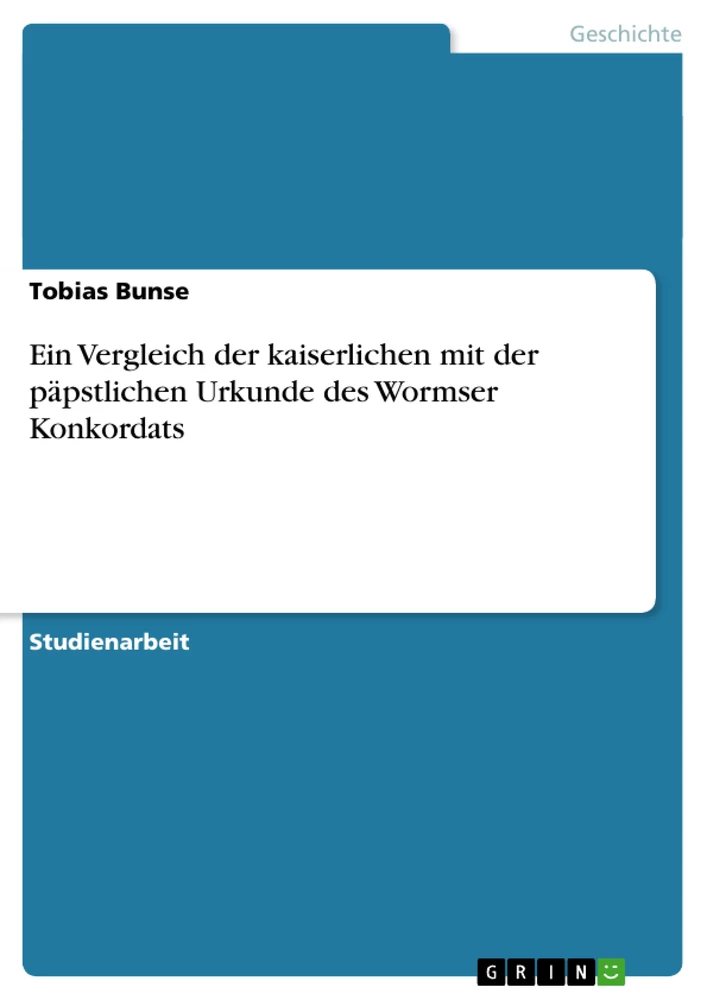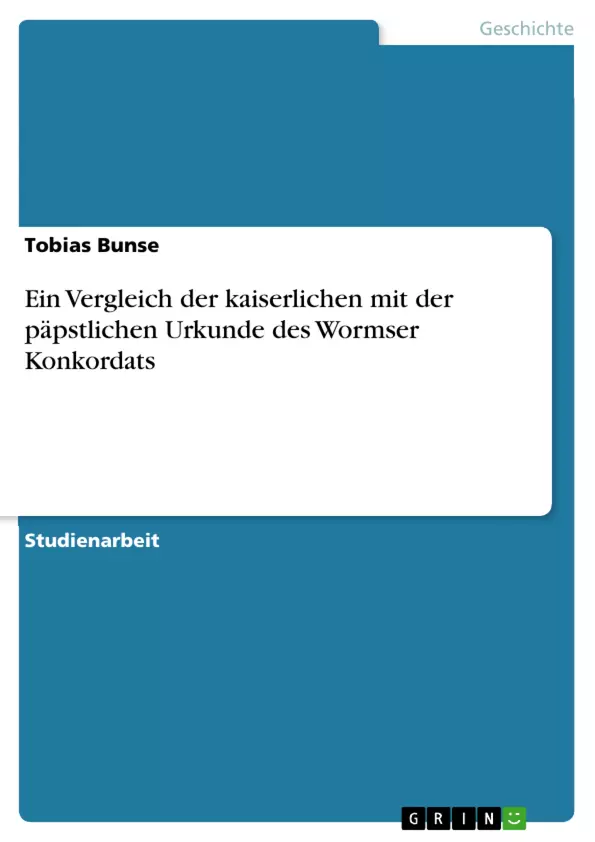Im 11. und 12. Jahrhundert erreichte der Streit zwischen Kirche und Staat einen neuen Höhepunkt. Mittelpunkt des Konfliktes war die Rolle der weltlichen Herrscher bei der Amteinsetzung von Bischöfen und Äbten, im Genauen bei der Überreichung von Ring und Stab an den geistlichen Würdenträger durch den weltlichen Herrscher. Diese so genannte Laieninvestitur stieß jedoch bei der Kirche innerhalb des 11. Jahrhunderts immer stärker auf Ablehnung. Die Geistlichkeit wollte das Investiturrecht für sich beanspruchen und somit den Einfluss des weltlichen Herrschers bei der Amtseinsetzung zurücktreiben. Eine entsprechende kirchliche Reformbewegung ging schließlich vom Kloster Cluny aus, die auf ein komplettes Laieninvestiturverbot drängte.
Das Wormser Konkordat, welches von Kaiser Heinrich IV. und Papst Gregor VII. unterzeichnet wurde, schuf nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat letztendlich einen Kompromiss. Das Konkordat sah vor, dass der Bischof im Deutschen Reich in der Gegenwart des Königs gewählt werden sollte. Darüber hinaus erhielt der Gewählte vom König durch das Zepter die Regalien, während der Papst ihm die geistliche Gewalt und als deren Zeichen Ring und Stab verlieh. Im Deutschen Reich fand die Investitur unmittelbar vor der Weihe statt, in Italien und Burgund innerhalb von sechs Monaten nach Auferlegung der Regalien.
Kernpunkt der vorliegenden Hausarbeit wird es sein, die Veränderungen für das König- bzw. Kaisertum sowie das Papsttum herauszuarbeiten, die das Wormser Konkordat nach sich zog. Dazu finden die Papst- und Kaiserurkunde besondere Beachtung, die zum Einen analysiert und zum Anderen einem Vergleich unterzogen werden sollen. Am Inhalt der beiden Urkunden lassen sich bereits viele Folgen für den Staat und die Kirche ableiten, die der Investiturstreit und das Konkordat mit sich brachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Wormser Konkordat
- 2.1 Entspannung der Auseinandersetzungen unter Heinrich V.
- 2.2 Inhalt des Wormser Konkordats
- 2.2.1 Die Kaiserliche Urkunde
- 2.2.2 Die Päpstliche Urkunde
- 2.3 Vergleich und Analyse der beiden Urkunden
- 3. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das Wormser Konkordat von 1122 als Kompromiss im Investiturstreit zwischen Kaiser Heinrich V. und Papst Calixt II. Die Arbeit zielt darauf ab, die Veränderungen für das Kaisertum und das Papsttum aufzuzeigen, die durch das Konkordat entstanden sind. Hierzu werden die kaiserliche und päpstliche Urkunde analysiert und verglichen.
- Der Investiturstreit und seine Ursachen
- Der Inhalt des Wormser Konkordats und seine Kompromisslösung
- Vergleich der kaiserlichen und päpstlichen Urkunden
- Folgen des Konkordats für Kaiser und Papst
- Die Rolle der Fürsten im Investiturstreit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in den Investiturstreit des 11. und 12. Jahrhunderts ein, der sich um die Laieninvestitur drehte – die Einsetzung von Bischöfen und Äbten durch weltliche Herrscher. Sie beschreibt die Ablehnung der Laieninvestitur durch die Kirche, die Reformbewegung von Cluny und das Streben nach einem vollständigen Verbot. Die Einleitung legt den Fokus auf das Wormser Konkordat als Kompromiss nach jahrzehntelangen Auseinandersetzungen und kündigt die Analyse der kaiserlichen und päpstlichen Urkunden an, um die Folgen des Konkordats für Staat und Kirche aufzuzeigen.
2. Das Wormser Konkordat: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklungen unter Heinrich V., der den Investiturstreit zunächst fortsetzte, aber letztendlich im Wormser Konkordat mit Papst Calixt II. einen Kompromiss fand. Der Abschnitt 2.1 beschreibt die anfängliche Harmonie zwischen Heinrich V. und den Fürsten und den weiteren Verlauf des Konflikts mit Papst Paschalis II. Abschnitt 2.2 analysiert den Inhalt des Konkordats, der die Wahl von Bischöfen in Gegenwart des Königs vorsah, mit dem König übergebenden Regalien und dem Papst verliehenen Ring und Stab. Abschnitt 2.3 fokussiert auf einen detaillierten Vergleich und eine Analyse der beiden Urkunden, um die jeweiligen Perspektiven von Kaiser und Papst sowie die weitreichenden Folgen des Kompromisses für beide Seiten zu beleuchten. Die Zusammenfassung des gesamten Kapitels verdeutlicht, wie das Konkordat eine, wenn auch fragile, Lösung für den langjährigen Konflikt bot und die Machtverhältnisse zwischen Kirche und Staat neu definierte.
Schlüsselwörter
Wormser Konkordat, Investiturstreit, Heinrich V., Calixt II., Laieninvestitur, Kaiser, Papst, Kirche, Staat, Regalien, Ring, Stab, Kompromiss, Urkundenvergleich, Reichsrechte, Fürsten.
Häufig gestellte Fragen zum Wormser Konkordat
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert das Wormser Konkordat von 1122 als Kompromiss im Investiturstreit zwischen Kaiser Heinrich V. und Papst Calixt II. Sie untersucht die Veränderungen für das Kaisertum und das Papsttum, die durch das Konkordat entstanden sind, durch Analyse und Vergleich der kaiserlichen und päpstlichen Urkunden.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Investiturstreit und seine Ursachen, den Inhalt des Wormser Konkordats und seine Kompromisslösung, einen Vergleich der kaiserlichen und päpstlichen Urkunden, die Folgen des Konkordats für Kaiser und Papst und die Rolle der Fürsten im Investiturstreit.
Welche Kapitel enthält die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über das Wormser Konkordat (unterteilt in Abschnitte zu den Entwicklungen unter Heinrich V., dem Inhalt des Konkordats und einem Vergleich der Urkunden) und einem Schluss.
Was ist der Fokus des Kapitels "Das Wormser Konkordat"?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklungen unter Heinrich V. und seinen Weg zum Kompromiss mit Papst Calixt II. Es analysiert den Inhalt des Konkordats, insbesondere die Wahl von Bischöfen und die Übergabe der Regalien, und vergleicht detailliert die kaiserliche und päpstliche Urkunde, um die Perspektiven beider Seiten und die Folgen des Kompromisses aufzuzeigen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in den Investiturstreit ein, beschreibt die Ablehnung der Laieninvestitur durch die Kirche und die Reformbewegung von Cluny. Sie hebt das Wormser Konkordat als Kompromiss hervor und kündigt die Analyse der Urkunden an.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Wormser Konkordat, Investiturstreit, Heinrich V., Calixt II., Laieninvestitur, Kaiser, Papst, Kirche, Staat, Regalien, Ring, Stab, Kompromiss, Urkundenvergleich, Reichsrechte, Fürsten.
Wie wird das Wormser Konkordat in der Hausarbeit dargestellt?
Das Wormser Konkordat wird als Kompromisslösung im langjährigen Investiturstreit dargestellt, die die Machtverhältnisse zwischen Kirche und Staat neu definierte, jedoch eine fragile Lösung darstellte.
Welche Quellen werden verwendet?
Die genaue Quellenangabe ist nicht im vorliegenden HTML-Ausschnitt enthalten.
- Quote paper
- Tobias Bunse (Author), 2007, Ein Vergleich der kaiserlichen mit der päpstlichen Urkunde des Wormser Konkordats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/130288