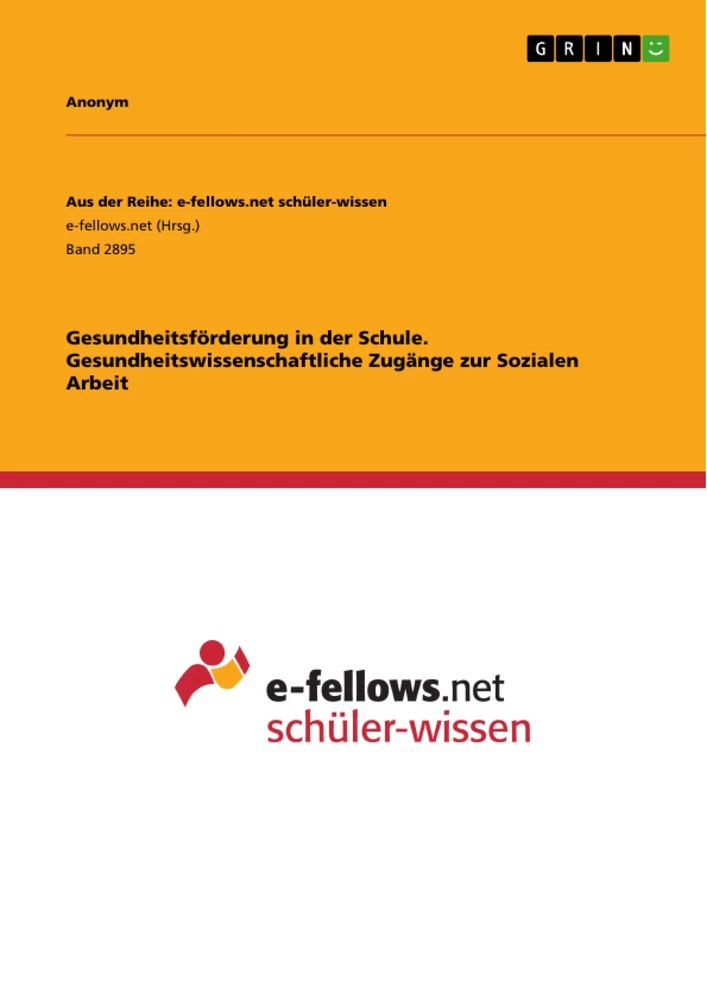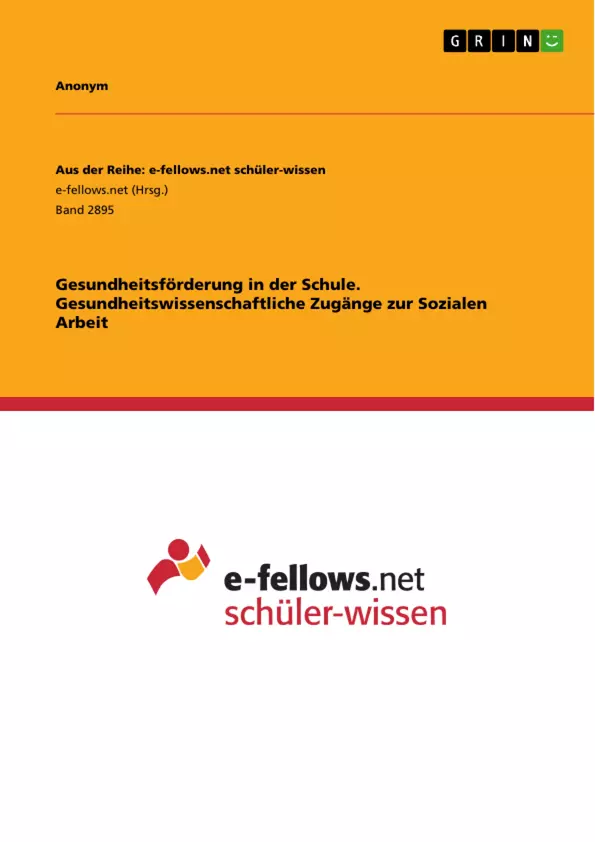Im ersten Abschnitt der Ausarbeitung wird der Begriff „Gesundheitsförderung“ genauer beschrieben. Hier wird auch deutlich welche Ziele sich aus diesem Begriff ergeben. Wie die Ziele erreicht werden können, wird im zweiten Abschnitt beschrieben. Dieser befasst sich mit dem Setting-Ansatz und führt einige Maßnahmen der Gesundheitsförderung im Setting Schule auf. Der dritte Abschnitt erläutert wie bedeutend soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen und Eltern sind und welche Auswirkungen diese haben können. Im letzten und vierten Abschnitt wird die Frage beantwortet, ob und wie psychische Grundbedürfnisse im Sportunterricht befriedigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition: Gesundheitsförderung
- Interventionskonzept: Setting-Ansatz (Setting Schule)
- Soziale Beziehungen
- Werden psychische Grundbedürfnisse im Sportunterricht befriedigt?
- Autonomie
- Kompetenz
- Soziale Zugehörigkeit, Anerkennung & Wertschätzung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept der Gesundheitsförderung im Kontext der Schule. Sie untersucht die Definition, die Ziele und die Umsetzungsmöglichkeiten von Gesundheitsförderung, insbesondere im Setting Schule. Darüber hinaus beleuchtet sie die Bedeutung sozialer Beziehungen für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Jugendlichen und die Frage, ob und wie psychische Grundbedürfnisse im Sportunterricht befriedigt werden.
- Definition und Ziele der Gesundheitsförderung
- Der Setting-Ansatz und die Gesundheitsförderung im Setting Schule
- Die Bedeutung sozialer Beziehungen für die Gesundheit und das Wohlbefinden
- Die Rolle des Sportunterrichts bei der Befriedigung psychischer Grundbedürfnisse
- Die Bedeutung der Zusammenarbeit von Schule und Familie für eine gelingende Gesundheitsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung bietet einen Überblick über die Themen und Inhalte der Ausarbeitung. Sie skizziert die zentralen Fragen und die Struktur der Arbeit.
Definition: Gesundheitsförderung
Dieses Kapitel erläutert den Begriff „Gesundheitsförderung“ anhand verschiedener Definitionen und stellt die Ziele der Gesundheitsförderung nach der WHO dar. Es wird hervorgehoben, dass die Gesundheitsförderung nicht nur auf Krankheitsvermeidung zielt, sondern auch auf die Stärkung der Ressourcen und Fähigkeiten von Menschen, ihre Gesundheit selbst zu gestalten. Das Konzept der Gesundheitsförderung zielt darauf ab, gesunde Lebensjahre zu erhöhen, chronische Erkrankungen zu reduzieren und sozial begründete Ungleichheiten von Gesundheitschancen zu verringern.
Interventionskonzept: Setting-Ansatz (Setting Schule)
Dieses Kapitel beschreibt den Setting-Ansatz als ein Konzept der Gesundheitsförderung, das sich darauf konzentriert, gesunde Lebenswelten zu gestalten. Der Setting-Ansatz wird am Beispiel des Settings Schule erläutert, wobei die Bedeutung der Gesundheitsförderung in der Schule und die verschiedenen Programme und Maßnahmen, die zur Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beitragen, vorgestellt werden. Die Arbeit beleuchtet auch die Bedeutung der Zusammenarbeit von Schule und Familie, um die Ziele der Gesundheitsförderung zu erreichen.
Soziale Beziehungen
Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung sozialer Beziehungen für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Jugendlichen, insbesondere in der Pubertät. Es werden die Veränderungen in den Beziehungen zu Eltern und Gleichaltrigen in dieser Lebensphase beleuchtet und die wichtige Rolle der sozialen Unterstützung durch Freunde für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben betont.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Gesundheitsförderung, Setting-Ansatz, Setting Schule, soziale Beziehungen, psychische Grundbedürfnisse, Sportunterricht, soziale Eingebundenheit, Entwicklungsaufgaben, Wohlbefinden, Prävention, Gesundheitsressourcen, Lebensbewältigung, gesunde Lebensjahre.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Gesundheitsförderung in der Schule?
Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Ressourcen und Fähigkeiten von Schülern zu stärken, um ihre Gesundheit selbst zu gestalten, statt nur Krankheiten zu vermeiden.
Was ist der Setting-Ansatz?
Der Setting-Ansatz konzentriert sich darauf, Lebenswelten (wie die Schule) so zu gestalten, dass sie gesundheitsförderlich wirken und gesundes Verhalten erleichtern.
Welche Rolle spielt der Sportunterricht für die Psyche?
Der Sportunterricht kann psychische Grundbedürfnisse wie Autonomie, Kompetenzerleben und soziale Zugehörigkeit befriedigen, was das allgemeine Wohlbefinden steigert.
Wie wichtig sind soziale Beziehungen für Jugendliche?
Besonders in der Pubertät sind Beziehungen zu Gleichaltrigen und Eltern entscheidend für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und die psychische Stabilität.
Was sind die Ziele der WHO für Gesundheitsförderung?
Die Ziele umfassen die Erhöhung gesunder Lebensjahre, die Reduzierung chronischer Erkrankungen und den Abbau sozial bedingter Ungleichheit bei Gesundheitschancen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Gesundheitsförderung in der Schule. Gesundheitswissenschaftliche Zugänge zur Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1306258