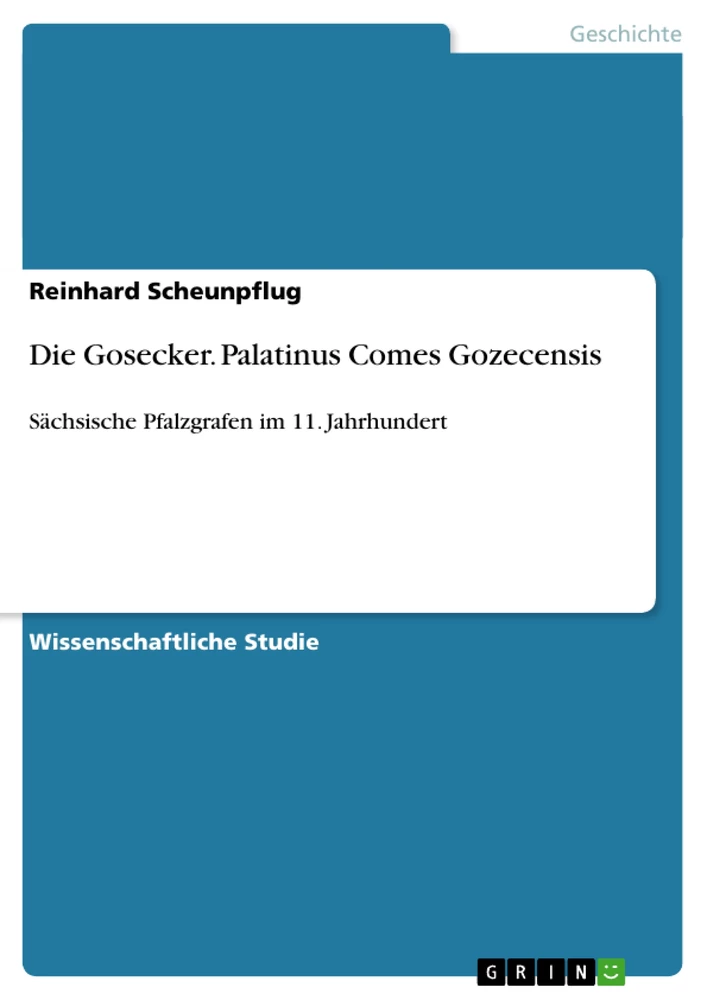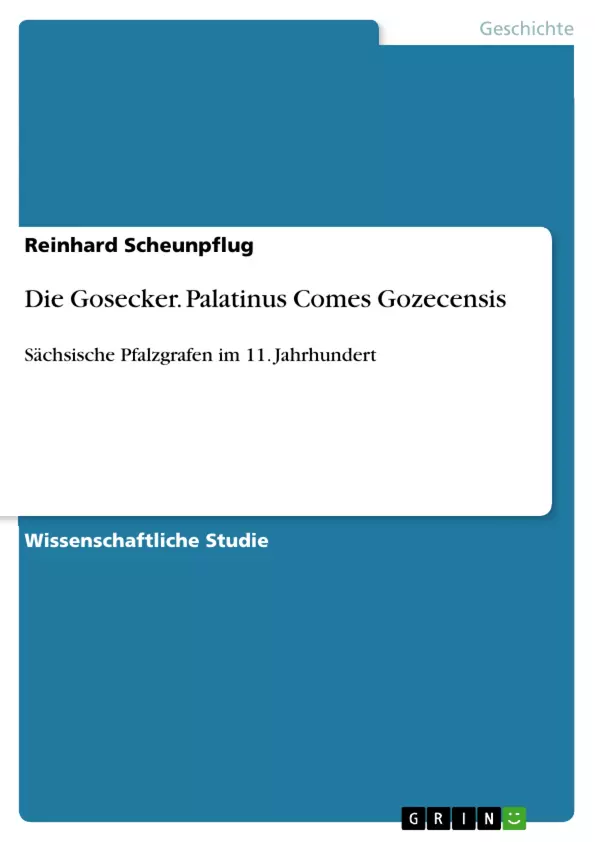Zwischen dem ausgehenden 10. und dem beginnenden 13. Jahrhundert gehörten die GOSECKER – als unmittelbare Verwandte der WETTINER und Inhaber der sächsischen Pfalzgrafenwürde zu den bedeutendsten und wohl auch einflussreichsten Adelsgeschlechtern in Deutschland.
Ihre verwandtschaftlichen Beziehungen waren so weitverzweigt, wie man sich solche überhaupt nur vorstellen kann.
Kaiser- und Königshäuser waren neben nahezu allen großen Dynastien des Mittelalters mit ihnen versippt und verschwägert.
Mit logischer Konsequenz existierten direkte familiäre Beziehungen auch zu Fürstenhäusern der unmittelbaren östlichen und südöstlichen Nachbarvölker in Polen, Böhmen, Mähren, Ungarn und im Kiewer Raum.
Aber auch die Königshäuser in Dänemark/Schweden, in England, Frankreich und Spanien (Kastilien) sind durch vielfältige Verbindungen in das Verwandtschaftsgeflecht eingewoben.
In allen deutschen Stammherzogtümern gab es damals Verwandte der GOSECKER, die ja selbst mehrfach in direkter Linie mit Karl dem Großen verwandt waren. Selbst familiäre Beziehungen zum griechisch-byzantinischen Kaiserhaus sind bekannt.
Äbte und Äbtissinnen, Bischöfe, Erzbischöfe und Patriarchen hatten „GOSECKER Blut“ in ihren Adern.
Der umfangreiche Anhang der Studie stellt den Versuch dar, genealogische Linien bis zu acht Generationen - einschließlich der Ehepartner und ggf. deren Eltern - vom "Stammvater" der GOSECKER, dem Grafen im Lies- und Hassegau Burchard (Burkhard)
(946/51 - 13. Juli 982), zu präsentieren.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Geleit
- Die erste Burg
- Die zweite Burg und die Gründung des Klosters
- Die Weißenburg
- Der Hassegau
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Familie Gosecker im 11. Jahrhundert und deren Bedeutung im sächsischen Raum. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Burgen Goseck und Weißenburg, sowie deren Rolle als Grenzfeste und später als Klöster. Die Arbeit analysiert die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit und beleuchtet die Beziehungen der Gosecker zu anderen bedeutenden Familien und Institutionen.
- Die Geschichte der Burgen Goseck und Weißenburg
- Die Umwandlung der Burgen in Benediktinerklöster
- Die Rolle der Gosecker im sächsischen Raum
- Die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 11. Jahrhunderts
- Die Beziehungen der Gosecker zu anderen Adelsfamilien und dem Klerus
Zusammenfassung der Kapitel
Zum Geleit: Dieser einleitende Abschnitt beschreibt die geographische Lage von Schloss Goseck und erwähnt seine frühe Erwähnung in den Hersfelder Zehntverzeichnissen des 9. Jahrhunderts. Er skizziert die unterschiedlichen Theorien zur Entstehung der Burg, unter anderem die These von Karl dem Großen als Erbauer einer Grenzsicherung gegen slawische Einfälle, und verweist auf die Ausmaße der ursprünglichen Anlage.
Die erste Burg: Das Kapitel beschreibt die mutmaßliche Lage der ersten Burg Goseck, möglicherweise auf den Fundamenten einer slawischen Befestigung. Es wird spekuliert über die Nutzung einer dortigen Quelle als Wasserreservoir und verweist auf Fundamente aus Sandsteinquadern, die erst im späten 18. Jahrhundert beim Bau von Weinbergterrassen verwendet wurden. Die Erwähnung eines Manuskripts aus dem 16. Jahrhundert, welches von einem "Kloster Bonzig" spricht, deutet auf eine frühe Besiedlung der Region hin.
Die zweite Burg und die Gründung des Klosters: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die zweite, "neue" Burg Gossigk und deren Umwandlung in eine Benediktinerabtei zwischen 1041 und 1053 durch die Geschwister Dedo, Adalbert, Friedrich und Oda aus dem Hause Goseck. Die detaillierte Beschreibung der Fundationssurkunde von 1053 beleuchtet die Stiftung des Klosters an die heilige Maria und den heiligen Michael, die Unterwerfung unter das Stift Bremen, die Regelung der Abtswahl und die großzügigen Landübertragungen durch Erzbischof Adelbert. Die Liste der Zeugen unterstreicht die Bedeutung des Ereignisses und die Vernetzung der Gosecker mit wichtigen Persönlichkeiten der Zeit.
Die Weißenburg: Dieses Kapitel beschreibt die Weißenburg (Wiscinburg) bei Zscheiplitz als Stammsitz der Gosecker nach der Gründung des Klosters Goseck. Die Weißenburg, zunächst als Grenzfestung des Hassegaues genutzt, wird 979 in einer Urkunde erwähnt. Der Abschnitt beschreibt die spätere Umwandlung der Weißenburg in ein Benediktinerkloster im Jahr 1089.
Der Hassegau: Das Kapitel erläutert die geographische Lage und die historische Bedeutung des thüringischen Hassegaues. Es beschreibt den Namen und seine Herkunft von der „Hohenseeburg“, klärt seine Zugehörigkeit zum sächsischen Einflussbereich und erläutert die Bedeutung des Begriffes „Gau“ in der mittelalterlichen Verwaltung. Der Abschnitt betont den Gau als Landschaftsbezeichnung und seine allmähliche Entwicklung zu einem politischen Verwaltungsgebiet im fränkischen Reich.
Schlüsselwörter
Gosecker, Schloss Goseck, Weißenburg, Benediktinerkloster, Hassegau, Sachsen, Pfalzgrafen, mittelalterliche Geschichte, Grenzburg, Fundationssurkunde, Adelsfamilie, Slaweneinfälle, Karl der Große.
Häufig gestellte Fragen zur Geschichte der Familie Goseck im 11. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Familie Goseck im 11. Jahrhundert und ihrer Bedeutung im sächsischen Raum. Der Fokus liegt auf den Burgen Goseck und Weißenburg, ihrer Rolle als Grenzfeste und ihrer späteren Umwandlung in Klöster. Analysiert werden die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit und die Beziehungen der Gosecker zu anderen wichtigen Familien und Institutionen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Geschichte der Burgen Goseck und Weißenburg, ihre Umwandlung in Benediktinerklöster, die Rolle der Gosecker im sächsischen Raum, die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 11. Jahrhunderts sowie die Beziehungen der Gosecker zu anderen Adelsfamilien und dem Klerus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel "Zum Geleit", "Die erste Burg", "Die zweite Burg und die Gründung des Klosters", "Die Weißenburg" und "Der Hassegau".
Was ist der Inhalt des Kapitels "Zum Geleit"?
Das Kapitel "Zum Geleit" beschreibt die geographische Lage von Schloss Goseck, seine frühe Erwähnung in den Hersfelder Zehntverzeichnissen, verschiedene Theorien zu seiner Entstehung (u.a. die These von Karl dem Großen) und die Ausmaße der ursprünglichen Anlage.
Was wird im Kapitel "Die erste Burg" behandelt?
Das Kapitel "Die erste Burg" beschreibt die mutmaßliche Lage der ersten Burg Goseck, möglicherweise auf slawischen Fundamenten, spekuliert über die Nutzung einer Quelle als Wasserreservoir und erwähnt Fundamente aus Sandsteinquadern, die erst später verwendet wurden. Ein Manuskript aus dem 16. Jahrhundert, welches von einem "Kloster Bonzig" spricht, deutet auf frühe Besiedlung hin.
Worüber informiert das Kapitel "Die zweite Burg und die Gründung des Klosters"?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die zweite Burg Gossigk und ihre Umwandlung in eine Benediktinerabtei zwischen 1041 und 1053 durch die Geschwister Dedo, Adalbert, Friedrich und Oda. Es beschreibt detailliert die Fundationssurkunde von 1053, die Stiftung des Klosters, die Unterwerfung unter das Stift Bremen, die Abtswahl und die Landübertragungen. Die Zeugenliste unterstreicht die Bedeutung des Ereignisses und die Vernetzung der Gosecker.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Die Weißenburg"?
Das Kapitel "Die Weißenburg" beschreibt die Weißenburg (Wiscinburg) bei Zscheiplitz als Stammsitz der Gosecker nach der Gründung des Klosters Goseck. Es beschreibt ihre Nutzung als Grenzfestung des Hassegaues (Erwähnung 979) und ihre spätere Umwandlung in ein Benediktinerkloster im Jahr 1089.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Der Hassegau"?
Das Kapitel "Der Hassegau" erläutert die geographische Lage und die historische Bedeutung des thüringischen Hassegaues, seinen Namen und seine Herkunft, seine Zugehörigkeit zum sächsischen Einflussbereich und die Bedeutung des Begriffes "Gau" in der mittelalterlichen Verwaltung. Es betont den Gau als Landschaftsbezeichnung und seine Entwicklung zu einem politischen Verwaltungsgebiet.
Welche Schlüsselwörter sind für diese Arbeit relevant?
Schlüsselwörter sind Gosecker, Schloss Goseck, Weißenburg, Benediktinerkloster, Hassegau, Sachsen, Pfalzgrafen, mittelalterliche Geschichte, Grenzburg, Fundationssurkunde, Adelsfamilie, Slaweneinfälle und Karl der Große.
- Citation du texte
- Dr. Reinhard Scheunpflug (Auteur), 2009, Die Gosecker. Palatinus Comes Gozecensis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/144126