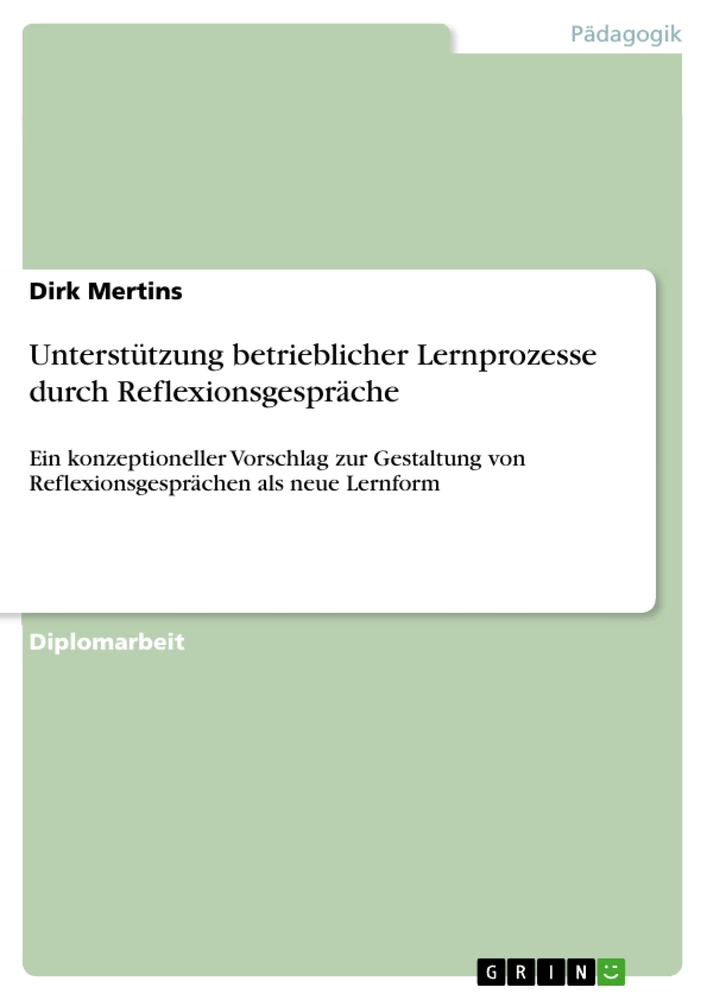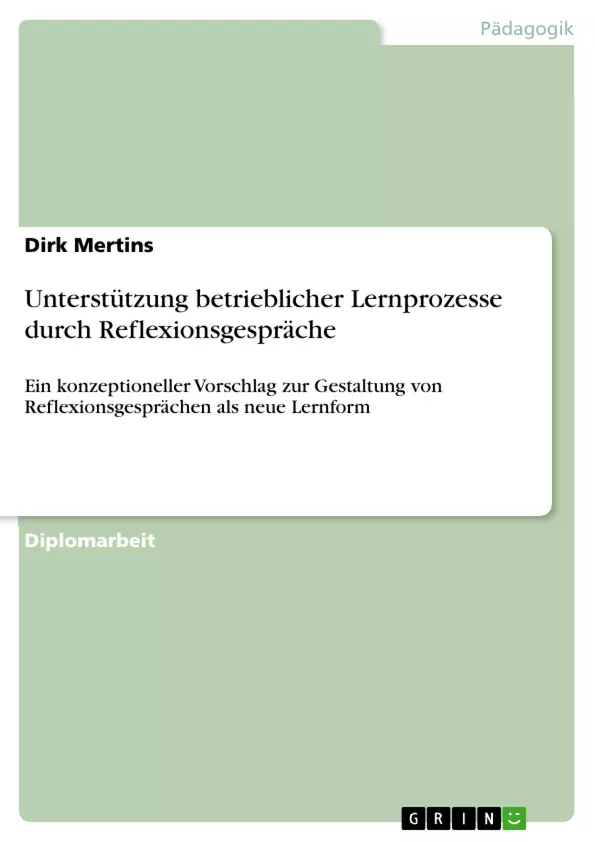Eine Aufgabe der Berufs- und Betriebspädagogik ist das theoriegeleitete und empirisch gestützte Entwickeln betrieblicher und überbetrieblicher Qualifizierungskonzepte. Insbesondere die stark veränderten Anforderungen an Beschäftigte und Betriebe stellen eine große Herausforderung dar. Mit dem Wandel der
Industriegesellschaft zu einer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft findet eine verstärkte Abkehr von tayloristischen Prinzipien statt, Konsequenz sind eine erhöhte Flexibilisierung des Arbeitsumfeldes,
Enthierarchisierung sowie Deregulierung beruflicher Tätigkeiten
die ein schnelles Anpassen der Beteiligten an neue Gegebenheiten erfordert. Aus ökonomischer Sicht stehen dabei die Verbesserung und Optimierung von Arbeitsstrukturen und Arbeitsergebnissen mit dem Ziel einer gesteigerten Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund (vgl. Dehnbostel 2001, S.54). Mitarbeiter müssen in der Lage sein, selbstorganisiert wie auch selbstgesteuert zu arbeiten und zu lernen. Insbesondere vor dem Hintergrund der abnehmenden Halbwertszeit einmal erworbenen Wissens gewinnt die Fähigkeit, sich selbständig im Rahmen des lebenslangen Lernens neues Wissen zu erschließen, stetig an Bedeutung.
Qualifizierungskonzepte, die das zielgerichtete Lernen im Prozess der Arbeit ermöglichen, sind zumeist durch informelle Lernprozesse, also Lernen durch Erfahrung, geprägt. Im Rahmen des informellen Lernens hat sich besonders die Reflexion als Schlüsselelement für das bewusste Lernen für Erfahrung herausgestellt. Dementsprechend besteht insbesondere ein Bedarf an der Entwicklung von Qualifizierungskonzepten und Lernformen, die die Entwicklung reflexiver Handlungsfähigkeit ermöglicht. Der Lernende soll in die Lage versetzt werden, nicht nur kompetent die Anforderungen von Arbeit und Gesellschaft zu bewältigen, sondern über sich und seine Umgebung zu reflektieren und so Veränderungen mitzugestalten. Reflexion als Schlüsselelement des Erfahrungslernens soll im Folgenden in seiner Bedeutung für beruflich-betriebliche Lernen untersucht werden. Weiterhin wird das Reflexionsgespräch als unterstützende Lernform betrachtet und konzeptionelle Handlungsempfehlungen für den Einsatz dieser Lernform werden herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- REFLEXION UND BETRIEBLICHES LERNEN
- Reflexion: Definition und theoretische Modelle
- Reflexion im wissenschaftlichen Diskurs
- Reflexion im Kontext von Lernprozessen
- Zusammenfassung und Arbeitsdefinition
- Reflexion in betrieblichen Lernprozessen
- Erfahrungslernen durch Reflexion
- Reflexive Handlungsfähigkeit als Ziel beruflich-betrieblicher Bildung
- Reflexion: Definition und theoretische Modelle
- REFLEXIONSGESPRÄCHE ZUR UNTERSTÜTZUNG BETRIEBLICHEN ERFAHRUNGSLERNENS
- Charakteristika eines Reflexionsgesprächs
- Sprache zur Förderung von Reflexion
- Die intrakommunikative Funktion der Sprache
- Ericssons und Simons Modell der Verbalisierung
- Reflexion impliziten Wissens durch Explikation
- Effekte der Verbalisierung für Lern- und Reflexionsprozesse
- Förderung von Reflexion in Gesprächen
- Die Bedeutung eines Gesprächspartners
- Der Einfluss von W-Fragen
- Der Einfluss von Feedback
- Einschränkende Faktoren von Reflexionsgesprächen
- Das Reflexionsgespräch als Methode zur Unterstützung des Erfahrungslernens
- REFLEXIONSGESPRÄCHE IN DER ARBEITSPROZESS-ORIENTIERTEN IT-WEITERBILDUNG
- Die arbeitsprozessorientierte Weiterbildung als konzeptioneller Rahmen für das Reflexionsgespräch
- Das IT-Weiterbildungssystem
- Das Konzept der arbeitsprozessorientierten Weiterbildung
- Lernprozessbegleitung als zentrales Element des APO-Konzepts
- Konzeption des Reflexionsgesprächs in der arbeitsprozessorientierten IT-Weiterbildung
- Die Anwendung des Reflexionsgesprächs in der arbeitsprozessorientierten Weiterbildung am Beispiel des Projekts ITAQU
- Das Projekt ITAQU
- Durchführung der Untersuchung
- Das Reflexionsgespräch im Projekt ITAQU
- Abschließende Betrachtung des Reflexionsgesprächs in der arbeitsprozessorientierten Weiterbildung
- Die arbeitsprozessorientierte Weiterbildung als konzeptioneller Rahmen für das Reflexionsgespräch
- KONZEPTIONELLER VORSCHLAG FÜR DIE GESTALTUNG VON REFLEXIONSGESPRÄCHEN ALS NEUE LERNFORM
- Reflexionsgespräche als Lernform
- Der Coach
- Die Rolle des Coachs
- Kompetenzen des Coachs
- Phasen und Ablauf
- Phasen der Lernform Reflexionsgespräch
- Die Gestaltung von Reflexionsgesprächen
- Sicherung von Reflexionsergebnissen
- Rahmenbedingungen des Reflexionsgesprächs
- ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
- LITERATURVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- ANHANG
- Abschließender Teilnehmerfragebogen (Auszug)
- Auszug Interviewleitfaden zur abschließenden Befragung der Teilnehmer 1.Durchgang im Projekt ITAQU
- Screenshot Codesystem `Reflexionsgespräche´ in MaxQDA
- Leitfaden Reflexionsgespräch im Projekt ITAQU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines konzeptionellen Vorschlags zur Gestaltung von Reflexionsgesprächen als neue Lernform im Kontext der betrieblichen Weiterbildung. Ziel ist es, die Bedeutung von Reflexion für das betriebliche Lernen aufzuzeigen und die Reflexionsgespräche als Methode zur Unterstützung des Erfahrungslernens zu etablieren.
- Reflexion als zentrale Komponente des betrieblichen Lernens
- Reflexionsgespräche als Methode zur Förderung von Erfahrungslernen
- Konzeptionelle Gestaltung von Reflexionsgesprächen als Lernform
- Anwendung des Reflexionsgesprächs in der arbeitsprozessorientierten IT-Weiterbildung
- Empirische Untersuchung des Reflexionsgesprächs im Projekt ITAQU
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas im Kontext der sich wandelnden Arbeitswelt dar und führt in die Thematik der Reflexion und des betrieblichen Lernens ein. Kapitel 2 beleuchtet die Bedeutung von Reflexion für Lernprozesse und die Entwicklung von reflexiver Handlungsfähigkeit. Es werden verschiedene theoretische Modelle der Reflexion vorgestellt und die Rolle der Reflexion im Kontext von Erfahrungslernen und beruflich-betrieblicher Bildung diskutiert. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Charakteristika von Reflexionsgesprächen und den Faktoren, die die Förderung von Reflexion in Gesprächen beeinflussen. Hierbei werden die Bedeutung eines Gesprächspartners, der Einfluss von W-Fragen und Feedback sowie einschränkende Faktoren von Reflexionsgesprächen betrachtet. Kapitel 4 untersucht die Anwendung von Reflexionsgesprächen in der arbeitsprozessorientierten IT-Weiterbildung. Es wird das Konzept der arbeitsprozessorientierten Weiterbildung vorgestellt und die Integration von Reflexionsgesprächen in dieses Konzept diskutiert. Am Beispiel des Projekts ITAQU wird die Durchführung und die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung des Reflexionsgesprächs in der Praxis dargestellt. Kapitel 5 präsentiert einen konzeptionellen Vorschlag für die Gestaltung von Reflexionsgesprächen als neue Lernform. Es werden die Rolle des Coachs, die Phasen und der Ablauf von Reflexionsgesprächen sowie die Sicherung von Reflexionsergebnissen und die Rahmenbedingungen des Reflexionsgesprächs beschrieben. Die Zusammenfassung und der Ausblick fassen die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und geben einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Reflexion, betriebliches Lernen, Erfahrungslernen, Reflexionsgespräche, arbeitsprozessorientierte Weiterbildung, IT-Weiterbildung, Coaching, Kompetenzentwicklung, Handlungsfähigkeit, Projekt ITAQU.
- Citation du texte
- Dirk Mertins (Auteur), 2005, Unterstützung betrieblicher Lernprozesse durch Reflexionsgespräche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/148813