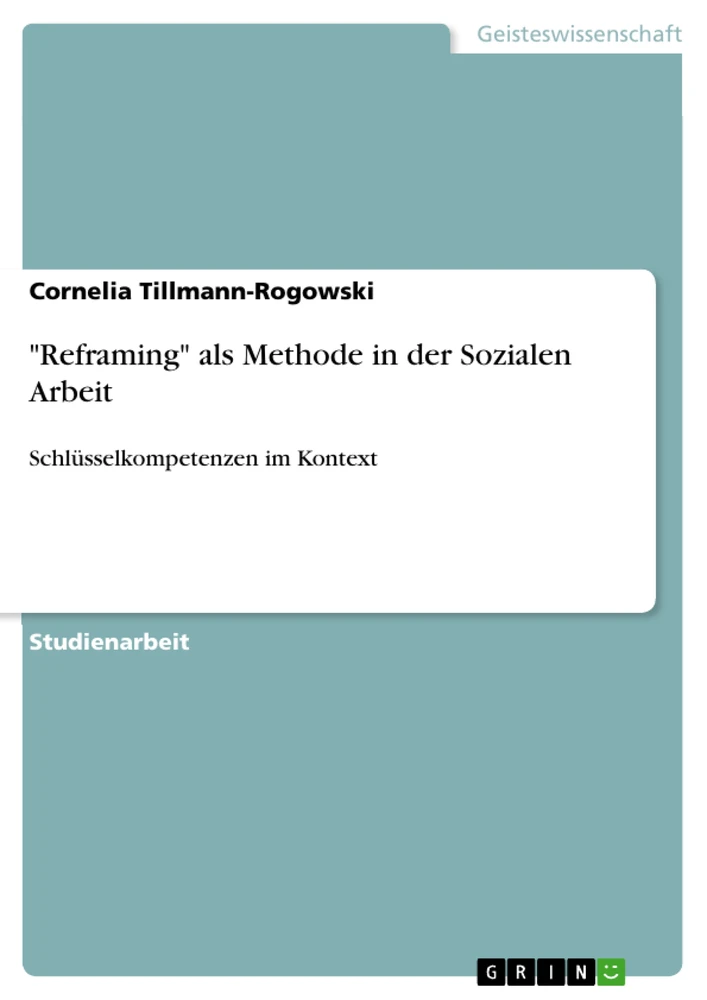Reframings helfen, hinter das Verhalten zu schauen. Ebenso können
sie Informationen bringen und ermöglichen einen Perspektivenwechsel.
"Reframing" als Methode in der Sozialen Arbeit beschreibt neben den Grundannahmen, Haltungen und Wirkungen auch die methodischen Grundlagen des Reframings. Dargestellt werden die Grundzüge des "Six - Step - Reframings" aus der Arbeit des NLP, das Kontext- oder auch Verhaltensreframing sowie das Bedeutungsreframing.
Desweiteren werden die Ziele aufgeführt, die Bedeutung des Reframings für die praktische Arbeit aufgezeigt und somit der Bezug zur Praxis (bzw. zu den Schlüsselkompetenzen) hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Reframing - Definition
- 2. Grundannahmen, Haltungen und Wirkungen
- 3. Methodische Grundlagen des Reframings
- 3.1 Grundzüge des „Six – Step – Reframings“ aus der Arbeit des NLP
- 3.2 Kontext- oder auch Verhaltensreframing
- 3.3 Bedeutungsreframing
- 4. Ziele
- 5. Bedeutung des Reframings für die praktische Arbeit
- 5.1 Methodische Kompetenz
- 5.2 Sozialkommunikative Kompetenz
- 5.3 Persönliche Kompetenz
- 6. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit dem Thema "Reframing" und zeigt anhand dieser Methode exemplarisch auf, wie essenziell Schlüsselkompetenzen für die Soziale Arbeit sind.
- Definition und Grundannahmen von Reframing
- Methodische Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten von Reframing
- Bedeutung von Reframing für die praktische Arbeit in der Sozialen Arbeit
- Zusammenhang von Reframing und Schlüsselkompetenzen
- Ziele und Wirkungen von Reframing in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Reframing für die Soziale Arbeit dar und erläutert den Fokus der Hausarbeit.
- 1. Reframing - Definition: Dieses Kapitel definiert den Begriff Reframing und erläutert seine systemischen und neurolinguistischen Wurzeln. Es werden außerdem die Grundprinzipien und die Entstehung des Reframing-Ansatzes beleuchtet.
- 2. Grundannahmen, Haltungen und Wirkungen: In diesem Kapitel werden die Grundannahmen des Reframings hinsichtlich Verhalten, Kontext und Absicht dargestellt. Es werden außerdem die Auswirkungen von Reframing auf die Handlungs- und Denkweise des Betroffenen beleuchtet.
- 3. Methodische Grundlagen des Reframings: Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen methodischen Ansätze und Techniken des Reframings, insbesondere das "Six – Step – Reframing" aus dem Bereich des NLP. Weitere Methoden, wie Kontext- und Bedeutungsreframing, werden vorgestellt und erläutert.
- 4. Ziele: Dieses Kapitel beleuchtet die konkreten Ziele des Reframings, die durch die Anwendung der Methode erreicht werden sollen. Es werden die gewünschten Veränderungen und Verbesserungen im Verhalten und in der Wahrnehmung des Betroffenen aufgezeigt.
- 5. Bedeutung des Reframings für die praktische Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit der Relevanz des Reframings für die Praxis der Sozialen Arbeit. Es werden insbesondere die Auswirkungen auf die methodische Kompetenz, die sozialkommunikative Kompetenz und die persönliche Kompetenz des Sozialarbeiters beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Hausarbeit sind Reframing, Schlüsselkompetenzen, Soziale Arbeit, systemisches Denken, NLP, Kontext, Verhalten, Absicht, Ressourcen, Perspektivenwechsel, Lösungsorientierung.
- Citar trabajo
- Cornelia Tillmann-Rogowski (Autor), 2009, "Reframing" als Methode in der Sozialen Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152457