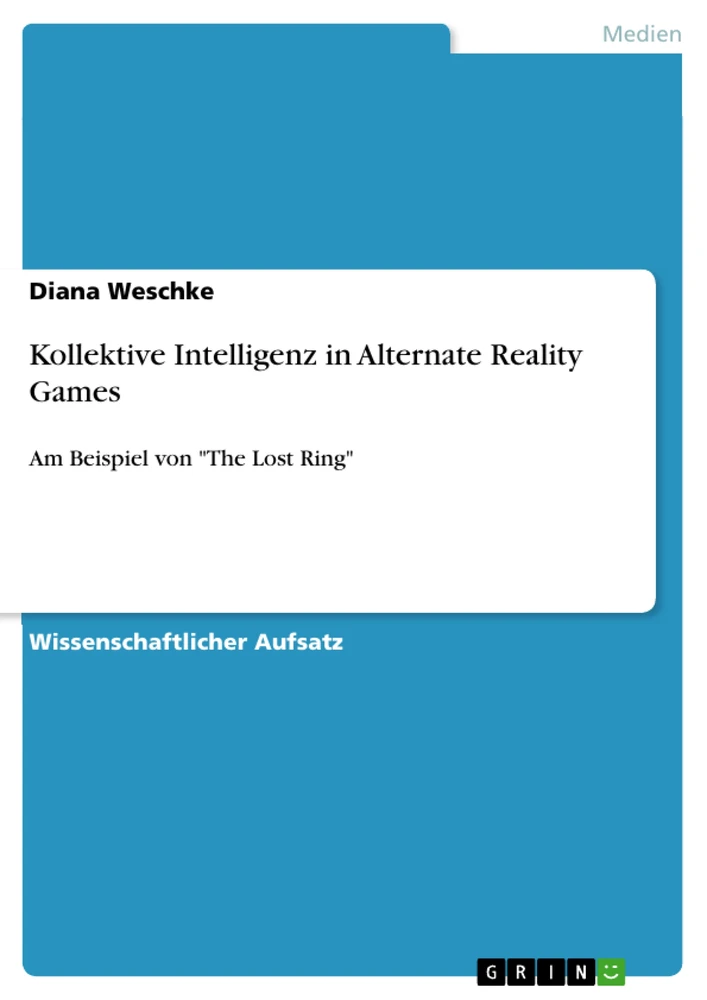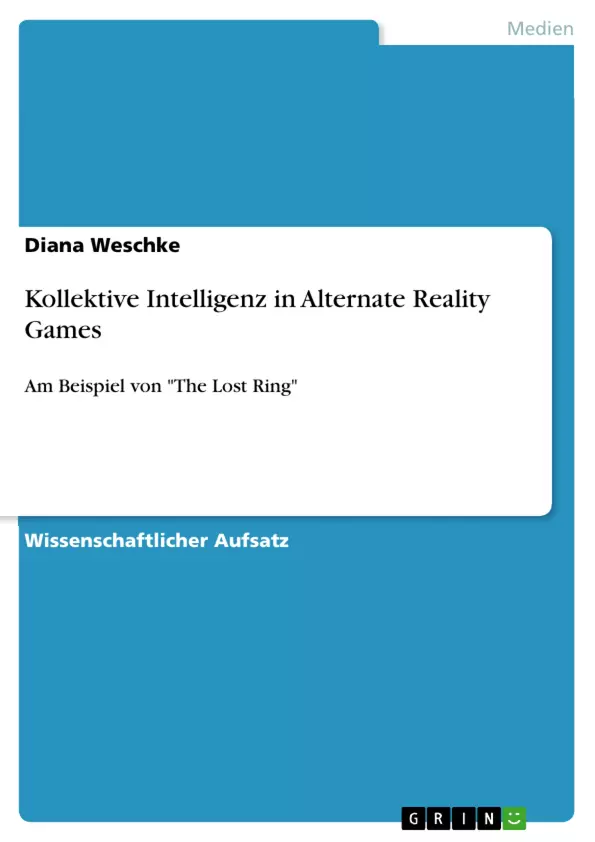Eine aufschlussreiche Erklärung dieses Genres bieten Adam Martin und Tom Chatfield in einem ARG Whitepaper: „Alternate Reality Games take the substance of everyday life and weave it into narratives that layer additional meaning, depth, and interaction upon the real world. The contents of these narratives constantly intersect with actuality, but play fast and loose with fact, sometimes departing entirely from the actual or grossly warping it - yet remain inescapably interwoven. Twenty-four hours a day, seven days a week, everyone in the country can access these narratives through every available medium - at home, in the office, on the phones; in words, in images, in sound.”1
1 International Game Developers Association (2006): Alternate Reality Games White Paper, S.6.
Allerdings ist gerade durch die besondere Bedeutung des Internets bei ARGs die Behauptung „everyone in the county can access“ nicht ganz korrekt, da es eigentlich „everyone in the world“ heißen müsste, insofern die Person Zugriff auf derartige Medienapplikationen besitzt.
Als Beispiel- und Forschungsobjekt dient „The Lost Ring“ - ein ARG aus dem Jahr 2008, welches eine anonyme Marketingkampagne für McDonalds war und sich mit der Thematik der Olympischen Spiele befasste. An ihm nahmen cirka 5000 aktive Spieler aus über 100 verschiedenen Ländern teil, welche acht Sprachen zur Verständigung Bei tausenden von Mitspielern muss also ein Organisationspirinzip geschaffen werden, welches jedes Einzelpotential effektiv einbindet und nutzt. Erstaunlicherweise gibt es bei ARGs jedoch keinen alleinbestimmenden Spielleiter, sondern nur PM, die lenken und helfen, jedoch ebenso durch die Spieleraktionen bestimmt werden. Folgernd kann man behaupten, dass die Spieler von ARGs sich eigenständig zu einer kollektiven Intelligenz verbinden und die Merkmale von Schwarmverhalten aufzeigen. Auf den nächsten Seiten soll untersucht werden inwieweit diese These zutrifft und welche Abgrenzungen es von Schwärmen und Smart Mobs zu ziehen gilt.
2 Dena, Christy (2008): Emerging Participatory Culture Practices, S. 42. 3 ebd. S.42.
3
nutzten.
In dieser Betrachtung zu kollektiver Intelligenz in ARGs dominiert die Definition des französischen Philosophen Pierre Lévy, welcher diesen Begriff schon 1994 Durch die Globalität und Komplexität dieses Spiels ist hervorragend für den Nachweis von kollektiver und Schwarmintelligenz geeignet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kollektive Intelligenz
- Definitionen
- Grenzen zur Schwarmintelligenz
- Ausprägungen im Cyberspace
- The Lost Ring
- Einführung in das Spiel
- Anwendung kollektiver Intelligenz
- Koordination
- Kooperation im virtuellen Raum
- Kooperation im realen Gelände
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der kollektiven Intelligenz am Beispiel von „The Lost Ring“, einem Alternate Reality Game (ARG) aus dem Jahr 2008. Ziel ist es, die Interaktion von Spielern und Puppetmasters im Kontext eines ARGs zu analysieren und die Rolle der kollektiven Intelligenz in diesem Prozess zu beleuchten.
- Definition und Abgrenzung der kollektiven Intelligenz
- Der transmediale Charakter von ARGs
- Die Anwendung kollektiver Intelligenz in „The Lost Ring“
- Die Organisation und Koordination von Spielern in einem ARG
- Der Einfluss von Spielern und Puppetmasters auf den Spielverlauf
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Genre der Alternate Reality Games vor und führt den Leser in das Thema der kollektiven Intelligenz ein. Sie erklärt die Funktionsweise von ARGs und stellt das Beispiel „The Lost Ring“ vor.
- Kollektive Intelligenz: Dieses Kapitel definiert den Begriff der kollektiven Intelligenz und grenzt ihn von der Schwarmintelligenz ab. Es betrachtet die Ausprägungen der kollektiven Intelligenz im Cyberspace.
- The Lost Ring: Dieses Kapitel gibt eine Einführung in das ARG „The Lost Ring“ und erläutert die Anwendung kollektiver Intelligenz im Spiel. Es analysiert die Koordination und Kooperation der Spieler im virtuellen und realen Raum.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen Alternate Reality Games, Kollektive Intelligenz, Schwarmintelligenz, Transmedialität, Spielerinteraktion, Puppetmasters, Koordination und Kooperation. Besonderer Fokus liegt auf der Analyse des ARGs „The Lost Ring“ als Beispiel für die Anwendung kollektiver Intelligenz in einem komplexen Spielumfeld.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Alternate Reality Games (ARGs)?
ARGs sind transmediale Spiele, die die reale Welt als Spielfläche nutzen und Erzählungen über verschiedene Medien (Web, Telefon, reale Orte) weben.
Was versteht man unter kollektiver Intelligenz in ARGs?
Es beschreibt das Phänomen, dass tausende Spieler weltweit ihr Wissen und ihre Fähigkeiten bündeln, um komplexe Rätsel zu lösen, die ein Einzelner nie bewältigen könnte.
Wer sind die „Puppetmasters“?
Puppetmasters sind die Spielleiter, die die Handlung im Hintergrund steuern, den Spielern Hinweise geben und auf deren Aktionen in Echtzeit reagieren.
Was war das ARG „The Lost Ring“?
Ein globales ARG aus dem Jahr 2008 zur Promotion der Olympischen Spiele, an dem 5000 aktive Spieler aus über 100 Ländern teilnahmen.
Wie unterscheidet sich Schwarmintelligenz von kollektiver Intelligenz?
Während Schwarmintelligenz oft auf einfachen, instinktiven Regeln basiert, erfordert kollektive Intelligenz bewusste Kooperation, Reflexion und Wissensaustausch.
- Citar trabajo
- Diana Weschke (Autor), 2010, Kollektive Intelligenz in Alternate Reality Games, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/156455