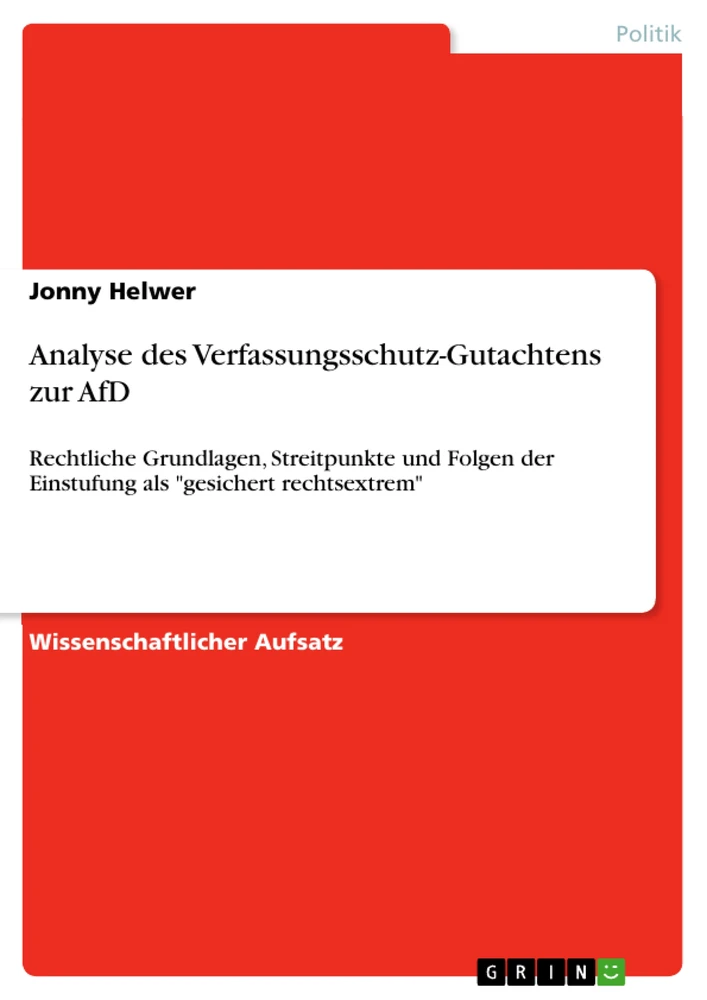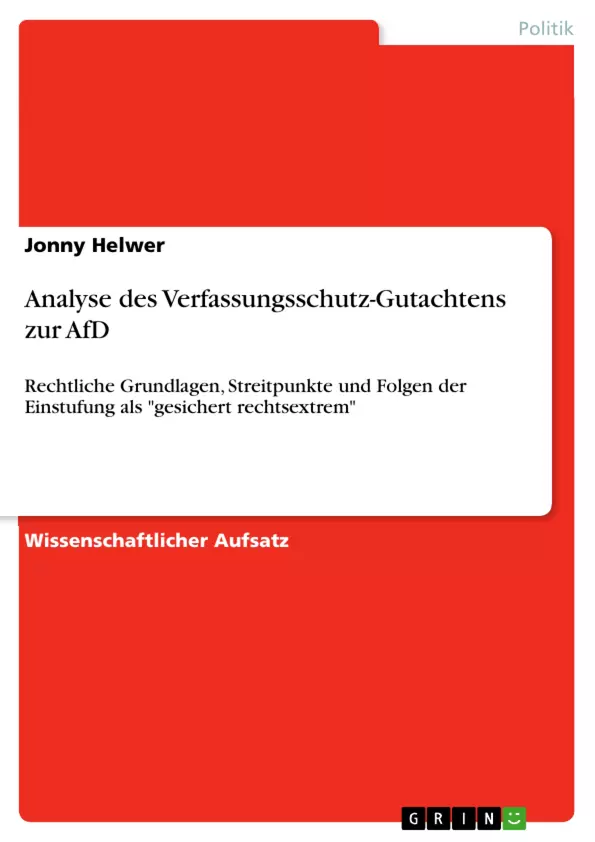Warum wurde die AfD im Mai 2025 vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft - und hält diese Einstufung einer gerichtlichen Prüfung stand? Diese fundierte Stellungnahme liefert in knapp 8 Seiten eine pointierte, zugleich gut lesbare Antwort. Ausgehend vom 1.100-seitigen BfV-Gutachten analysiert der Autor die rechtlichen Prüfsteine des § 4 Bundesverfassungschutzgesetz, die einschlägige Rechtsprechung (VG Köln, OVG NRW, BVerfG) und das Spannungsfeld zwischen wehrhafter Demokratie und staatlicher Neutralität. Er zeigt, wo das Gutachten überzeugt, wo es Kritikpunkte gibt und welche Folgen (von verschärfter Beobachtung bis zu einem möglichen Parteiverbotsverfahren) jetzt realistisch sind. Ein unverzichtbarer Schnellkompass für alle, die die juristischen und politischen Konsequenzen der AfD-Einstufung verstehen wollen.
Analyse des Verfassungsschutz-Gutachtens zur AfD
Einleitung
Anfang Mai 2025 stuft das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ ein 1 . Grundlage dieser Einstufung ist ein mehrjähriges Gutachten des BfV mit über 1.100 Seiten Umfang 2 , in dem zahlreiche Äußerungen und Positionen von AfD-Funktionären dokumentiert und ausgewertet wurden. Bereits 2021 war die Gesamtpartei als Verdachtsfall eingestuft worden 3 , während einzelne Teilorganisationen - etwa der mittlerweile formell aufgelöste „Flügel“ der AfD und die Jugendorganisation Junge Alternative (JA) - teils schon früher als rechtsextremistisch bewertet wurden. Die nun erfolgte Hochstufung der Gesamtpartei hat ein gerichtliches Nachspiel: Die AfD klagt vor dem Verwaltungsgericht Köln gegen diese Einstufung und beruft sich dabei auf politische Neutralitätspflichten des Verfassungsschutzes 4 . In dieser Stellungnahme werden das Gutachten und die Einstufung der AfD einer juristischen und politikwissenschaftlichen Analyse unterzogen. Insbesondere wird untersucht, ob die rechtlichen Anforderungen für eine Beobachtung nach dem Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG) erfüllt sind, wie tragfähig die angeführten Belege im Lichte der Rechtsprechung - namentlich des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) - sind, ob Verhältnismäßigkeit und Trennschärfe bei der Behandlung von Gesamtpartei, JA und „Flügel“ gewahrt wurden, und ob das Vorgehen des BfV im Spannungsfeld von Verfassungsschutzauftrag und politischer Neutralität rechtlich vertretbar ist. Dabei werden einschlägige Gerichtsurteile (u. a. VG Köln und BVerfG) sowie die zentralen Argumente des Gutachtens systematisch berücksichtigt.
Rechtliche Grundlagen der Beobachtung (§ 4 BVerfSchG)
Nach § 4 Abs. 1 BVerfSchG darf das BfV Organisationen beobachten, wenn „tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür vorliegen, dass diese Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung (fdGO) verfolgen 5 . Eine „Bestrebung“ in diesem Sinne ist jedes zielgerichtete Verhalten, das darauf abzielt, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder zentrale Verfassungsgrundsätze der fdGO zu beseitigen oder außer Kraft zu setzen. Zur fdGO zählen gemäß ständiger Rechtsprechung insbesondere die Menschenwürde und Grundrechte, die Volkssouveränität mit freien Wahlen, das Mehrparteiensystem und Chancengleichheit der Parteien, die Gewaltenteilung, die Unabhängigkeit der Gerichte sowie die Verantwortlichkeit der Regierung und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 7 . Aktivitäten einer Partei, die darauf gerichtet sind, diese Prinzipien zu unterlaufen oder abzuschaffen, erfüllen den Beobachtungsgrund. Im Fall der AfD musste das BfV also belegen, dass genügend tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die auf verfassungsfeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei hindeuten.
Das Gutachten des BfV zur AfD ist darauf ausgerichtet, diese Schwelle zu untermauern. Es führt eine Fülle von Belegen für verfassungsfeindliche Äußerungen und Positionen an - hauptsächlich aus öffentlichen Reden, Social-Media-Beiträgen und Programmdokumenten der AfD 8 . Dabei wurden die Befunde thematisch geordnet, u. a. in Kategorien wie „ethnischabstammungsmäßige Aussagen und Positionen“, „Fremdenfeindlichkeit“, „Islamfeindlichkeit“ sowie Verstöße gegen das Demokratieprinzip. Diese Struktur soll aufzeigen, dass die AfD in mehreren Bereichen gegen fundamentale Verfassungsgrundsätze agiert. Bereits 2022 stellte das Verwaltungsgericht Köln fest, dass es ausreichende tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen in der AfD gibt 11 . Das BfV habe dies in seinem
Gutachten und den Materialsammlungen durch eine nicht zu beanstandende Gesamtbetrachtung belegt
12 . Auch das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen bestätigte später, es lägen „zahlreiche Anhaltspunkte dafür [vor], dass die AfD gegen zentrale Prinzipien der Verfassung agiere“ 13 . Diese gerichtliche Rückendeckung zeigt, dass das Gutachten die gesetzlichen Anforderungen des § 4 BVerfSchG dem Grunde nach erfüllt. Die Gerichte ließen jedoch zunächst offen, ob sich die Verdachtsmomente bereits zu gesicherten Erkenntnissen verdichtet haben 14 . Genau dies reklamiert das BfV nun: Seit der Einstufung als Verdachtsfall 2021 hätten sich die Hinweise „zur Gewissheit verdichtet“, sodass nunmehr eine „extremistische Prägung der Gesamtpartei“ festzustellen sei 15 . Insofern ist die Hochstufung das Ergebnis einer dreijährigen
Prüfung, in der das BfV zunächst Erkenntnisse sammelte und nun - nach eigener Einschätzung - die Schwelle vom Verdacht zum Nachweis überschritten sieht 16 15 .
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die formellen Voraussetzungen für die Beobachtung der AfD nach BVerfSchG gegeben sind. Es liegen zahlreiche dokumentierte Aussagen vor, die den Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen begründen, und die Behörden haben den gerichtlich geforderten Nachweis tatsächlicher Anhaltspunkte erbracht 12 13 . Damit ist die rechtliche Grundlage für die Einstufung als Beobachtungsobjekt erfüllt. Die darauf gestützten Maßnahmen (nachrichtendienstliche Informationsbeschaffung, Observation etc.) sind grundsätzlich rechtmäßig, sofern - und das wird im Folgenden zu analysieren sein - die inhaltliche Bewertung dieser Anhaltspunkte einer Überprüfung an den Maßstäben der Rechtsprechung standhält.
Verfassungsfeindliche Anhaltspunkte im Lichte der Rechtsprechung
Kern der inhaltlichen Bewertung ist die Frage, inwieweit die AfD-Äußerungen tatsächlich gegen die fdGO gerichtet sind und somit verfassungsfeindlichen Charakter haben. Das BfV-Gutachten identifiziert hierzu mehrere thematische Komplexe. Besonders hervorgehoben wird der von der AfD vertretene „ethnisch-abstammungsmäßige Volksbegriff“ 17 . Danach definiert die Partei das deutsche „Volk“ primär nach Abstammungskriterien, was dazu dient, Deutsche mit Migrationshintergrund auszugrenzen und als Bürger zweiter Klasse abzuwerten 18 . So werden etwa Eingebürgerte von AfD-Vertretern als „Passdeutsche“ diffamiert 19 . Ein Beispiel liefert die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, die 2022 auf Telegram schrieb: „Wir dürfen nicht zulassen, dass [...] man zum ,deutschen Volk‘ nicht mehr durch Abstammung gehört, sondern durch Übertreten der Landesgrenze“ 20 . Immer wieder ist in AfD-Kreisen von einem angeblichen „Bevölkerungsaustausch“ oder „Umvolkung“ die Rede, also der Verschwörungsthese, die einheimische Bevölkerung werde durch Migration ausgetauscht 21 . Migranten werden als „illegal ins Land gerufene Kulturfremde“ dargestellt, deren Anwesenheit zu „Untergang und Zerstörung Deutschlands“ führe 22 . Solche Äußerungen implizieren, dass Teile der Bevölkerung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft von der vollen Gleichberechtigung und Teilhabe ausgeschlossen werden sollen 18 . Der Verfassungsschutz stellt fest, der völkischethnische Volksbegriff sei inzwischen „Grundkonsens in der Partei“ - es handele sich ausdrücklich „nicht um Einzelfälle“, sondern um eine parteiweit getragene Ideologie 23 . Selbst interne Versuche der AfD, sich nach außen moderater zu geben (etwa ein 2018 verfasstes Papier zum Verzicht auf gewisse Kampffiegriffe oder eine später veröffentlichte „Erklärung zum deutschen Staatsvolk“), haben an der tatsächlichen Haltung nichts Grundlegendes geändert - das Gutachten bewertet solche Manöver als zweideutig und taktisch motiviert 24 .
Verfassungsrechtlich sind derartige ethnisch-exklusiven Konzepte klar unvereinbar mit dem Grundgesetz. Das BVerfG hat im NPD-Verbotsverfahren 2017 unmissverständlich festgestellt, dass eine an einer „ethnisch definierten Volksgemeinschaft"' orientierte Politik die Menschenwürde aller ausgrenzt, die nicht dieser Abstammungsgemeinschaft angehören, und mit dem Demokratieprinzip unvereinbar ist 25. Mit anderen Worten: Ein Staats- und Volksverständnis, das Bürger innen aufgrund ihrer Herkunft zu Bürgern minderen Rechts erklärt, missachtet Art. 1 GG (Menschenwürde) sowie das Demokratieprinzip der Gleichheit und Volkssouveränität 25 . Die AfD vertritt nach den Erkenntnissen des Gutachtens genau ein solches Konzept in weiten Teilen der Partei. Damit liegt ein zentraler verfassungsfeindlicher Ansatzpunkt vor, der auch aus Sicht höchstrichterlicher Rechtsprechung tragfähig ist. Die ideologische Nähe zum historischen Nationalismus bzw. völkischen Denken (eine „Wesensverwandtschaft: mit der NSDAP“ , wie das BVerfG es bei der NPD formulierte 26 ) wird evident, wenn die AfD beispielsweise von „Umvolkung“ spricht - ein Begriff aus dem Sprachgebrauch der extremen Rechten und Neonazi-Szene. Insgesamt erscheint der Nachweis eines rassisch-völkischen Weltbildes in der AfD als belastbares Kriterium, um eine „gegen die Menschenwürde gerichtete“ * Bestrebung im Sinne des BVerfSchG anzunehmen.
Neben dem Volksbegriff dokumentiert das Gutachten zahlreiche fremdenfeindliche und muslimfeindliche Äußerungen von AfD-Funktionären. Diese richten sich pauschal gegen Ausländer, Geflüchtete oder Muslime und zeichnen ein abwertendes, menschenverachtendes Bild dieser Gruppen 27 28. AfD-Bundessprecherin Alice Weidel etwa schrieb polemisch, „Messerkriminalität“ gebe es ausschließlich bei Zuwanderern, dies sei „in unserer Kultur völlig unbekannt“ 27 . Thüringens AfD- Chef Björn Höcke warnte vor einer „kulturellen Kernschmelze“, sollte die „millionenfache Zuwanderung“ nicht gestoppt werden 29 . Der sächsische AfD-Abgeordnete Alexander Wiesner phantasierte von „Analphabeten aus dem Ausland“, deren „Hemmschwelle zu Gewalt noch niedriger ist als deren Bildungsgrad“ 29 . Muslime generell werden in AfD-Diskursen als „Barbaren“ oder „Integrationsverweigerer“ geschmäht 28 . Martin Renner, AfD-Bundestagsabgeordneter, polemisierte: „Multikulti ist Burka-Schwarz“ 28 . Der AfD-Bundesverband sprach in einem Facebook-Beitrag 2022 im Zusammenhang mit dem Muezzin-Ruf einer Kölner Moschee von „kultureller Landnahme“, gegen die man sich „wehren“ müsse 28 . Laut Gutachten schüren solche Äußerungen irrationale Ängste und fördern die dauerhafte Ablehnung und Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen (hier insbesondere Muslim*innen) 30 .
Der Blick des BVerfG auf solche Aussagen würde vor allem die Menschenwürde und Gleichheitsrechte sowie das Religionsgrundrecht in Anschlag bringen. Pauschale Herabwürdigungen oder Feindbilder gegen ethnisch-religiöse Gruppen widersprechen dem Geist von Art. 1 und 3 GG. Besonders deutlich zeigt sich der verfassungswidrige Gehalt bei konkreten politischen Forderungen der AfD: So propagierte die Partei im Bundestagswahlkampf u. a. ein Minarett-Verbot und ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst - Maßnahmen, die laut OVG NRW die Menschenwürde verletzen bzw. die Religionsfreiheit muslimischer Frauen erheblich einschränken würden 31 . Diese Programmpunkte dokumentieren, dass die AfD nicht nur verbal hetzt, sondern auch politische Ziele verfolgt, die grundrechtliche Garantien aushebeln. Insofern sind die fremden- und islamfeindlichen „Anhaltspunkte“ im Gutachten nicht lediglich geschmacklose Ausrutscher einzelner Mitglieder, sondern Belege für einen gegen die Verfassungswerte gerichteten Kurs der Partei.
Ein weiterer Aspekt betriffi den Umgang der AfD mit der Geschichte und dem NS-Regime sowie antisemitische Untertöne. Das Gutachten verweist z. B. auf AfD-Politiker, die die Verantwortung Deutschlands am Zweiten Weltkrieg relativieren oder die Erinnerungskultur verhöhnen. So behauptete ein AfD-Abgeordneter pauschal, „das deutsche Volk“ sei an den NS-Verbrechen unschuldig gewesen und nur die NS-Führungsriege habe Schuld auf sich geladen 32 . Björn Höcke sprach von einem „Schuldkult“ und verwendete mit „Alles für Deutschland“ sogar einen bekannten SA-Parolenruf, um kämpferische Stimmung zu erzeugen 33 . Hans-Thomas Tillschneider phantasierte von einer „globalistischen“ Fremdsteuerung Deutschlands und deutete an, der US-Investor George Soros habe den Ukrainekrieg provoziert 34 - eine klassische antisemitische Verschwörungserzählung. Antisemitismus findet laut Gutachten zwar (noch) „nur vereinzelt“ statt und sei nicht prägend für die Gesamtpartei 35 . Gleichwohl werden entsprechende Aussagen - etwa von Höcke und Tillschneider - als Beleg für verfassungsfeindliche Tendenzen angeführt. Die Herabwürdigung demokratischer Institutionen geht ebenfalls aus einigen Zitaten hervor: AfD-Co-Chef Tino Chrupalla bezeichnete Regierungsmitglieder als „Vasallen Amerikas“ und stellte die Souveränität Deutschlands infrage 36 . Solche Angriffe auf die Legitimität der gewählten Regierung und die Integrität des Staatswesens verdichten sich in der AfD ebenfalls, wenn auch zahlenmäßig weniger häufig als die völkisch-rassistischen Äußerungen 37 . Das Gutachten wertet diese demokratiefeindlichen Aussagen (z. B. das Absprechen der Souveränität oder die Rede vom politischen „Kartell“ aus etablierten Parteien) als Anzeichen für Bestrebungen gegen das Demokratieprinzip 38 . Auch hier hat das BVerfG in früheren Verfahren (etwa zum NPD-Verbot) klargestellt, dass die Verächtlichmachung des parlamentarischen Systems und das Hinarbeiten auf einen autoritären Staat die freiheitliche demokratische Grundordnung beseitigen wollen 25 .
Insgesamt sind die vom BfV gesammelten Anhaltspunkte inhaltlich eng an die juristischen Maßstäbe des BVerfG angelehnt. Insbesondere der Fokus auf das ethnisch-völkische Volksverständnis folgt dem Muster des NPD-Urteils, das diesem Kriterium eine zentrale Bedeutung beimaß 25 . Auch die belegten Forderungen (Remigration in sechsstelliger bis millionenfacher Zahl, Abschiebekultur, Diskriminierung von Doppelstaatlern etc.) zeigen ein aktiv kämpferisches Vorgehen gegen Grundrechte, das über bloße Meinungsäußerung hinausgeht und damit die Grenze zum „verfassungsfeindlichen Handeln“ überschreitet 31 39 . Zwar mag diskutiert werden, ob alle zitierten Äußerungen im Gutachten gleich gewichtig sind - das Gutachten selbst relativiert z.B. den Antisemitismusbefund als bislang randständig 35 . Doch die Gesamtbilanz der belegten Aussagen ergibt ein konsistentes Bild: Die AfD - jedenfalls in weiten Teilen ihrer Führung und Mitgliedschaft - strebt eine andere politische Ordnung an, die mit den Grundprinzipien des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren ist. Diese Bewertung wird nicht nur vom BfV behauptet, sondern fand bereits in den Urteilen des VG Köln und OVG NRW deutliche Bestätigung 13 . Aus Sicht der höchstrichterlichen Rechtsprechung sind die angeführten Anhaltspunkte deshalb tragfähig, um eine verfassungsfeindliche
Bestrebung zu begründen. Das Gutachten ordnet die AfD-Positionen systematisch den bekannten verfassungsfeindlichen Ideologien zu - insbesondere dem Rassismus und Autoritarismus - und erfüllt damit die inhaltliche Anforderung, die BVerfG und Bundesverwaltungsgericht an eine solche Einstufung stellen dürften.
Verhältnismäßigkeit und Trennschärfe: Gesamtpartei, „Flügel“ und Junge Alternative
Ein wichtiger juristischer Maßstab bei der Beobachtung politischer Parteien ist die Wahrung der Verhältnismäßigkeit (angemessene, möglichst schonende Eingriffe) und die juristische Trennschärfe. Letztere bedeutet, dass genau differenziert wird, wen und was der Verfassungsschutz beobachtet, um pauschale Stigmatisierungen zu vermeiden. Im Falle der AfD hat das BfV tatsächlich einen gestuften und differenzierten Ansatz gewählt: Es wurden Teilorganisationen separat bewertet und unterschiedlich eingestuft, anstatt sofort die gesamte Partei als extremistisch zu behandeln. So war bereits seit 2019/2020 der informelle Partei-Flügel um Björn Höcke - der so genannte „Flügel“ - vom BfV als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft worden, weil dort besonders radikale Positionen vorherrschten. Ebenso geriet die Junge Alternative (JA), die Jugendorganisation der AfD, unter gesonderte Beobachtung und wurde als Verdachtsfall geführt 40 . Die Gesamtpartei AfD hingegen wurde zunächst „nur“ als Verdachtsfall (Stufe 2) behandelt und nicht sofort als erwiesen extremistisches Objekt - ein Zeichen dafür, dass das BfV zunächst zwischen dem harten Kern und dem formellen Parteikörper unterschied. Diese Differenzierung wurde auch von den Gerichten geprüft: Das VG Köln hielt in seinem Urteil vom März 2022 ausdrücklich fest, dass das BfV eine zulässige Gesamtbetrachtung vorgenommen hat und die Partei sich in einem „Richtungsstreit“ befinde, bei dem sich die verfassungsfeindlichen Kräfte durchsetzen könnten 41 . Das impliziert, dass damals (2021/22) noch nicht abschließend entschieden war, ob die gesamte AfD bereits von den extremistischen Tendenzen dominiert wird - daher die proportionale Wahl der Einstufung als Verdachtsfall, verbunden mit weiterer Beobachtung.
Die Trennschärfe zeigt sich auch daran, dass BfV und Gerichte einzelne Organisationsteile gesondert beurteilt haben. So durfte der „Flügel“ vom BfV als Verdachtsfall beobachtet werden - die AfD hatte zwar geklagt, aber das VG Köln bestätigte die Zulässigkeit der Beobachtung des Flügels als Verdachtsfall 42 . Allerdings stellte das Gericht zugleich klar, dass eine Einstufung des (formal aufgelösten) Flügels als „gesichert extremistische Bestrebung“ unzulässig sei 43 . Diese feinsinnige Unterscheidung betont, dass nach der formalen Auflösung des Flügels (die AfD hatte den Flügel 2020 offiziell für beendet erklärt) die Behörde nicht so tun darf, als existiere weiterhin eine getrennte Teilorganisation - eine Frage der rechtlichen Präzision. Stattdessen müsse betrachtet werden, welche Personen und Positionen aus dem Flügel weiterhin in der AfD wirken. Genau das tut das Gutachten: Es kommt zu dem Schluss, dass die ehemaligen Flügel-Akteure keineswegs aus der Partei gedrängt wurden, sondern „weiter aktiver Teil der Partei“ sind 44 . Viele Mitglieder der JA und des aufgelösten Flügels hätten inzwischen einflussreiche Positionen in der Gesamtpartei erlangt 45 . Eine „grundsätzliche Entfremdung“ zwischen Partei und diesen extremen Strömungen habe nicht stattgefunden - vielmehr spiegelten die Positionen des ehemaligen Flügels mittlerweile parteiweit die vorherrschende Tendenz wider 46 . Mit anderen Worten: Was einst ein radikaler „Flügel“ war, ist nun im Parteimainstream angekommen. Diese Entwicklung ist zentral für die Frage der Verhältnismäßigkeit: Das BfV konnte zunächst auf die getrennte Beobachtung des Flügels beschränken (ein milderes Mittel gegenüber einer sofortigen Gesamtbeobachtung). Als aber die Radikalen die Partei durchdrungen haben, erscheint es gerechtfertigt, nun auch die Gesamtpartei strenger zu beurteilen.
Die Gerichte haben dem BfV in weiten Teilen bestätigt, dass es weder über das Ziel hinausgeschossen noch unscharf agiert hat. So wies das VG Köln die Klage der AfD ab, es zu unterlassen, die Gesamtpartei als Verdachtsfall zu beobachten 11 - Beobachtung und sogar die öffentliche Mitteilung dieser Einstufung seien rechtmäßig, da gewichtige Anhaltspunkte vorliegen 12 47 . Zugleich bekam die AfD in einem Nebenpunkt Recht: Das BfV durfte nicht mehr behaupten, der Flügel habe (bis zu seiner Auflösung) 7.000 Mitglieder und diese Zahl gelte fort - diese Aussage wurde gerichtlich untersagt 48 . Dieser Aspekt mag klein erscheinen, zeigt aber, dass Trennschärfe auch bei Tatsachenbehauptungen wichtig ist: Das BfV muss exakt und belegbar argumentieren und Übertreibungen vermeiden, um nicht die Rechte der Betroffenen zu verletzen. Insgesamt wurde aber die
Stufeneinteilung (Flügel und JA separat, AfD insgesamt zunächst nur Verdachtsfall) als schlüssig betrachtet. Der Umstand, dass die JA - trotz ihrer Auflösung im Frühjahr 2023 - ähnlich wie der Flügel bewertet wird (kein Freibrief für die Partei) 49 , unterstreicht, dass die Einstufung differenziert, aber auch konsequent erfolgt: Formale Auflösungen entbinden die Partei nicht von der Verantwortung, wenn dieselben Personen und Ideologien nahtlos in der AfD weiteragieren 44 .
Auch im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit der Überwachungsmaßnahmen ist das Vorgehen gestuft. Als Verdachtsfall durfte das BfV zwar bereits gewisse offenere Beobachtungsinstrumente einsetzen (z. B. Sammlung offener Quellen, Beobachtung von Veranstaltungen, begrenzter Datenaustausch mit anderen Behörden) 50 51 , verzichtete aber zunächst - der Rechtslage entsprechend - auf härtere Eingriffe wie V-Leute oder Telekommunikationsüberwachung, die in voller Konsequenz erst bei einer gesicherten extremistischen Bestrebung zulässig werden. Die Hochstufung 2025 würde dem BfV nun mehr Eingriffsbefugnisse geben, wird aber bis zur gerichtlichen Klärung nicht umgesetzt, wie eine sogenannte Stillhaltezusage der Behörde zeigt 52 . Das BfV hat dem VG Köln zugesichert, vorerst keine Maßnahmen auf Basis der neuen Einstufung zu ergreifen und die AfD öffentlich nicht als „gesichert rechtsextremistisch“ zu bezeichnen, bis im Eilverfahren entschieden ist 52 . Dieses selbstauferlegte Zuwarten demonstriert abermals Verhältnismäßigkeit und Rechtsstaatlichkeit: Die Behörde nimmt Rücksicht darauf, dass ein laufendes Verfahren Klarheit schaffen soll, bevor irreversible Fakten geschaffen werden.
Letztlich kann man konstatieren, dass Maßnahmenintensität und Adressatenkreis sorgfältig angepasst wurden. Die Gesamtpartei wurde nicht übereilt stigmatisiert, sondern erst nach wachsender Evidenz - schrittweise - stärker ins Visier genommen. Gleichzeitig hat das BfV klar benannt, welche Teile der AfD besonders extremistisch beeinflusst sind, anstatt die gesamte Mitgliedschaft unterschiedslos zu verdächtigen. Diese Vorgehensweise entspricht dem Gebot, politische Äußerungen nach ihrem Kontext zu bewerten und nur dort zum Extremismus zu zählen, wo die Grenze zur Verfassungsfeindlichkeit tatsächlich überschritten ist. Die Tatsache, dass gegen eindeutig verfassungsfeindliche Äußerungen innerhalb der AfD kaum parteiinterne Sanktionen oder Ordnungsmaßnahmen erfolgten 53 , erleichterte dem BfV die Zuordnung dieser Positionen der Partei als Ganzes. So führt das Gutachten explizit aus, dass trotz hunderter fragwürdiger Äußerungen nur sehr wenige Parteiausschlüsse oder Disziplinarmaßnahmen bekannt wurden 53 - die Partei tolerierte also die extremistischen Stimmen, was ihre Zurechnung zum „geistigen Gesamtkurs“ der AfD rechtfertigt. Dies unterstreicht die Trennschärfe in der Sache: Nicht die Mitgliedschaft in der AfD an sich wird zum Verdachtsgrund, sondern das kollektive Gewährenlassen extremistischer Bestrebungen innerhalb der Partei. Diese Differenzierung - zwischen bloßer Radikalität im Meinungsspektrum und echter Verfassungsfeindlichkeit - wurde gewahrt, indem das BfV sich auf qualitativ gravierende Fälle (Menschenwürdeverletzungen, Rassismus, Aufrufe zur Abschaffung von Grundrechten etc.) konzentrierte. Insgesamt ist die Einstufung daher juristisch gut austariert: Sie belastet die Partei nur insoweit, wie konkrete Anhaltspunkte es erfordern, und sie benennt Verantwortungsbereiche präzise (Flügel, JA, Gesamtpartei) anstatt in Generalverdacht zu verfallen.
Neutralitätspflicht und Verfassungsschutzauftrag - Rechtliche Würdigung des Vorgehens
Die Beobachtung einer parlamentarisch erfolgreichen Oppositionspartei durch den Inlandsgeheimdienst ist zwangsläufig heikel. Hier treffen zwei Prinzipien aufeinander: zum einen die Wehrhaftigkeit der Demokratie, die es verlangt, Verfassungsfeinde frühzeitig zu erkennen und zu bekämpfen, auch wenn sie in Form einer Partei auftreten; zum anderen die staatliche Neutralitätspflicht im politischen Wettbewerb, welche gebietet, dass Staatsorgane die Chancengleichheit der Parteien respektieren und nicht durch unverhältnismäßige Eingriffe das politische Kräftemessen verzerren. Im Fall der AfD- Bewertung durch das BfV stellt sich die Frage, ob die Behörde diese Gratwanderung im rechtlich vertretbaren Rahmen bewältigt.
Zunächst ist festzuhalten, dass das Grundgesetz selbst den Umgang mit potentiell verfassungsfeindlichen Parteien regelt: Nach Art. 21 Abs. 2 GG kann eine Partei nur durch das BVerfG verboten werden. Bis zu einer solchen (äußerst seltenen) Verbotsentscheidung genießen Parteien das sogenannte Parteienprivileg, d. h. sie dürfen nicht wie gewöhnliche verfassungsfeindliche Vereine behandelt werden. Allerdings schließt dieses Privileg Beobachtungs- und Aufalärungsmaßnahmen durch den Verfassungsschutz nicht aus, solange diese auf gesetzlicher Grundlage und bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen erfolgen. Parteien stehen nicht außerhalb der präventiven Verfassungsschutzkontrolle, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen bestehen - sie sind lediglich vor übereilten administrativen Sanktionen oder Verboten geschützt. In diesem Rahmen hat der Staat das legitime Recht und sogar die Pflicht, die Öffentlichkeit über extremistische Tendenzen in Parteien zu informieren. So hat das VG Köln explizit betont, das BfV dürfe die Einstufung der AfD als Verdachtsfall auch öffentlich mitteilen, um eine politische Auseinandersetzung zu ermöglichen 54 . Dies zeigt, dass Transparenz über verfassungsfeindliche Umtriebe im Interesse der Demokratie liegen kann: Die Wählerinnen und Wähler haben ein Recht darauf zu erfahren, wenn eine Partei in erheblichem Maße gegen die Verfassungsordnung arbeitet, damit sie ihre politische Entscheidung informierter treffen können.
Natürlich darf der Verfassungsschutz seine Warnfunktion nicht missbrauchen, um unliebsame Oppositionsarbeit zu behindern. Deshalb ist die Neutralitätspflicht insbesondere für Regierungsmitglieder und Behördenleiter wichtig. In früheren Fällen hat das BVerfG etwa gerügt, wenn Regierungsvertreter ihre amtliche Stellung nutzten, um polemisch gegen eine Partei (z. B. die NPD oder AfD) Stimmung zu machen - dies verletze die Chancengleichheit, sofern es ohne sachlichen Grund erfolgt. Im vorliegenden Fall aber agiert das BfV auf Basis eines gesetzlich definierten Auftrags: Es sammelt Fakten und bewertet diese anhand rechtlicher Kriterien, anstatt bloß politisch zu polemisieren. Die umfangreiche Dokumentation öffentlicher Quellen im Gutachten 8 belegt, dass das BfV seine Schlüsse nicht willkürlich zieht, sondern am objektiven Befundmaterial orientiert ist. Zudem unterliegt das Vorgehen der Kontrolle unabhängiger Gerichte - und diese haben, wie dargestellt, die wesentlichen Schritte gebilligt 13 . Dass die AfD im Klageweg zumindest teilweise unterliegt, spricht dafür, dass das Gericht keine parteipolitische Instrumentalisierung, sondern einen faktenbasierten Vorgang sieht. In den Urteilsgründen des OVG NRW etwa wird hervorgehoben, es gebe zahlreiche gewichtige Indizien für verfassungsfeindliche Aktivitäten der AfD, was die Beobachtung rechtfertige 13 . Diese Formulierung signalisiert, dass das Gericht die Neutralität des BfV insofern bestätigt hat, als sachliche Gründe (nicht politische Gesinnungsunterschiede) die Maßnahme tragen.
Ein weiterer Aspekt ist die zeitliche Abstimmung der BfV-Maßnahmen, um Neutralität zu wahren. 2021, als die AfD erstmals als Verdachtsfall eingestuft werden sollte, war dies kurz vor der Bundestagswahl öffentlich bekannt geworden - was kontrovers diskutiert wurde. Das BfV hatte damals aufgrund anhängiger Eilverfahren darauf verzichtet, die Einstufung vor der Wahl aktiv zu kommunizieren, um nicht als Eingriff in den Wahlkampf zu gelten (Stichwort „Stillhaltezusage“). Auch aktuell, im Mai 2025, wo ein Wahljahr im Osten ansteht, hat das BfV umgehend erklärt, man werde bis zur Gerichtsentscheidung vorläufig nicht weiter in die Rechte der AfD eingreifen oder sie öffentlich als Extremisten bezeichnen 52 . Diese Zurückhaltung zeugt vom Bewusstsein der Behörde für ihre pflichtgemäße Neutralität: Man will den Ausgang des Rechtsstreits abwarten, anstatt Fakten zu schaffen, die im Nachhinein als ungerechtfertigte Wahlbeeinflussung angesehen werden könnten.
Insgesamt bewegt sich das Vorgehen des BfV im Spannungsfeld zwischen Verfassungsschutz und Neutralität auf schmalem, aber vertretbarem Grat. Einerseits zeigt das Gutachten deutlich, dass der Schutz der fdGO hier ernst genommen wird - die Behörde scheut sich nicht, auch eine parlamentarische Partei ins Visier zu nehmen, wenn die Belege es erfordern. Andererseits wurden rechtsstaatliche Sicherungen beachtet: Die Maßnahmen erfolgen gestuft, transparent (soweit möglich) und unter gerichtlicher Kontrolle. Die AfD hatte und hat die Möglichkeit, sich juristisch zu wehren - was sie umfangreich tut - und die Gerichte prüfen streng, ob das BfV seine Kompetenzen überschreitet oder politische Voreingenommenheit zeigt. Bisher deutet das überwiegende Obsiegen des BfV in diesen Prozessen darauf hin, dass keine rechtswidrige Voreingenommenheit vorlag, sondern eine rechtlich gedeckte Gefahrenabwehrmaßnahme 11 13 .
Natürlich bleibt ein Restrisiko, dass durch die Beobachtung selbst eine Partei in der öffentlichen Wahrnehmung delegitimiert wird - was die AfD lautstark beklagt. Doch genau deshalb ist die Begründungstiefe des Gutachtens so wichtig: Indem über 1.100 Seiten lang Zitate und Fakten referiert werden, kann sich die Öffentlichkeit (und im Zweifel das Gericht) selbst ein Bild machen, ob die AfD sich diesen Ruf nicht durch ihr eigenes Verhalten erworben hat. Das BfV stützt sich zudem fast ausschließlich auf offene Quellen und Äußerungen, die ohnehin bekannt sind 55 . Es „entdeckt“ also keine verborgenen
Geheimnisse, sondern ordnet öffentlich Gesagtes ein. Damit agiert es weniger als politischer Gegner, sondern vielmehr als Analyst im Dienste der Verfassung.
Fazit in diesem Spannungsfeld: Die politische Neutralität des BfV bleibt gewahrt, soweit es objektiv und rechtsstaatlich fundiert vorgeht - was hier der Fall zu sein scheint. Das Vorgehen liegt im rechtlich zulässigen Rahmen, weil es durch die Verfassungsschutzgesetze gedeckt ist und gleichzeitig den Anforderungen aus Art. 21 GG (Parteienfreiheit) Genüge tut, indem keine Vorverurteilung ohne Belege erfolgt. Die Balance zwischen Verfassungsschutz und politischer Offenheit wird dadurch gehalten, dass der Staat nicht verbotend, sondern aufalärend tätig wird. Der nächste Schritt - ein mögliches Parteiverbotsverfahren vor dem BVerfG - wäre eine politische Entscheidung der Verfassungsorgane Bundestag/Bundesrat und unterläge nochmals schärferen Bedingungen 56 . Bis dahin bleibt das BfV im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags tätig. Nach bisherigem Befund überschreitet es dabei nicht die Grenzen der Neutralität, sondern erfüllt eine vom Gesetzgeber gewollte Schutzfunktion gegenüber der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.
Schlussfolgerung
Die Analyse des Gutachtens und der darauf fußenden AfD-Einstufung zeigt, dass das BfV juristisch fundiert und differenziert vorgegangen ist. Die gesetzlichen Anforderungen des § 4 BVerfSchG an eine Beobachtung - das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen - werden durch eine Vielzahl belegter Aussagen und Positionen der AfD erfüllt 12 13 . Insbesondere der völkisch-ethnische Volksbegriff, die menschenverachtende Agitation gegen Migranten und Muslime sowie das subversive Infragestellen demokratischer Prinzipien stellen nach Maßgabe der Rechtsprechung des BVerfG deutliche Indizien für Verfassungsfeindlichkeit dar 25 . Diese Anhaltspunkte sind tragfähig, weil sie zentrale Werte der Verfassung - allen voran die Menschenwürde und Gleichheitsrechte - verletzen. Die Herleitung im Gutachten orientiert sich erkennbar an den vom BVerfG entwickelten Kriterien (etwa aus dem NPD-Urteil) und ordnet die AfD-Ideologie in diesen Rahmen ein.
Gleichzeitig achtet das BfV auf Verhältnismäßigkeit und Trennschärfe: Radikale Teilstrukturen wie der „Flügel“ und die JA wurden separat erfasst, und die Gesamtpartei wurde erst nach fortschreitender Radikalisierung zum Objekt einer verschärften Beobachtung. Die Behörden und Gerichte haben differenziert zwischen zulässiger oppositioneller (auch scharfer) Kritik und echter verfassungsfeindlicher Agitation - letztere wurde der AfD nach sorgfältiger Abwägung attestiert, ohne pauschal alle Mitglieder zu kriminalisieren 57 46 . Die Verhältnismäßigkeit zeigt sich auch darin, dass das BfV Schritt für Schritt vorging und z. B. vor gerichtlichen Entscheidungen freiwillig zusagte, die neue Einstufung vorerst nicht zu vollziehen 52 .
Im Spannungsfeld zwischen Verfassungsschutz und politischer Neutralität bewegt sich das Vorgehen des BfV nach aktueller Einschätzung im rechtlich zulässigen Rahmen. Es basiert auf objektiven Kriterien statt politischer Willkür und wurde durch unabhängige Gerichte weitgehend bestätigt 13 . Die Neutralitätspflicht wurde insofern gewahrt, als die Maßnahmen durch das Verhalten der AfD selbst provoziert und gerechtfertigt sind, nicht durch eine parteipolitische Motivation der Behörde. Damit ist das Handeln des BfV - vorbehaltlich der ausstehenden höchstrichterlichen Entscheidungen - juristisch vertretbar und stellt einen legitimen Ausdruck der wehrhaften Demokratie dar, die sich auch gegenüber einer Partei wie der AfD zur Wehr setzen darf, solange dies auf der Grundlage von Gesetz und Beweis geschieht. Die kommenden Verfahren (vor dem Bundesverwaltungsgericht und ggf. dem Bundesverfassungsgericht) werden diese Einschätzung nochmals auf den Prüfstand stellen. Doch schon jetzt wird deutlich: Das Gutachten ordnet die AfD systematisch als verfassungsfeindlich ein und untermauert dies mit zahlreichen Beispielen - es entspricht damit in Form und Inhalt den Anforderungen an eine gutachterliche Bewertung im Dienste des Verfassungsschutzes. Die AfD muss sich dieser Auseinandersetzung stellen, und zwar mit juristischen Argumenten - politische Rhetorik allein wird vor Gericht nicht genügen. In der Gesamtwürdigung erscheint die Einstufung der AfD als Verdachtsfall (und nun als extremistische Bestrebung) sowohl rechtlich begründet als auch dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung geschuldet. Die wehrhafte Demokratie erweist sich hier als handlungsfähig, ohne ihre eigenen Prinzipien - Rechtsstaatlichkeit und Neutralität - preiszugeben.
Quellen
Quellen: Bundesamt für Verfassungsschutz (Gutachten-Auszüge, Pressemitteilungen); Verwaltungsgericht Köln (Urteil 13 K 326/21 u.a.) 11 42 ; Oberverwaltungsgericht NRW (Urteilsgründe 2024) 13 ;
Bundesverfassungsgericht (NPD-Urteil 2017) 25 ; Tagesschau ; Legal Tribune Online 9 10 ; taz 18 23 31 46 ; Deutschlandfunk 25 .
1 2 3 4 16 32 52 53 55 Medien veröffentlichen Verfassungsschutz-Gutachten zur AfD | tagesschau.de https://www.tagesschau.de/inland/afd-medien-publizieren-verfassungsschutz-gutachten-100.html
5 6 7 50 51 AfD wird Prüffall für Beobachtung durch den Verfassungsschutz - was heißt das? https://www.anwalt.de/rechtshpps/afd-wird-prueffall-fuer-beobachtung-durch-den-verfassungsschutz-was-heisstdas_151675.html
8 9 10 13 14 36 39 Erste Belege zur AfD-Einstufung öffentlich https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/fragdenstaat-veroeffentlicht-gutachten-verfassungsschutz-afd-rechtsextremishsch
11 12 40 41 42 43 47 48 54 57 Bundesamt für Verfassungsschutz - Presse - Bundesamt für Verfassungsschutz obsiegt vor Verwaltungsgericht Köln gegen die AfD https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/pressemitteilung-2022-1-afd.html
15 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 33 34 35 37 38 44 45 46 49 56 Was steht im AfD-Gutachten?: Feinde der Verfassung - auf 1108 Seiten | taz.de https://taz.de/Was-steht-im-AfD-Gutachten/!6087894/
25 26 Die NPD und die Parteienfinanzierung - Ein demokratisches Dilemma
https://www.deutschlandfunk.de/die-npd-und-die-parteienfinanzierung-ein-demokrahsches-100.html
[...]
- Citation du texte
- Jonny Helwer (Auteur), 2025, Analyse des Verfassungsschutz-Gutachtens zur AfD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1591584