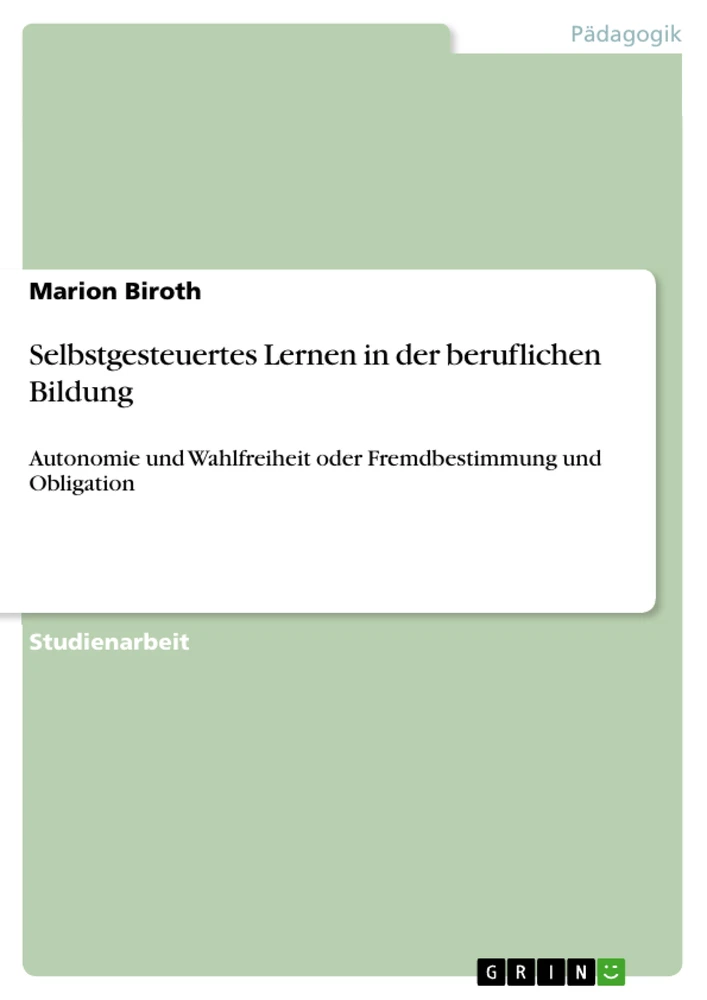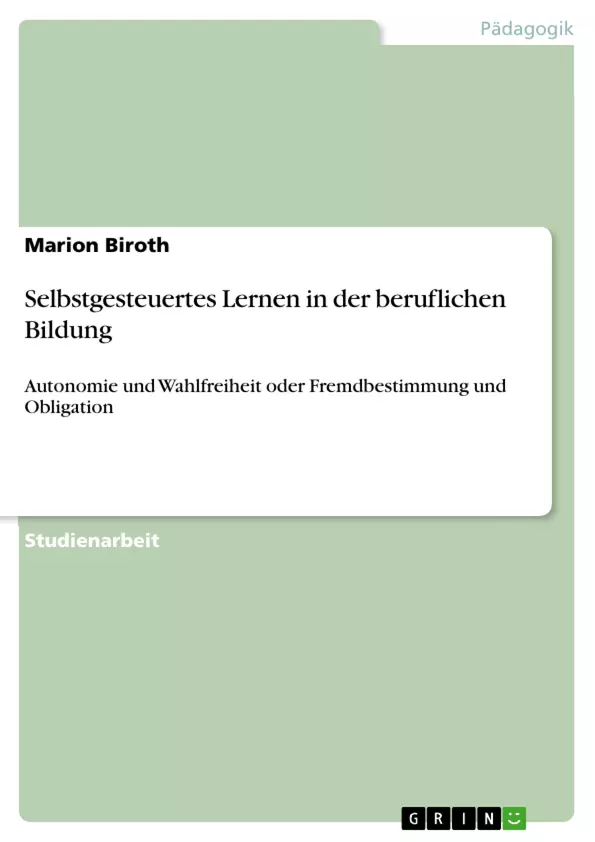Wir erleben in unserer Gesellschaft eine ständig wachsende Informationsflut verbunden mit der Notwendigkeit, „sich verändernden Bedingungen im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich anzupassen, konkurrenzfähig zu bleiben und Innovationen aus anderen Bereichen wie auch anderen Ländern nicht nachzustehen“ (Reinmann-Rothmeier/Mandl 1993, S. 233). Veränderungen in arbeitsorganisatorischer, technischer und gesellschaftlicher Hinsicht führen in vielen beruflichen Bereichen zu einer relativ raschen Veraltung berufsrelevanten Wissens, so dass von Erwerbstätigen eine zunehmende Lernbereitschaft gefordert wird. Der aktuelle Bildungsbericht (Bildung in Deutschland 2010, S. 135) weist darauf hin, dass insbesondere die berufliche Weiterbildung einen wichtigen Faktor für die „individuelle berufliche Mobilität und Behauptung am Arbeitsplatz“ darstellt. Lernen findet also nicht mehr nur in Schule und Ausbildung statt, sondern ein lebenslanges Lernen wird notwendig. In diesem Kontext kommt insbesondere der Fähigkeit zu selbstgesteuertem Lernen eine hohe Bedeutung zu. Allerdings beinhaltet dieser Begriff eine gewisse Ambivalenz. Hat der Erwerbstätige die Möglichkeit, seinen Lernprozess selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu gestalten, d.h. beispielsweise zu lernen, wo und wann er mag und wie es seinem Lernzweck dienlich ist oder ist er nicht letztendlich zu einem lebenslangen selbstgesteuerten Lernen verpflichtet, um seine Erwerbsfähigkeit zu erhalten? (Drees 2009, S. 81/82)
In der vorliegenden Hausarbeit soll also der Frage nachgegangen werden, ob selbstgesteuertes Lernen für den Erwerbstätigen Autonomie und Wahlfreiheit bedeutet oder ob es für ihn eine fremdbestimmte Verpflichtung darstellt. Dazu werden zunächst in Kapitel 2 eine Begriffsdefinition sowie eine lerntheoretische Verortung selbstgesteuerten Lernens vorgenommen. In Kapitel 3 wird auf die Voraussetzungen des selbstgesteuerten Lernens eingegangen und in Kapitel 4 schließlich ein theoretisches Modell selbstgesteuerten Lernens vorgestellt. Kapitel 5 beinhaltet die Dimensionen der Selbststeuerung und stellt Lernen im Spannungsfeld zwischen Selbstlernen und Fremdbestimmung in den Vordergrund. Die Arbeit endet mit einem Fazit in Kapitel 6, das die eingangs gestellte Frage abschließend betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Grundlagen
2.1. Begriffliche Klärung „Selbstgesteuertes Lernen“
2.2. Lerntheoretische Verortung
3. Voraussetzungen des selbstgesteuerten Lernens
4. Das Drei-Schichten-Modell des selbstgesteuerten Lernens (Boekaerts 1999)
5. Dimensionen der Selbststeuerung
5.1. Lernziel, Lerninhalte und Lern(erfolgs)kontrolle
5.2. Lernweg und Lernorganisation
6. Fazit
Literaturverzeichnis
- Citar trabajo
- Marion Biroth (Autor), 2010, Selbstgesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/159643