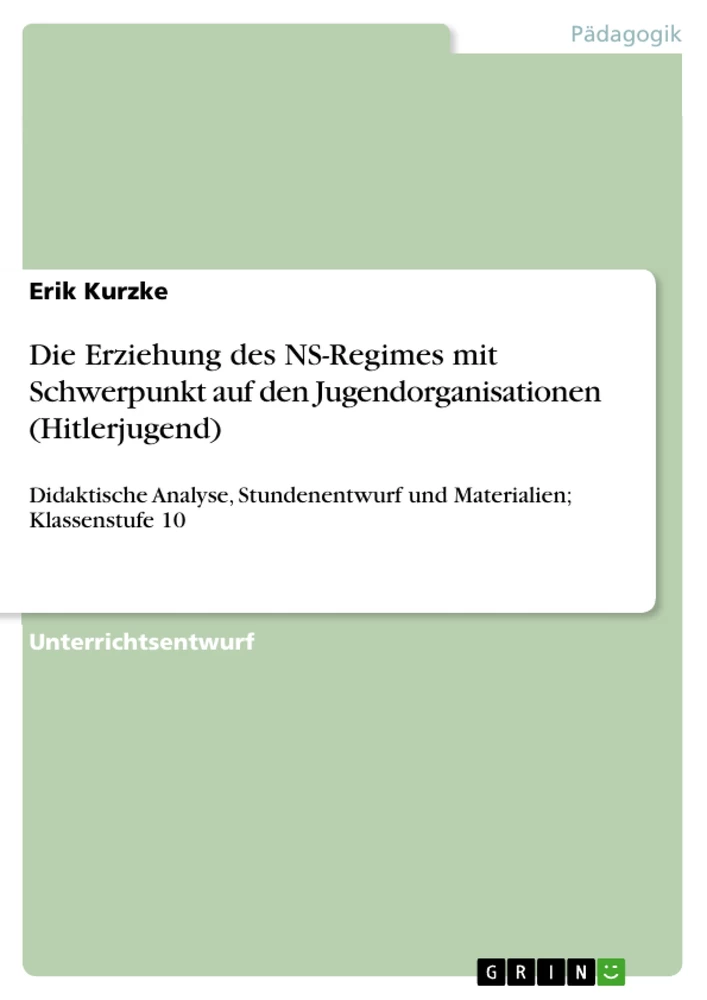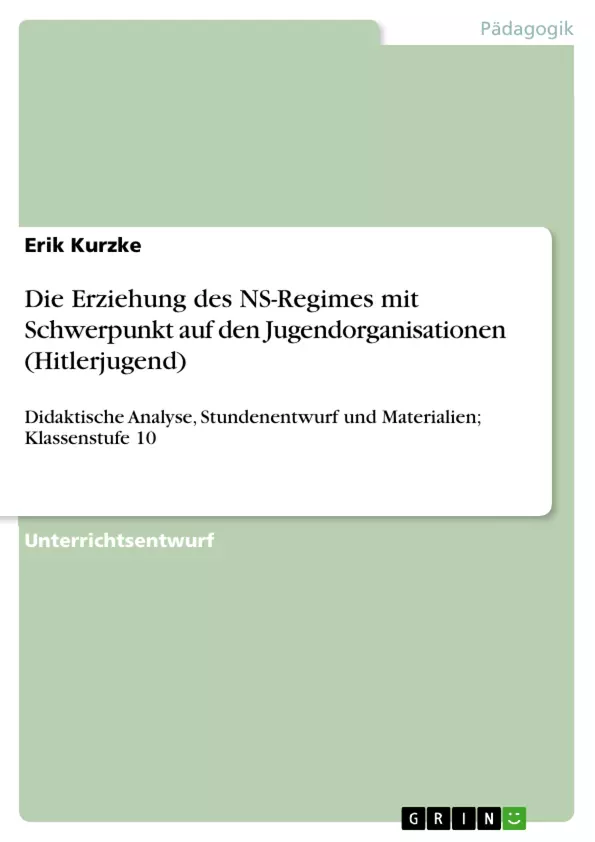1. Einleitung
Ende des Jahres 2009 arbeitete eine kleine Gruppe angehender Geschichtslehrer der Uni Greifswald an einer Schulpraktischen Übung am Gymnasium Grimmen. Sie hatten die Aufga-be, eine 10. Klasse zuerst im Unterricht beobachtend zu begleiten und danach selbst jeweils 45 Minuten zu unterrichten. Dies erforderte viel Vorbereitungszeit und einige Absprachen mit dem Fachdidaktiker und der zuständigen Lehrerin.
Der Themenkomplex, der behandelt werden sollte, war „Der Weg in den Krieg“, also die Jahre 1933-1939 in Deutschland. Dieser Weg sollte aus außenpolitischer, wirtschaftlicher, bildungs- und erziehungswissenschaftlicher (ideologischer) Sicht mit den Schülern erarbeitet werden.
Die Aufgabe von mir, Erik Kurzke, sollte es sein, die Erziehung des NS-Regimes mit Schwer-punkt auf den Jugendorganisationen (Hitlerjugend) zu behandeln. Die vorliegende Arbeit zeigt den Weg auf, wie sich Unterrichtsvorbereitungen darstellten, wie die Stunde an sich verlief und weist selbstkritisch auf einige Fehler aber auch positive Aspekte der Stunde hin.
Bevor man sich jedoch in den didaktischen Teil der Arbeit vertieft, sollte man einen kurzen Überblick über die Thematik „Jugendorganisationen des Dritten Reichs“ erhalten, um die didaktische Umsetzung und Reflexion überhaupt bewerten zu können. Diese Sachanalyse beschränkt sich auf wesentliche Inhalte, die auch im Unterricht vermittelt werden sollten. Im Anhang befinden sich Unterrichtsmaterialien, sowie der Ablauf mit den Teilzielen und Teilergebnissen der von mir konzipierten Stunde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Stundenziele
- Lehrziele
- Lernziele
- Begründung der methodischen Gestaltung
- Stundenziele
- Entwicklung der Stundenplanung und Durchführung
- Vergleich der letztgültigen Stundenplanung zum realen Ablauf
- Kritik und eigene Reflexion
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit reflektiert eine Schulpraktische Übung im Fach Geschichte am Gymnasium G, die sich mit dem Themenkomplex „Der Weg in den Krieg“ (1933-1939) auseinandersetzte. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die didaktische Analyse einer Unterrichtsstunde zum Thema „Erziehung im NS-Staat“ mit Schwerpunkt auf der Hitlerjugend. Die Arbeit beleuchtet die Vorbereitung, Durchführung und Reflexion der Unterrichtsstunde und analysiert die Sachthematik der Hitlerjugend im Kontext der nationalsozialistischen Erziehung.
- Die Bedeutung der nationalsozialistischen Erziehung im NS-Staat
- Die Rolle der Jugendorganisationen, insbesondere der Hitlerjugend, in der nationalsozialistischen Erziehung
- Die Ziele und Methoden der Erziehung in der Hitlerjugend
- Die Funktionsweise und Struktur der Hitlerjugend als Organisation
- Die Rolle der Hitlerjugend in der Vorbereitung auf den Krieg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Schulpraktischen Übung und den Fokus der Arbeit auf die Unterrichtsstunde zur Hitlerjugend dar. Die Sachanalyse beleuchtet die Bedeutung der Erziehung im NS-Staat und die Rolle der Jugendorganisationen, insbesondere der Hitlerjugend, in der nationalsozialistischen Indoktrination. Hierbei werden die Ziele, Methoden und die Struktur der Hitlerjugend sowie ihre Bedeutung in der Vorbereitung auf den Krieg behandelt. Die didaktische Analyse beinhaltet die Darstellung der Stundenziele, die Begründung der methodischen Gestaltung und die Entwicklung der Stundenplanung. Abschließend werden die Durchführung und die Reflexion der Unterrichtsstunde analysiert, wobei die Stundenplanung mit dem realen Ablauf verglichen und sowohl positive als auch negative Aspekte der Stunde beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen der nationalsozialistischen Erziehung, der Hitlerjugend, der Jugendorganisationen, der Indoktrination, der Kriegsvorbereitung, der Schulpraktischen Übung, der Unterrichtsplanung und der Unterrichtsreflexion.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte die Hitlerjugend (HJ) im NS-Staat?
Die HJ war das zentrale Instrument zur ideologischen Indoktrination und Erziehung der Jugend im Sinne des Nationalsozialismus.
Was waren die Hauptziele der nationalsozialistischen Erziehung?
Ziele waren die Formung „volksgemeinschaftlicher“ Gesinnung, körperliche Ertüchtigung und die Vorbereitung auf den Kriegsdienst.
Wie war die Hitlerjugend strukturiert?
Die HJ war hierarchisch organisiert und umfasste verschiedene Altersgruppen, wie das Jungvolk für die Jüngeren und den BDM für Mädchen.
Was ist das Thema der didaktischen Analyse in dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Vorbereitung und Durchführung einer Geschichtsstunde zum Thema „Erziehung im NS-Staat“ an einem Gymnasium.
Warum war die Erziehung für das NS-Regime so wichtig?
Durch die Kontrolle über die Jugend wollte das Regime seine Macht langfristig sichern und die nächste Generation bedingungslos an die Ideologie binden.
Welche Methoden wurden in der HJ zur Indoktrination genutzt?
Neben Appellen und Lagern wurden Sport, Geländespiele und paramilitärische Übungen eingesetzt, um Gehorsam und Disziplin zu drillen.
- Quote paper
- Erik Kurzke (Author), 2010, Die Erziehung des NS-Regimes mit Schwerpunkt auf den Jugendorganisationen (Hitlerjugend) , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/161280