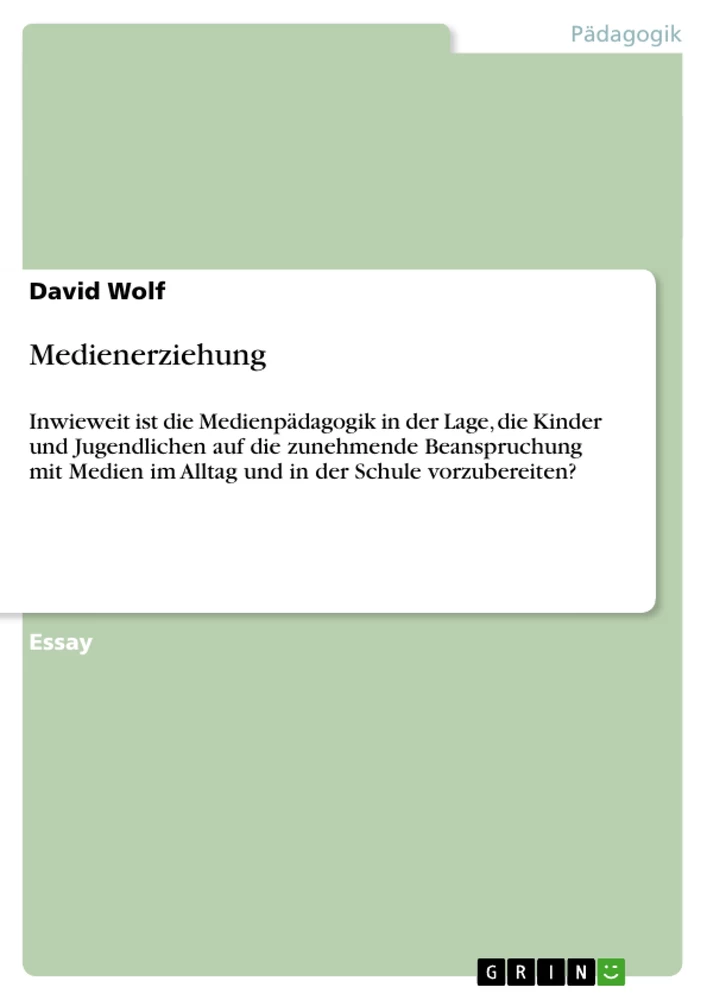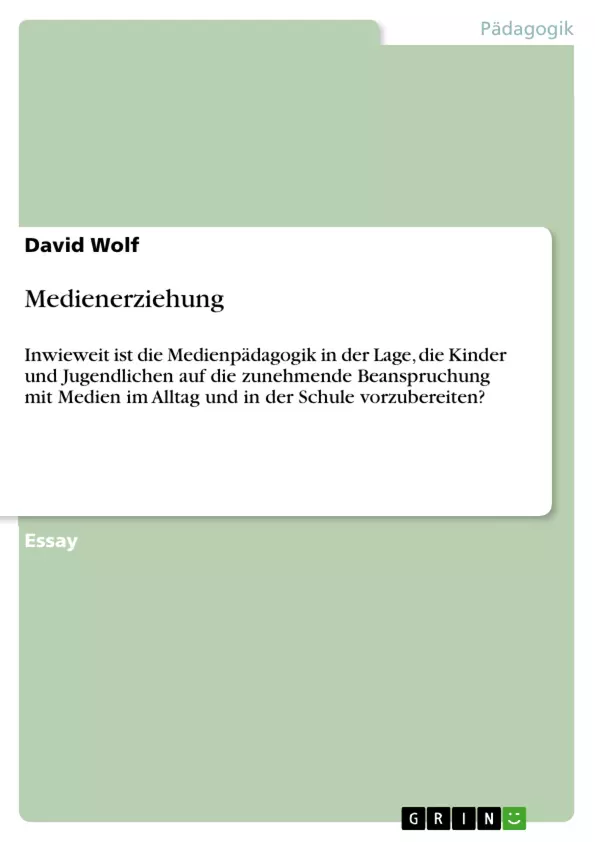Medienpädagogik, als Forschungsdisziplin der Erziehungswissenschaft, stellt sich die Frage nach dem Beitrag der Medien zur Erziehung, Bildung sowie Sozialisation - in diesem Falle speziell – Jugendlicher und Kinder und welchen Beitrag die Pädagogik zu leisten im Stande ist.
Zunächst lässt sich feststellen, dass Medien in der Öffentlichkeit einem Generalverdacht ausgesetzt sind, das Aggressionsverhalten negativ zu beeinflussen, wobei zu konstatieren ist, dass Medien negative Auswirkungen auf Menschen haben können, jedoch nicht von einem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang ausgegangen werden kann ...
Inhaltsverzeichnis
- Ausgehend davon, dass die Begriffe Alltag und Schule den Begriffen Bildung, Erziehung und Sozialisation zuzuordnen sind, so sind diese zunächst für den Kontext der Medienpädagogik zu bestimmen.
- Der Medienpädagogik, als Forschungsdisziplin der Erziehungswissenschaft, und auf die Fragestellung bezogen, stellt sich die Frage nach dem Beitrag der Medien zur Erziehung, Bildung sowie Sozialisation - in diesem Falle speziell - Jugendlicher und Kinder und welchen Beitrag die Pädagogik zu leisten im Stande ist.
- Die Studienergebnisse von KIM und JIM 2008 zeigen deutlich, dass das Interesse der Kinder und Jugendlichen und somit die Verbreitung an Medien stetig wächst.
- Seit den 1980er Jahren ist die Medienpädagogik dank der Reformpädagogik von mehreren erfolgreichen Modellversuchen der Emanzipation geprägt.
- Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Kinder und Jugendliche ein großes Interesse an Medien haben und sich interessengeleitet in allen Medien bewegen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz befasst sich mit der Frage, inwiefern die Medienpädagogik Kinder und Jugendliche auf den zunehmenden Medienkonsum im Alltag und in der Schule vorbereiten kann. Er analysiert die Rolle der Medien in Bezug auf Bildung, Erziehung und Sozialisation und untersucht, welchen Beitrag die Medienpädagogik leisten kann, um eine aktive und verantwortungsvolle Mediennutzung zu fördern.
- Definition von Bildung, Erziehung und Sozialisation im Kontext der Medienpädagogik
- Der Beitrag der Medien zur Bildung, Erziehung und Sozialisation von Kindern und Jugendlichen
- Die Entwicklung von Medienkompetenz durch funktionale und aktiv partizipatorische Erziehung
- Die Bedeutung der Medienpädagogik als Bewahrpädagogik und Emanzipationspädagogik
- Die Rolle von Eltern, Schule und Staat in der Medienerziehung
Zusammenfassung der Kapitel
- Der erste Abschnitt definiert die Begriffe Bildung, Erziehung und Sozialisation und setzt sie in Beziehung zur Medienpädagogik. Bildung wird im Sinne Humboldts als Auseinandersetzung des Individuums mit seiner Umwelt verstanden, während Sozialisation den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung in Abhängigkeit von der gesellschaftlichen Umwelt beschreibt. Erziehung wird als die Vermittlung von Mündigkeit an Unmündige definiert und in intenzionale, funktionale und extensionale Erziehung unterschieden.
- Der zweite Abschnitt widmet sich der Rolle der Medien in Bezug auf Bildung, Erziehung und Sozialisation. Es wird festgestellt, dass Medien in der Öffentlichkeit oft einem Generalverdacht auf negative Auswirkungen auf das Aggressionsverhalten ausgesetzt sind. Die Medienpädagogik entwickelte sich lange Zeit als Bewahrpädagogik, um vor den negativen Einflüssen der Medien zu schützen. Der Aufsatz vertritt jedoch die Ansicht, dass Medienkompetenz durch funktionale und aktiv partizipatorische Erziehung gefördert werden kann, da der Kompetenzerwerb auf informellem Wege stattfindet und wesentlich zur Bildung eines Individuums beitragen kann.
- Der dritte Abschnitt beleuchtet die Studienergebnisse von KIM und JIM 2008, die deutlich zeigen, dass das Interesse der Kinder und Jugendlichen an Medien stetig wächst. Die Bedeutung von Internet, Fernsehen sowie Musik ist ungebrochen hoch und wächst in Bereichen weiter. Die Medienkompetenz, die Kenntnisse und medienpraktische Erfahrungen beinhaltet, steigt bei Kindern mit zunehmendem Alter. Die Interessenlage bei Kindern liegt dabei in den Bereichen Film und Fernsehen gefolgt von der Erstellung von Homepages, Radio- bzw. Zeitungsbeiträgen und Hörspielen. Der Aufsatz betont, dass die Auseinandersetzung der Kinder und Jugendlichen mit der medialen Umwelt trotz aller potentiellen Risiken und Gefahren zur Bildung der Kinder beitragen kann.
- Der vierte Abschnitt stellt die Entwicklung der Medienpädagogik seit den 1980er Jahren dar, die durch erfolgreiche Modellversuche der Emanzipation geprägt ist. Im Umgang mit dem Web 2.0 bedeutet dies beispielsweise den offenen Zugang zu Medieninhalten zu gewährleisten sowie partizipatorisch an der Entwicklung der Medien teilzuhaben. Der Aufsatz argumentiert, dass eine aktive Medienarbeit eine hohe Medienkompetenz voraussetzt, die durch eine Teilnahme am medialen Geschehen geprägt sein sollte. Eine Beurteilung der gewonnenen Informationen aus den Medien erfolgt auf Grundlage einer ausgebildeten Medienkompetenz.
Schlüsselwörter
Medienpädagogik, Bildung, Erziehung, Sozialisation, Medienkompetenz, Mediennutzung, Kinder, Jugendliche, Medienlandschaft, Internet, Web 2.0, Bewahrpädagogik, Emanzipation, Partizipation, Medienkritik, Dialog, Reflexion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Medienpädagogik?
Sie untersucht den Beitrag von Medien zur Erziehung, Bildung und Sozialisation und möchte Kinder und Jugendliche zu einem verantwortungsvollen Medienumgang befähigen.
Führen Medien zwangsläufig zu Aggression?
Obwohl Medien negative Auswirkungen haben können, gibt es laut der Arbeit keinen direkten Ursache-Wirkungs-Zusammenhang für aggressives Verhalten.
Was versteht man unter Medienkompetenz?
Medienkompetenz umfasst Kenntnisse, medienpraktische Erfahrungen und die Fähigkeit zur kritischen Reflexion medialer Inhalte.
Was sind die KIM- und JIM-Studien?
Regelmäßige Studien, die das Mediennutzungsverhalten von Kindern (KIM) und Jugendlichen (JIM) in Deutschland untersuchen.
Was ist der Unterschied zwischen Bewahrpädagogik und Emanzipationspädagogik?
Bewahrpädagogik will vor Medieneinflüssen schützen, während Emanzipationspädagogik die aktive Teilhabe und mündige Nutzung (z. B. Web 2.0) fördert.
- Arbeit zitieren
- David Wolf (Autor:in), 2009, Medienerziehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/162252