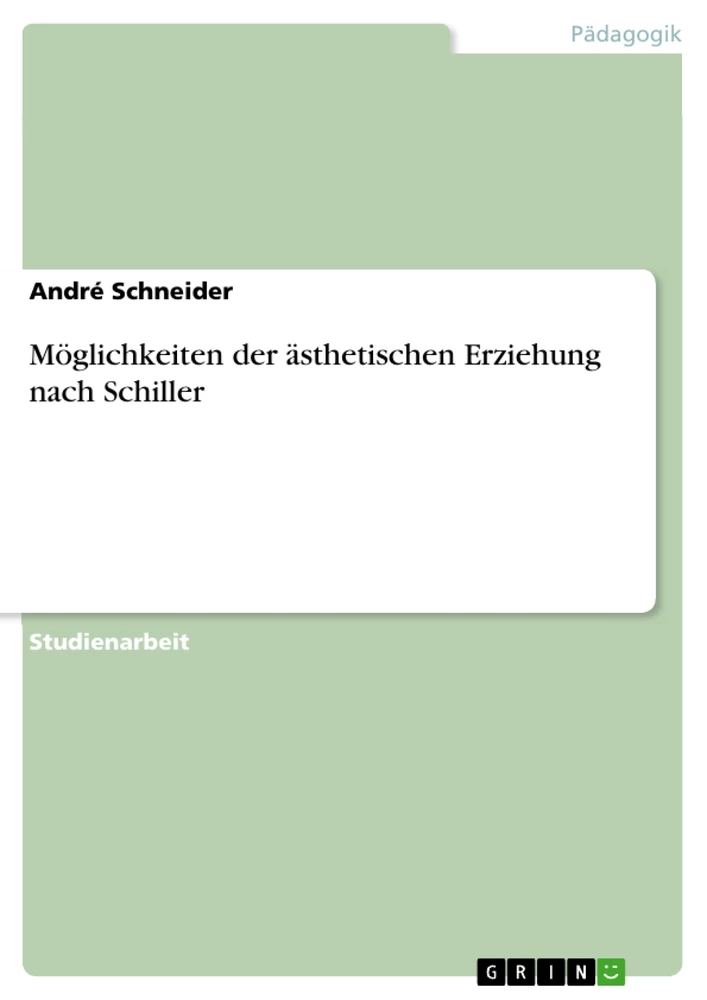Die philosophische Schrift „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“ von Friedrich Schiller sieht auf der Ebene der Geschichtlichkeit die Notwendigkeit der ästhetischen Rezeption, mit deren Hilfe allein der von Kant so genannte Vernunftstaat verwirklicht werden könne. Zunächst argumentiert Schiller auf der historischen Ebene, um dann auf dem Feld der Abstraktion seine Argumentation für die Bedeutung des ‚Spieltriebs’, der zwischen den beiden Kräften des sinnlichen und des Formtriebes anzusiedeln ist, auszuarbeiten. Es sei nicht möglich, die in zwei Gruppierungen zerfallene Gesellschaft in der Freiheit zu vereinen, wenn die Ästhetik nicht vermittelnd zwischen den beiden Haupttrieben des Menschen auftritt. Die Vertreterschaft der einen der beiden Gruppen, die dem sinnlichen Trieb verfallen sei, indem sie „keinen anderen Maßstab kenne als den des Wertes, sowie die Vertreter der anderen, die, nur Form und nicht Inhalte achtend, gefährdet seien, „alle Realität überhaupt zu vernachlässigen, und einer reizenden Einkleidung Wahrheit und Sittlichkeit aufzuopfern“- sie alle könnten durch die Ästhetik zu einer Ganzheitlichkeit des Menschseins geführt werden, die für Schiller Bedingung für die Wiederherstellung der ‚Totalität der Gattung’ sei.
Auf der Grundlage der historischen Annahmen Schillers wird weiterhin die historische Entwicklung gesellschaftlicher Arbeitsteilung und Spezialisierung in den Blick genommen, da Schillers Aussagen zum ‚verbruchstückhaften’ Menschen nicht nur zutreffend für die Anfänge der Industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts scheinen, sondern auch prophetisch in Hinsicht auf die sich seiner Zeit anschließende Ausformung der kapitalistischen Produktionsweise, in welcher der Mensch sich zunehmend der ‚Entfremdung’ ausgesetzt sieht, wie es in späterer Terminologie heißt.
Es werden weiterhin die heutigen Möglichkeiten der ästhetischen Erziehung in Schillers Sinn behandelt, wenn es sie denn überhaupt geben kann. Es liegt die Vermutung nahe, dass diese Möglichkeiten heute weniger als etwa gegen Ende des 18. Jahrhunderts bestehen, da die Entwicklung des menschlichen Daseins hin zu einer zunehmenden Zersplitterung seines Wesens in sämtlichen Bereichen zu führen scheint.
Zudem wird die Schlüssigkeit der Schiller’schen Abstraktion anhand der Forschungsliteratur überprüft, um dann Aussagen über die Brauchbarkeit der Theorie Schillers für die heutige pädagogische Praxis treffen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Möglichkeiten der ästhetischen Erziehung nach Schiller
- Der Entwurf Schillers
- Eine historisch-gesellschaftliche Bestandaufnahme: Zunahme von Arbeitsteilung und Spezialisierung
- Ästhetische Erziehung zweihundert Jahre nach Schiller
- Zusammenfassung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten der ästhetischen Erziehung nach Friedrich Schiller, insbesondere im Kontext der gesellschaftlichen Entwicklung und der Arbeitsteilung. Sie analysiert Schillers Konzept der ästhetischen Erziehung und seine Anwendung im 21. Jahrhundert.
- Das ästhetische Urteil nach Kant und Schiller
- Die Rolle der Kunst in der Gesellschaft
- Die Folgen von Arbeitsteilung und Spezialisierung für den Menschen
- Die Bedeutung der ästhetischen Erziehung für die Humanität
- Die Herausforderungen der ästhetischen Erziehung im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert Schillers Konzept der ästhetischen Erziehung im Kontext der historischen Entwicklung. Sie hebt die Notwendigkeit der ästhetischen Rezeption für die Verwirklichung des Vernunftstaates nach Kant hervor.
Möglichkeiten der ästhetischen Erziehung nach Schiller
Der Entwurf Schillers
Dieser Abschnitt beschreibt Schillers Konzept der ästhetischen Erziehung, das auf Kantischen Prinzipien basiert. Der Fokus liegt auf dem ästhetischen Urteil und seiner Rolle in der Gesellschaft. Schillers These der Freiheit der Kunst als Gegenpol zur „entstehenden bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft“ wird erläutert.
Eine historisch-gesellschaftliche Bestandaufnahme: Zunahme von Arbeitsteilung und Spezialisierung
Dieser Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung der Arbeitsteilung und Spezialisierung und deren Einfluss auf den Menschen. Schillers Aussagen zum „verbruchstückhaften“ Menschen werden in Bezug auf die Industrialisierung und die sich entwickelnde kapitalistische Produktionsweise gesetzt.
Ästhetische Erziehung zweihundert Jahre nach Schiller
Dieser Abschnitt untersucht die heutigen Möglichkeiten der ästhetischen Erziehung im Sinne Schillers. Die Vermutung, dass diese Möglichkeiten im Vergleich zum 18. Jahrhundert eingeschränkt sind, wird aufgrund der zunehmenden Zersplitterung des menschlichen Daseins aufgestellt.
Schlüsselwörter
Ästhetische Erziehung, Friedrich Schiller, Immanuel Kant, Arbeitsteilung, Spezialisierung, Kunst, Humanität, Gesellschaft, Vernunftstaat, Spieltrieb, Totalität der Gattung, Entfremdung, Kapitalismus, Industrielle Revolution.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Friedrich Schiller unter „ästhetischer Erziehung“?
Schiller sieht in der ästhetischen Erziehung ein Mittel, um den Menschen zur Ganzheitlichkeit zu führen und den „Vernunftstaat“ zu verwirklichen, indem sie zwischen sinnlichem Trieb und Formtrieb vermittelt.
Welche Rolle spielt der „Spieltrieb“ in Schillers Theorie?
Der Spieltrieb ist die vermittelnde Kraft zwischen dem Stofftrieb (Sinnlichkeit) und dem Formtrieb (Vernunft). Er ermöglicht dem Menschen die Erfahrung von Freiheit und wahrer Humanität.
Wie beeinflussen Arbeitsteilung und Spezialisierung das Menschenbild?
Schiller kritisiert, dass moderne Arbeitsteilung den Menschen „verbruchstückhaft“ macht und ihn von seinem wahren Wesen entfremdet – eine Beobachtung, die durch die industrielle Revolution und den Kapitalismus verstärkt wurde.
Ist Schillers Konzept heute noch relevant?
Die Arbeit untersucht die Brauchbarkeit der Theorie für die heutige pädagogische Praxis, stellt jedoch fest, dass die zunehmende Zersplitterung des modernen Daseins die Umsetzung erschwert.
Auf welche philosophischen Grundlagen stützt sich Schiller?
Schiller baut stark auf Immanuel Kants Begriff des ästhetischen Urteils auf, entwickelt diesen jedoch weiter, um gesellschaftliche und historische Probleme zu lösen.
- Arbeit zitieren
- André Schneider (Autor:in), 2006, Möglichkeiten der ästhetischen Erziehung nach Schiller, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/163988