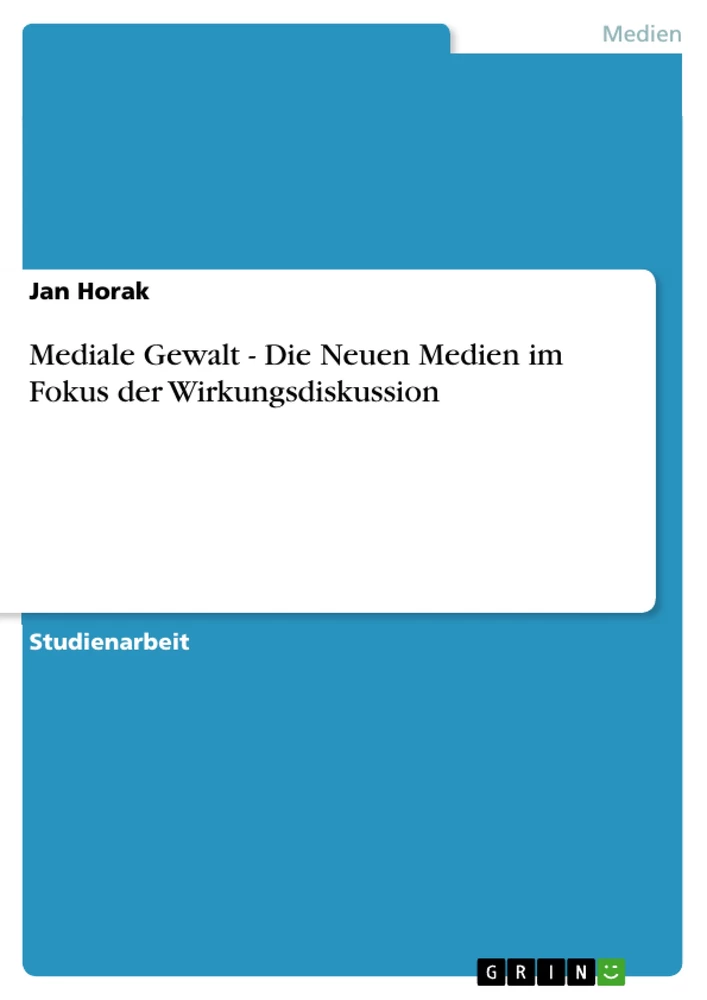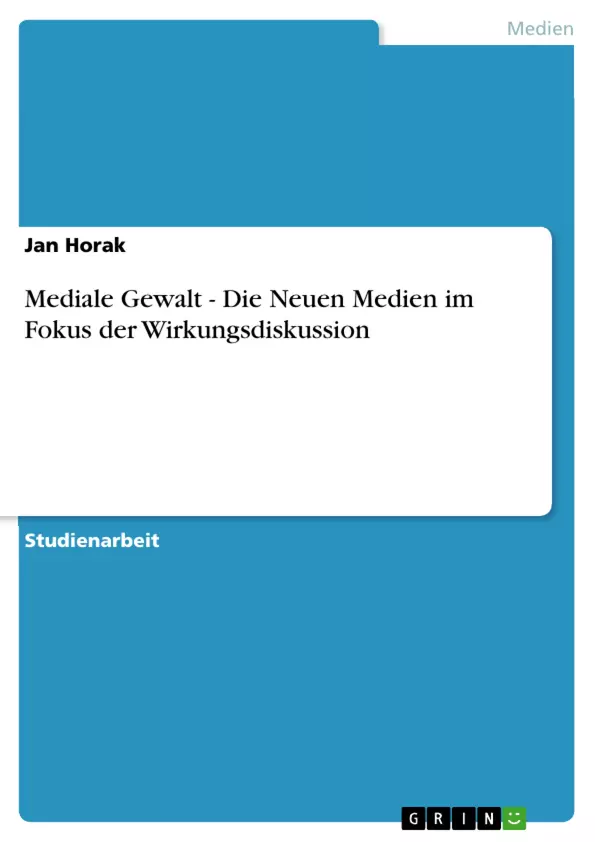Kaum ein kommunikationswissenschaftliches Forschungsgebiet wird in der Öffentlichkeit so
kontrovers diskutiert wie die Wirkung medialer Gewalt. Neu ist diese Debatte allerdings nicht
– so halten sich hartnäckig Berichte, nach Erscheinen des Romans „Die Leiden des jungen
Werther“ von Johann Wolfgang von Goethe im Jahr 1774 sei es unter jungen Männern zu
einer Häufung von Suizidfällen nach Werther-Vorbild gekommen. In der Folge wurde dem
Werk eine schädliche, zur unmittelbaren Nachahmung verleitende Wirkung unterstellt, die
auch unter dem Begriff „Werther-Effekt“ bekannt ist.
In der heutigen Zeit kommt es besonders in Bezug auf Gewaltdarstellungen in den
Neuen Medien immer wieder zu sehr emotional geführten Diskussionen. Aufgrund ihrer
wachsenden Bedeutung und ihrer umfassenden Durchdringung des Alltags stellen Computer
und Internet die Leitmedien des 21. Jahrhunderts dar. Diese Entwicklung macht auch vor
Kindern und Jugendlich nicht Halt, für viele ist der Computer zum
Hauptunterhaltungsmedium geworden – einschließlich aller möglicherweise jugendgefährdenden
Inhalte. Das Ziel dieser Arbeit ist es, einleitend das spezifische
Gefährdungspotential der Neuen Medien darzulegen und anschließend einen Überblick
sowohl über die öffentlich geführte Diskussion als auch den wissenschaftlichen Diskurs zum
Reizthema „Wirkung medialer Gewalt“ zu geben. Aufgrund des eng bemessenen Rahmens
erfolgt eine Beschränkung auf internetbasierte Angebote sowie gewalthaltige
Bildschirmspiele, da diese verstärkt im Fokus der Debatte um die Wirkungen medialer Gewalt
stehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung, Eingrenzung und Definitionen
- Charakteristika und Gefährdungspotentiale
- Öffentliche Diskussion und wissenschaftliche Auseinandersetzung
- Wirkungsthesen medialer Gewalt
- Nutzungsmotivationen Jugendlicher
- Jugendschutz und Prävention
- Der „Amoklauf von Erfurt“: Berichterstattung und Reaktionen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der medialen Gewalt im Kontext der Neuen Medien, insbesondere des Internets und gewalthaltiger Bildschirmspiele. Ziel ist es, das spezifische Gefährdungspotential dieser Medien darzulegen und einen Überblick über die öffentliche Diskussion sowie den wissenschaftlichen Diskurs zum Thema „Wirkung medialer Gewalt“ zu geben. Die Arbeit konzentriert sich auf internetbasierte Angebote und Bildschirmspiele, da diese verstärkt im Fokus der Debatte um die Wirkungen medialer Gewalt stehen.
- Das Gefährdungspotential der Neuen Medien
- Die öffentliche Diskussion um die Wirkung medialer Gewalt
- Der wissenschaftliche Diskurs zur Wirkung medialer Gewalt
- Spezifische Charakteristika von Internet und Bildschirmspielen
- Nutzungsmotivationen Jugendlicher
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einführung, Eingrenzung und Definitionen: Dieses Kapitel führt in das Thema medialer Gewalt ein und beleuchtet die kontroverse Debatte in der Öffentlichkeit. Es wird auf die historische Perspektive des „Werther-Effekts“ eingegangen und die spezifischen Herausforderungen der Neuen Medien im Kontext von Gewalt dargestellt. Die Arbeit definiert die Begriffe „Gewalt“ und „Medienwirkung“ im wissenschaftlichen Diskurs.
- Kapitel 2: Charakteristika und Gefährdungspotentiale: Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Charakteristika von Internet und Bildschirmspielen, die ein besonderes Gefährdungspotential bergen. Es wird die Interaktivität des Internets im Vergleich zu traditionellen Medien, die rasche Veränderung der Angebotsstruktur, die zunehmende Durchdringung des Alltags durch das Internet und die Eintauchmöglichkeiten von Bildschirmspielen beleuchtet.
- Kapitel 3: Öffentliche Diskussion und wissenschaftliche Auseinandersetzung: Dieses Kapitel untersucht die öffentliche Diskussion um die Wirkung medialer Gewalt. Es werden die Argumente von Politikern, Pädagogen und selbsternannten Experten analysiert und mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Thema verglichen. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede zwischen den öffentlichen und wissenschaftlichen Perspektiven auf mediale Gewalt.
- Kapitel 4: Wirkungsthesen medialer Gewalt: Dieses Kapitel widmet sich den verschiedenen Thesen zur Wirkung medialer Gewalt. Es werden die unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätze und Modelle zur Erklärung der Medienwirkung dargestellt. Die Arbeit befasst sich mit den verschiedenen Theorien und empirischen Befunden zur Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Medien.
- Kapitel 5: Nutzungsmotivationen Jugendlicher: Dieses Kapitel untersucht die Nutzungsmotivationen Jugendlicher im Kontext von Internet und Bildschirmspielen. Es werden die verschiedenen Faktoren beleuchtet, die die Nutzung von Medien durch Jugendliche beeinflussen. Die Arbeit analysiert die Ursachen und Folgen der Nutzung von gewalthaltigen Inhalten durch junge Menschen.
- Kapitel 6: Jugendschutz und Prävention: Dieses Kapitel behandelt die Themen Jugendschutz und Prävention im Kontext von medialer Gewalt. Es werden verschiedene Ansätze und Maßnahmen zur Eindämmung der negativen Auswirkungen von gewalthaltigen Medieninhalten auf Jugendliche diskutiert. Die Arbeit analysiert die Rolle von Eltern, Schule und Gesellschaft im Bereich der Medienpädagogik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen mediale Gewalt, Neue Medien, Internet, Bildschirmspiele, Gefährdungspotential, öffentliche Diskussion, wissenschaftlicher Diskurs, Wirkungsthesen, Nutzungsmotivationen, Jugendschutz, Prävention.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem 'Werther-Effekt'?
Der Werther-Effekt beschreibt die Nachahmung von Suiziden nach medialen Vorbildern, benannt nach Goethes Roman aus dem Jahr 1774.
Welches Gefährdungspotential bieten Neue Medien für Jugendliche?
Durch Interaktivität, rasche Verfügbarkeit und immersive Bildschirmspiele können Neue Medien eine stärkere Wirkung auf das Verhalten von Jugendlichen ausüben.
Wie wird mediale Gewalt wissenschaftlich diskutiert?
Wissenschaftler untersuchen verschiedene Wirkungsthesen, um zu klären, ob und wie gewalthaltige Inhalte Aggressionen fördern oder abstumpfend wirken.
Welche Rolle spielt der Jugendschutz im Internet?
Jugendschutz und Prävention zielen darauf ab, negative Auswirkungen durch Medienpädagogik und gesetzliche Regelungen einzudämmen.
Warum nutzen Jugendliche gewalthaltige Bildschirmspiele?
Die Forschung untersucht Nutzungsmotivationen, die von Unterhaltung über Wettbewerb bis hin zur Bewältigung von Alltagsstress reichen können.
- Citation du texte
- Jan Horak (Auteur), 2009, Mediale Gewalt - Die Neuen Medien im Fokus der Wirkungsdiskussion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164910