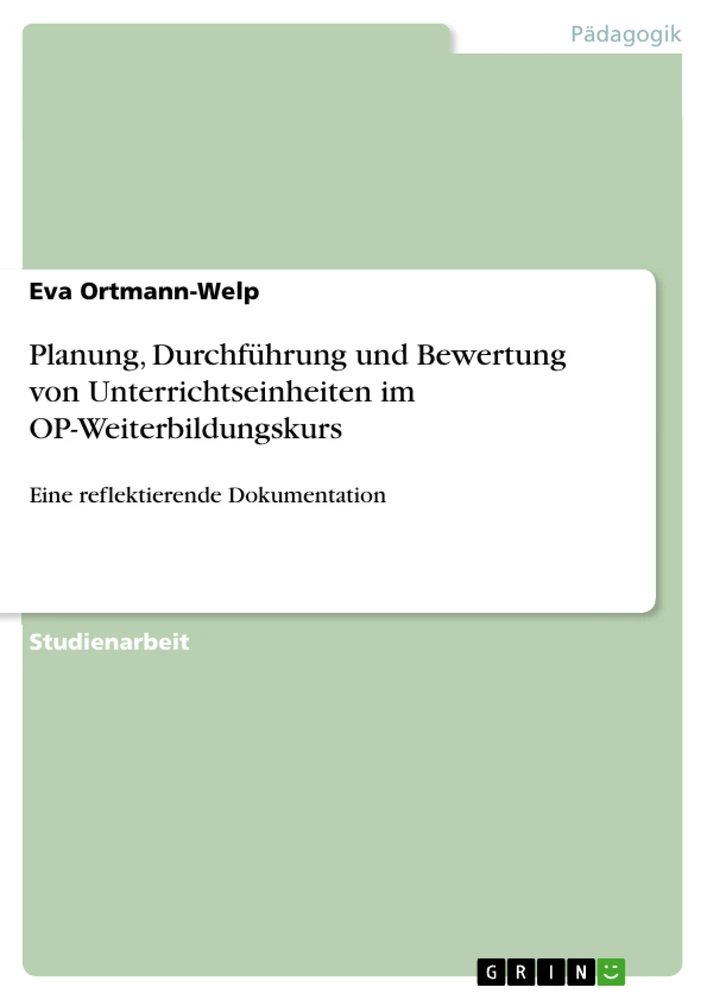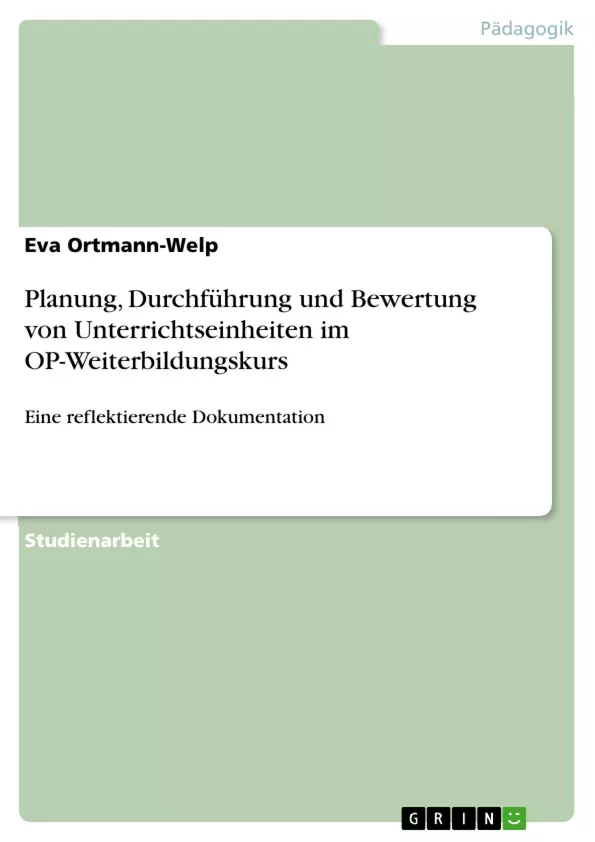Die vorliegende Reflektierende Dokumentation beschreibt das bildungspraktische Handeln bei der Planung, Durchführung und Bewertung des Projekts „Unterrichtseinheiten im Weiterbildungskurs Operationsdienst“ einschließlich der hierüber stattgefundenen Reflektion.
Das Projekt wurde als Praktikum für das Modul 3B „Praxis der
Mediendidaktik“ im Bachelor- Studiengang Bildungswissenschaft durchgeführt.
Die Reflektierende Dokumentation darf allerdings nicht nur als ein
beschreibender Praktikumsbericht verstanden werden. In den Mittelpunkt werden bildungswissenschaftlichen Theorien und Modelle gerückt, so dass eine Reflektion über das Zusammenspiel von Theorie und Praxis erfolgen kann.
Da es sich hierbei um ein definiertes, zeitlich begrenztes Projekt nach DIN 69901 handelt, wird die Gliederung der Reflektierenden Dokumentation nach den Punkten des Projektphasenmodells vorgenommen. (Definition, Planung, Durchführung und Abschluss/ Bewertung) (Kollmeier, 2005- 2008)
Zuerst wird das Projekt mit der Aufgabenstellung, der Zielsetzung und den organisatorischen Rahmenbedingungen vorgestellt und definiert.
Bei der Planung des Projekts werden die theoretischen Überlegungen erläutert, die didaktischen Theorien, die als Handlungsorientierung dienten, vorgestellt wie auch die Wahl der Methodenkonzepte begründet.
Die praktische Durchführung wird kurz beschrieben und es wird auf
Herausforderungen, die für ein Abweichen der geplanten Durchführung
sorgten, eingegangen.
Die Bewertung des Projekts wird ebenso vor dem Hintergrund
bildungswissenschaftlicher Grundlagen dargelegt.
Am Ende erfolgt eine Reflektion des bildungspraktischen Handelns. Betont wird hierbei die Bedeutung von reflexiven Kompetenzen von Lehrenden für den Aufbau einer professionellen, didaktischen Kompetenz.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Darstellung des Projekts
- 2.1 Die Projektaufgabe und Zielsetzung
- 2.2 Die organisatorischen Rahmenbedingungen
- 3. Planung des Projekts
- 3.1 Bildungswissenschaftliche Grundlagen als Orientierung
- 3.2 Wahl der Methodenkonzepte
- 4. Durchführung des Projekts
- 5. Abschluss und Bewertung des Projekts
- 5.1 Theoretische Überlegungen zu Qualitätssicherung und Evaluation
- 5.2 Die Bewertung des Projekts
- 5.3 Die Erkenntnisgewinnung
- 6. Reflexion über professionelles Handeln im Spannungsfeld von Theorie und Praxis
- 7. Eigene Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Dokumentation analysiert die Planung, Durchführung und Bewertung einer Unterrichtseinheit in einem OP-Weiterbildungskurs. Der Text betrachtet die Rolle der Mediendidaktik in diesem Kontext und untersucht, wie bildungswissenschaftliche Theorien und Modelle in die Praxis umgesetzt werden können.
- Die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz bei Weiterbildungsteilnehmern
- Die Anwendung von Methodenkonzepten im OP-Weiterbildungskurs
- Die Rolle der Evaluation und Qualitätssicherung in der Praxis
- Die Reflexion über professionelles Handeln im Spannungsfeld von Theorie und Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Reflektierende Dokumentation vor und skizziert die Themenstellung und die Struktur der Arbeit. Das zweite Kapitel beschreibt das Projekt „Unterrichtseinheiten im OP-Weiterbildungskurs“ in Detail. Es beleuchtet die Projektaufgabe, die Zielsetzung und die organisatorischen Rahmenbedingungen.
Im dritten Kapitel werden die Planungsphasen des Projekts erläutert. Die Bildungswissenschaftlichen Grundlagen werden vorgestellt, die als Orientierung für die didaktische Vorgehensweise dienen. Darüber hinaus wird die Wahl der Methodenkonzepte begründet.
Das vierte Kapitel widmet sich der Durchführung des Projekts.
Das fünfte Kapitel behandelt die Bewertung des Projekts.
Schlüsselwörter
Berufliche Handlungskompetenz, Mediendidaktik, OP-Weiterbildungskurs, Unterrichtseinheit, Evaluation, Qualitätssicherung, Reflexion, Theorie und Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des beschriebenen Projekts im OP-Weiterbildungskurs?
Das Ziel war die Planung, Durchführung und Bewertung von Unterrichtseinheiten, um die berufliche Handlungskompetenz der Teilnehmer im Operationsdienst zu fördern.
Welche Rolle spielt die Mediendidaktik in dieser Dokumentation?
Das Projekt wurde als Praktikum für das Modul „Praxis der Mediendidaktik“ durchgeführt und untersucht, wie mediale Konzepte den Lernprozess in der Weiterbildung unterstützen können.
Nach welchem Modell ist die Dokumentation gegliedert?
Die Gliederung folgt dem Projektphasenmodell nach DIN 69901, unterteilt in Definition, Planung, Durchführung sowie Abschluss und Bewertung.
Was wird unter reflexiver Kompetenz der Lehrenden verstanden?
Es handelt sich um die Fähigkeit, das eigene bildungspraktische Handeln im Spannungsfeld von Theorie und Praxis kritisch zu hinterfragen, um eine professionelle didaktische Kompetenz aufzubauen.
Wie wird die Qualität des Projekts gesichert?
Die Qualitätssicherung erfolgt durch theoretische Überlegungen zur Evaluation und eine abschließende Bewertung des Projekts vor dem Hintergrund bildungswissenschaftlicher Grundlagen.
- Arbeit zitieren
- Eva Ortmann-Welp (Autor:in), 2010, Planung, Durchführung und Bewertung von Unterrichtseinheiten im OP-Weiterbildungskurs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/164933