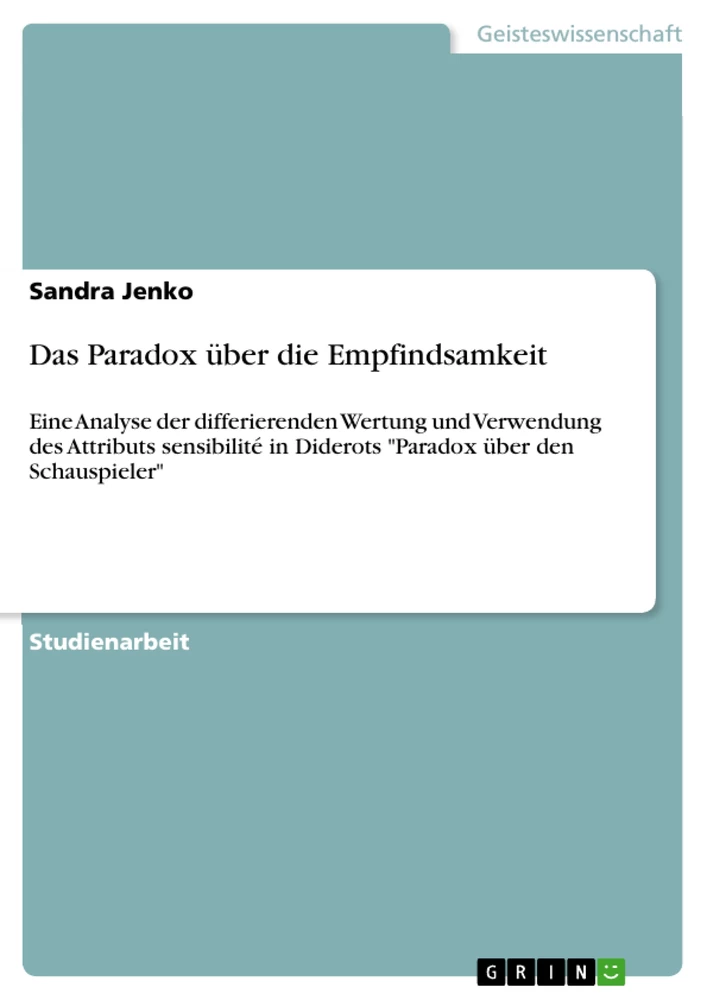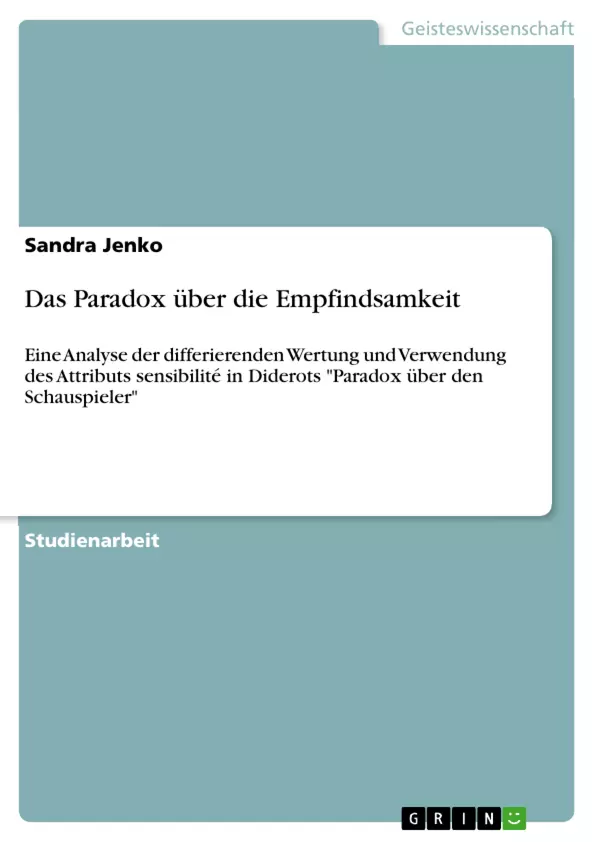Als Grundlage für die Auseinandersetzung mit den Empfindsamkeitsvorstellungen betrachte ich zum einen Diderots Definition des wahren Schauspielers im Vergleich mit den anderen im Paradox dargestellten Schauspielertypen und zum anderen sein Verständnis von Kunst und Natur sowie deren Wechselbeziehung auf der Bühne. Der zentrale Themenpunkt "Zeitkrankheit der sensibilité" behandelt Diderots Kritikpunkte an der Empfindsamkeit sowohl künstlerische als auch körperliche Aspekte betreffend. Darauf folgend gilt es zu beweisen, dass die Empfindsamkeit im Paradox nicht bloß negativ gewertet wird, sondern als ein notwendiges Übel betrachtet werden könnte. So konträr, wie meine bisherigen Themenpunkte waren, scheint auch Diderots "Paradox über den Schauspieler" zu sein, was am Ende der Arbeit genauer beleuchtet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der „wahre“ Schauspielertypus
- 2. Die „Un-Natur“ der Kunst
- 3. Die Zeitkrankheit der sensibilité
- 4. Empfindsamkeit – (k)ein rein negatives Attribut
- 5. Das Paradoxe am Paradox
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Diderots "Paradox über den Schauspieler" im Hinblick auf dessen vielschichtigen Umgang mit dem Begriff "sensibilité". Die Arbeit untersucht, wie Diderot den Begriff der Empfindsamkeit in seiner Schauspieltheorie verwendet und bewertet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und dem Wandel des Empfindsamkeitsverständnisses im 18. Jahrhundert, reflektiert anhand Diderots Werk.
- Diderots Definition des "wahren" Schauspielers im Vergleich zu anderen Typen
- Das Verhältnis von Kunst und Natur in Diderots Schauspieltheorie
- Diderots Kritik an der Empfindsamkeit ("Zeitkrankheit der sensibilité")
- Die ambivalente Bewertung der Empfindsamkeit im Paradox
- Das Paradoxon in Diderots Argumentation bezüglich der Empfindsamkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und begründet die Wahl des "Paradox über den Schauspieler" als Fallbeispiel für die Analyse des vielschichtigen Begriffs der "sensibilité" bei Diderot. Sie erläutert die Bedeutung der Empfindsamkeit in Diderots kunsttheoretischem Verständnis und deren Relevanz für seine Schauspieltheorie. Die Arbeit betrachtet Diderots Verständnis von Sensibilité als stellvertretend für die Entwicklung der Empfindsamkeit im 18. Jahrhundert.
1. Der „wahre“ Schauspielertypus: Diderot unterscheidet drei Schauspielertypen: den nachahmenden, den Naturschauspieler und den erhabenen Schauspieler. Das zentrale Kriterium der Unterscheidung ist die Empfindsamkeit. Der nachahmende Schauspieler wird nur kurz erwähnt. Der Naturschauspieler, der sich mit seinen Emotionen identifiziert, wird als mittelmäßig bewertet, da sein Spiel uneinheitlich und von der momentanen Gefühlslage abhängig ist. Der ideale, erhabene Schauspieler hingegen ist emotionslos, berechnend und verständig. Sein Spiel basiert auf Beobachtung und Einstudierung, ist wiederholbar und gleichbleibend. Diderot betont die Notwendigkeit von Urteilskraft und kühlem Beobachtungsvermögen, nicht aber Empfindsamkeit, für den idealen Schauspieler. Der ideale Schauspieler sollte zudem charakterlos sein, um nicht durch seine eigene Persönlichkeit beeinträchtigt zu werden.
2. Die „Un-Natur“ der Kunst: Dieses Kapitel würde die Diderotsche Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld zwischen Kunst und Natur im Schauspiel beleuchten. Es würde seine Argumentation analysieren, wie der Schauspieler scheinbar "unnatürliche" Leistungen durch verstandesgesteuerte Beobachtung und Interpretation erreicht, um dennoch überzeugende und emotionale Darstellungen zu liefern. Die Verbindung zur Empfindsamkeit würde darin bestehen, dass die "natürliche" emotionale Ausprägung des Schauspielers unterdrückt werden muss, um die Kunstfertigkeit zu erreichen.
3. Die Zeitkrankheit der sensibilité: Dieses Kapitel würde Diderots Kritik an der übermäßigen oder ungezügelten Empfindsamkeit seiner Zeit behandeln. Die "Zeitkrankheit" würde als ein gesellschaftliches und künstlerisches Phänomen dargestellt, welches Diderot ablehnt und mit seinen Argumenten im Paradox konterkariert. Seine Kritikpunkte, sowohl künstlerisch als auch körperlich, würden im Detail analysiert werden. Es würde gezeigt werden, wie diese Kritik in seine Schauspieltheorie einfließt und wie sie mit der Bewertung der verschiedenen Schauspielertypen zusammenhängt.
4. Empfindsamkeit – (k)ein rein negatives Attribut: Dieses Kapitel würde die ambivalente Wertung der Empfindsamkeit bei Diderot untersuchen. Es würde argumentieren, dass Diderot die Empfindsamkeit nicht völlig ablehnt, sondern sie als ein notwendiges Übel oder zumindest als ein Aspekt des menschlichen Wesens betrachtet, der im Schauspiel zu kontrollieren und zu bändigen ist. Hier würde die Argumentation zeigen, wie der scheinbar paradoxe Standpunkt Diderots im Kontext seiner Schauspieltheorie zu verstehen ist. Die Diskussion um den "natürlichen" Schauspieler und seine Grenzen würde nochmals aufgegriffen werden.
5. Das Paradoxe am Paradox: Dieses Kapitel würde die scheinbar widersprüchlichen Aspekte in Diderots Argumentation zum Thema Empfindsamkeit analysieren. Die "Paradoxie" des Titels würde im Zentrum der Betrachtung stehen. Es würde die Spannung zwischen der Forderung nach einem emotionslosen, verstandesgesteuerten Schauspiel und der Notwendigkeit, Emotionen beim Zuschauer hervorzurufen, analysiert werden. Es würde die Kernargumente des Paradoxons und die scheinbaren Widersprüche in Diderots Position zusammenfassend erläutert und auf ihren Wert hingewiesen werden.
Schlüsselwörter
Sensibilité, Diderot, Paradox über den Schauspieler, Schauspielkunst, Schauspieltheorie, Kunst und Natur, Emotionen, Verstand, Empfindsamkeit, Ideal Schauspieler, Naturschauspieler, comédien de nature, comédien d'imitation.
Häufig gestellte Fragen zu Diderots "Paradox über den Schauspieler"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Diderots "Paradox über den Schauspieler" und konzentriert sich dabei auf dessen vielschichtigen Umgang mit dem Begriff "sensibilité" (Empfindsamkeit). Die Arbeit untersucht, wie Diderot Empfindsamkeit in seiner Schauspieltheorie verwendet und bewertet und betrachtet dies im Kontext der Entwicklung des Empfindsamkeitsverständnisses im 18. Jahrhundert.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Diderots Definition des "wahren" Schauspielers im Vergleich zu anderen Typen (nachahmender, Naturschauspieler, erhabener Schauspieler); das Verhältnis von Kunst und Natur in Diderots Schauspieltheorie; Diderots Kritik an der Empfindsamkeit ("Zeitkrankheit der sensibilité"); die ambivalente Bewertung der Empfindsamkeit im Paradox; und das Paradoxon in Diderots Argumentation bezüglich der Empfindsamkeit.
Welche Schauspielertypen unterscheidet Diderot?
Diderot unterscheidet drei Schauspielertypen: den nachahmenden Schauspieler, den Naturschauspieler und den erhabenen Schauspieler. Der ideale, erhabene Schauspieler ist emotionslos, berechnend und verständig, im Gegensatz zum Naturschauspieler, der sich mit seinen Emotionen identifiziert und dessen Spiel daher uneinheitlich ist.
Wie bewertet Diderot die Empfindsamkeit?
Diderots Bewertung der Empfindsamkeit ist ambivalent. Er kritisiert die übermäßige oder ungezügelte Empfindsamkeit seiner Zeit ("Zeitkrankheit der sensibilité"), betrachtet sie aber gleichzeitig als Aspekt des menschlichen Wesens, der im Schauspiel zu kontrollieren und zu bändigen ist. Für den idealen Schauspieler ist Empfindsamkeit nicht notwendig, eher hinderlich.
Was ist das zentrale Paradox in Diderots Argumentation?
Das zentrale Paradox liegt in der Spannung zwischen der Forderung nach einem emotionslosen, verstandesgesteuerten Schauspiel und der Notwendigkeit, Emotionen beim Zuschauer hervorzurufen. Diderot argumentiert, dass der ideale Schauspieler, um authentisch zu wirken, seine eigenen Emotionen unterdrücken muss.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, fünf Hauptkapitel (1. Der „wahre“ Schauspielertypus; 2. Die „Un-Natur“ der Kunst; 3. Die Zeitkrankheit der sensibilité; 4. Empfindsamkeit – (k)ein rein negatives Attribut; 5. Das Paradoxe am Paradox) und ein Resümee.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Sensibilité, Diderot, Paradox über den Schauspieler, Schauspielkunst, Schauspieltheorie, Kunst und Natur, Emotionen, Verstand, Empfindsamkeit, Ideal Schauspieler, Naturschauspieler, comédien de nature, comédien d'imitation.
Wo finde ich weitere Informationen zu Diderots "Paradox über den Schauspieler"?
Weitere Informationen finden Sie in der Literatur zum 18. Jahrhundert, zur französischen Aufklärung und zu Diderots Werk. Spezifische Fachliteratur zur Schauspieltheorie und zum Begriff der Sensibilité bietet tiefergehende Einblicke.
- Quote paper
- Mag. Sandra Jenko (Author), 2002, Das Paradox über die Empfindsamkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166129