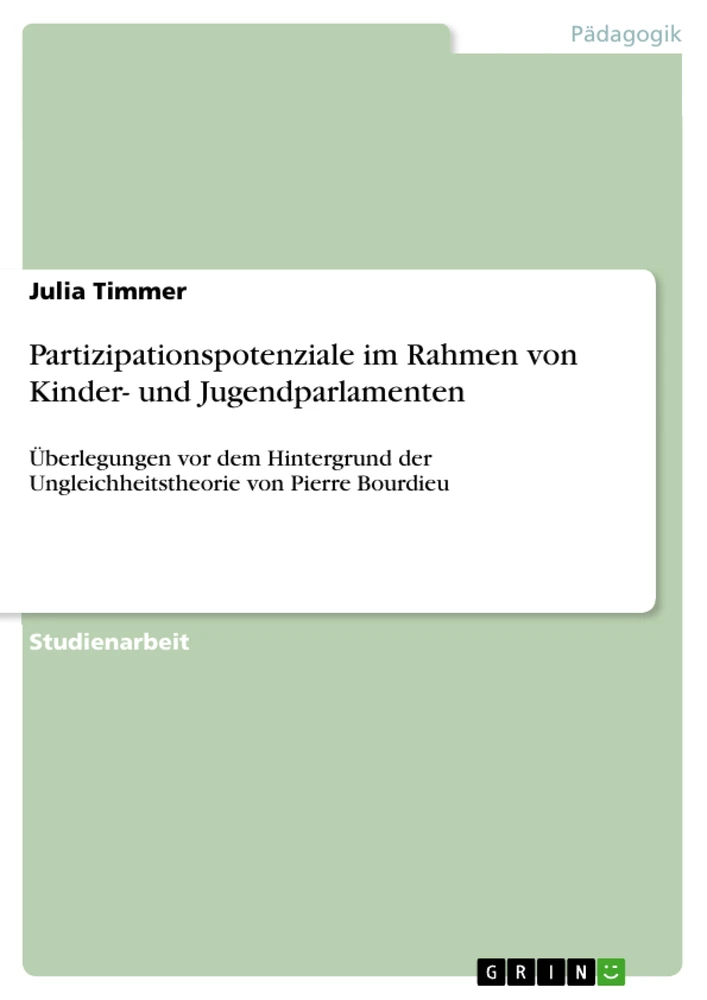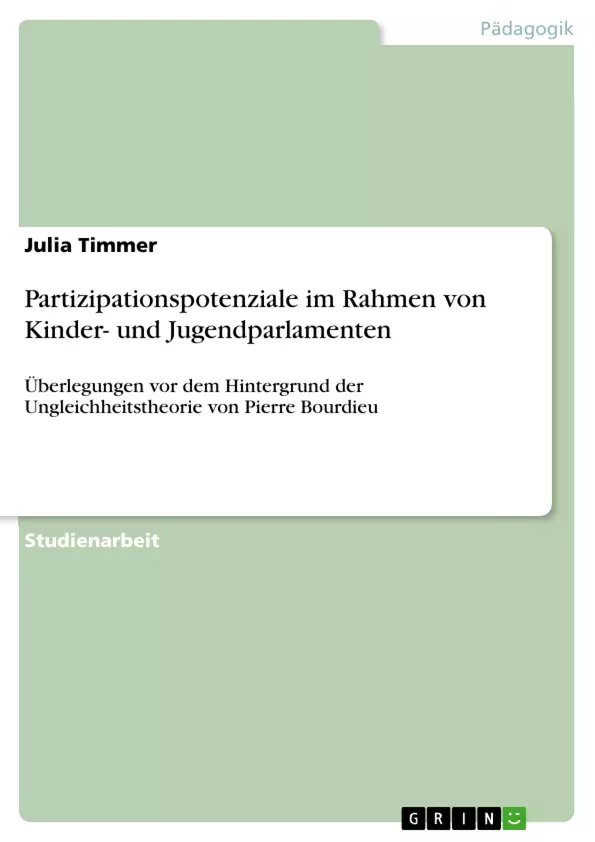Von verschiedenen Seiten wird dazu gedrängt sich mit dem Thema der Kinder- und Jugendpartizipation auseinander zusetzten. Ziel ist eine Mitwirkung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungen, da sie die Generation ist, welche die gegenwärtigen politischen Entscheidungen in der Zukunft tragen muss. Des Weiteren wird durch eben diese Teilhabe dazu beigetragen, dass Jugendliche langsam politische Verantwortung übernehmen und Handlungskompetenzen erwerben. Hier stellen sich jedoch die Fragen, wer diese Jugendlichen denn sind, denen Beteiligungsangebote dargelegt werden und ob es in der Realität möglich ist, schichtunabhängig allen Kindern und Jugendlichen gleiche Partizipationsmöglichkeiten zu gewähren.
Hierzu werde ich zunächst den Partizipationsbegriff näher erläutern, um daran anschließend Leitlinien und weitere Vorraussetzungen für eine erfolgreiche Partizipation zu beschreiben. Im Anschluss erläutere ich eine gezielte Möglichkeit der Partizipation in Form von Kinder- und Jugendparlamenten und analysiere deren Zusammensetzungen. Diese Analyse dient dazu herauszufinden, ob die im Vorfeld genannten Leitlinien einer erfolgreichen Partizipation in dieser bestimmten Form der Beteiligung gewährleistet sind. Hierzu gehe ich auf die Ungleichheitstheorie des französischen Soziologen Pierre Boudieu ein und erläutere seine Sozialraum- und Habitustheorie, in welcher er das zustande kommen sozialer Ungleichheit thematisiert. Daraufhin werde ich diese Theoriebausteine dazu verwenden, um zu erläutern, aus welchen Gründen manche Menschen sich den Partizipationsangeboten entziehen bzw. für diese gar nicht empfänglich zu sein scheinen. Den Abschluss bildet das Fazit, in welchem ich die zuvor gewonnenen Erkenntnisse zusammentrage und kurz auf deren Folgen eingehe.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Partizipation
- Begriffserklärung
- Leitlinien für eine erfolgreiche Partizipation
- Individuelle und gesellschaftliche Vorraussetzungen
- Kinder- und Jugendparlamente
- Zusammensetzungen eines Kinder- und Jugendparlamentes
- Partizipationspotenziale vor dem Hintergrund der Ungleichheitstheorie von Pierre Bourdieu
- Habitus- und Sozialraumtheorie
- Partizipationspotenziale in Kinder- und Jugendparlamenten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der Kinder- und Jugendpartizipation und analysiert die Partizipationsmöglichkeiten im Kontext von Kinder- und Jugendparlamenten. Ziel ist es, die unterschiedlichen Partizipationsformen zu beleuchten und die Faktoren zu untersuchen, die die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, insbesondere aus unterschiedlichen sozialen Schichten, beeinflussen.
- Definition und verschiedene Formen der Partizipation
- Leitlinien für eine erfolgreiche Partizipation
- Kinder- und Jugendparlamente als spezifische Form der Partizipation
- Pierre Bourdieus Ungleichheitstheorie und ihre Relevanz für die Partizipation
- Analyse der Partizipationspotenziale vor dem Hintergrund der Bourdieuischen Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Kinder- und Jugendpartizipation ein und stellt die Relevanz des Themas sowie die Forschungsfrage dar. Kapitel 2 bietet eine detaillierte Definition des Partizipationsbegriffs, beleuchtet die Leitlinien für eine erfolgreiche Partizipation und untersucht die individuellen und gesellschaftlichen Vorraussetzungen für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Kapitel 3 widmet sich der Analyse der Kinder- und Jugendparlamente als spezifische Form der Partizipation. Dabei werden die Zusammensetzung dieser Parlamente und ihre Bedeutung für die politische Beteiligung von Kindern und Jugendlichen betrachtet. Kapitel 4 greift die Ungleichheitstheorie von Pierre Bourdieu auf und erläutert die Relevanz seiner Sozialraum- und Habitustheorie für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Die Ergebnisse der Analyse der Partizipationsmöglichkeiten im Kontext von Kinder- und Jugendparlamenten vor dem Hintergrund der Bourdieuischen Theorie werden in diesem Kapitel präsentiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der Kinder- und Jugendpartizipation im Kontext von Kinder- und Jugendparlamenten. Die Analyse fokussiert auf die Faktoren, die die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen Schichten beeinflussen. Dabei werden wichtige Konzepte wie die Ungleichheitstheorie von Pierre Bourdieu, Habitus, sozialer Raum, kulturelles Kapital, soziales Kapital, und die verschiedenen Formen der Partizipation (offene, projektorientierte, parlamentarische/repräsentative) beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Kinder- und Jugendparlamenten?
Ziel ist die aktive Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an politischen Entscheidungen. Sie sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen und demokratische Handlungskompetenzen zu erwerben.
Werden alle Jugendlichen gleichermaßen durch Partizipationsangebote erreicht?
In der Realität zeigt sich oft eine soziale Selektivität. Jugendliche aus bildungsnahen Schichten partizipieren häufiger, während Kinder aus benachteiligten Verhältnissen oft unterrepräsentiert sind.
Wie erklärt Pierre Bourdieu die Ungleichheit bei der Partizipation?
Bourdieu nutzt die Begriffe „Habitus“ und „sozialer Raum“. Menschen mit hohem kulturellem und sozialem Kapital fühlen sich in parlamentarischen Strukturen eher „zu Hause“, während andere sich diesen Angeboten entziehen.
Was sind Leitlinien für eine erfolgreiche Jugendpartizipation?
Erfolgreiche Partizipation muss freiwillig, transparent und wirksam sein. Die Jugendlichen müssen erleben, dass ihre Beteiligung tatsächlich Einfluss auf Ergebnisse hat.
Welche Formen der Partizipation gibt es?
Man unterscheidet unter anderem zwischen offener Partizipation (z. B. Jugendtreffs), projektorientierter Partizipation (zeitlich begrenzt) und repräsentativer Partizipation (wie Jugendparlamente).
- Citar trabajo
- Julia Timmer (Autor), 2010, Partizipationspotenziale im Rahmen von Kinder- und Jugendparlamenten , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166213