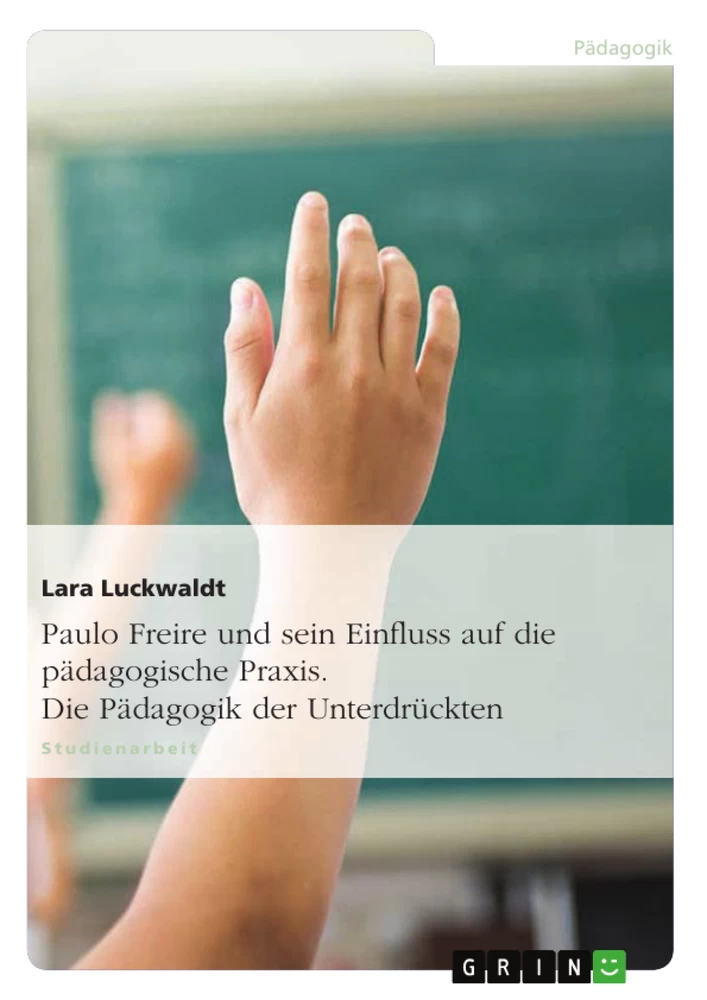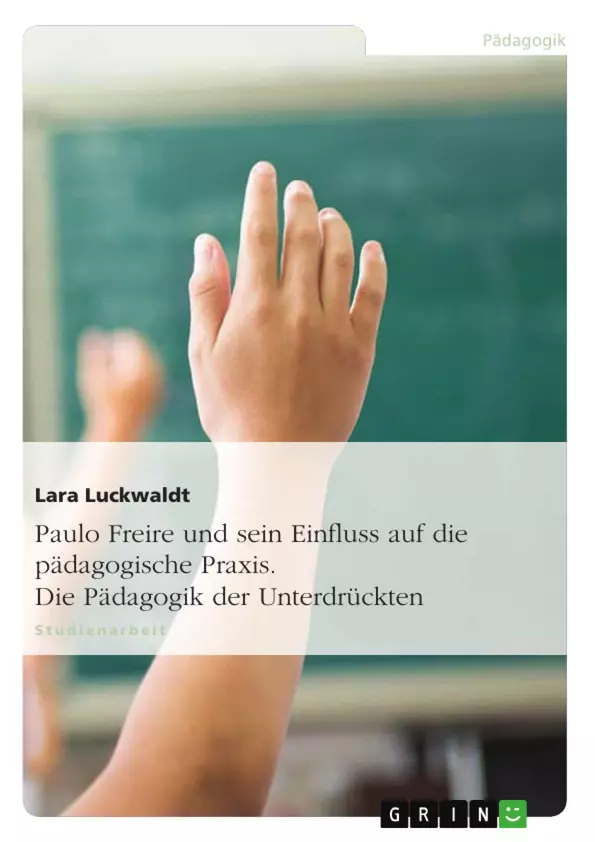Im Folgenden werde ich das Leben von Paolo Freire vor dem Hintergrund seiner pädagogischen Arbeit und seines Einflusses auf die pädagogische Praxis beleuchten. Dabei möchte ich auch die gesellschaftlichen Hintergründe in Brasilien darstellen, die Freire zu seiner Alphabetisierungsarbeit angehalten haben.
Grundlage dieser Arbeit war für Paulo Freire das „dialogische Prinzip“, das ein ebenbürtiges Verhältnis von Lehrer und Lernendem voraus setzt, sowie die Bewusstseinsbildung („Conscientizacao“), die auf die Befreiung von unterdrückerischen Verhältnissen aus sich selbst heraus abzielt. Er war der Meinung, dass man dies nur durch Alphabetisierung und Aufklärung erreichen könne und wird deshalb als Mahner für die soziale und politische Verantwortung der Wissenschaften und der Erziehung bezeichnet. Zahlreiche internationale pädagogische Institutionen tragen seinen Namen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Leben Paulo Freires
- Gesellschaftliche Hintergründe
- „Das dialogische Prinzip“
- „Conscientizacao“
- Einflüsse
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das Leben und die pädagogische Arbeit Paulo Freires. Sie beleuchtet Freires freiheitliche Sicht auf Erziehung und seine Alphabetisierungskampagnen in Südamerika. Die Arbeit stellt die gesellschaftlichen Hintergründe in Brasilien dar, die Freire zu seiner Alphabetisierungsarbeit motivierten.
- Das dialogische Prinzip in Freires Pädagogik
- Die Bedeutung von „Conscientizacao“ für die Befreiung
- Freires Alphabetisierungskampagnen und ihre Auswirkungen
- Der Einfluss von Freires Ideen auf die pädagogische Praxis
- Freires Rolle als Mahner für die soziale und politische Verantwortung der Wissenschaften und der Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und stellt den Kontext der Hausarbeit dar. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Leben Paulo Freires. Es beleuchtet seine Kindheit und Jugend in Brasilien, seine Ausbildung und seine berufliche Entwicklung. Das dritte Kapitel behandelt die gesellschaftlichen Hintergründe in Brasilien, die Freires pädagogisches Denken und Handeln beeinflussten.
Schlüsselwörter
Paulo Freire, Alphabetisierung, Befreiungspädagogik, dialogisches Prinzip, „Conscientizacao“, Brasilien, soziale Ungleichheit, politische Partizipation, Erwachsenenbildung, Volkskultur.
- Quote paper
- Lara Luckwaldt (Author), 2010, Paulo Freire und sein Einfluss auf die pädagogische Praxis. Die Pädagogik der Unterdrückten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166822