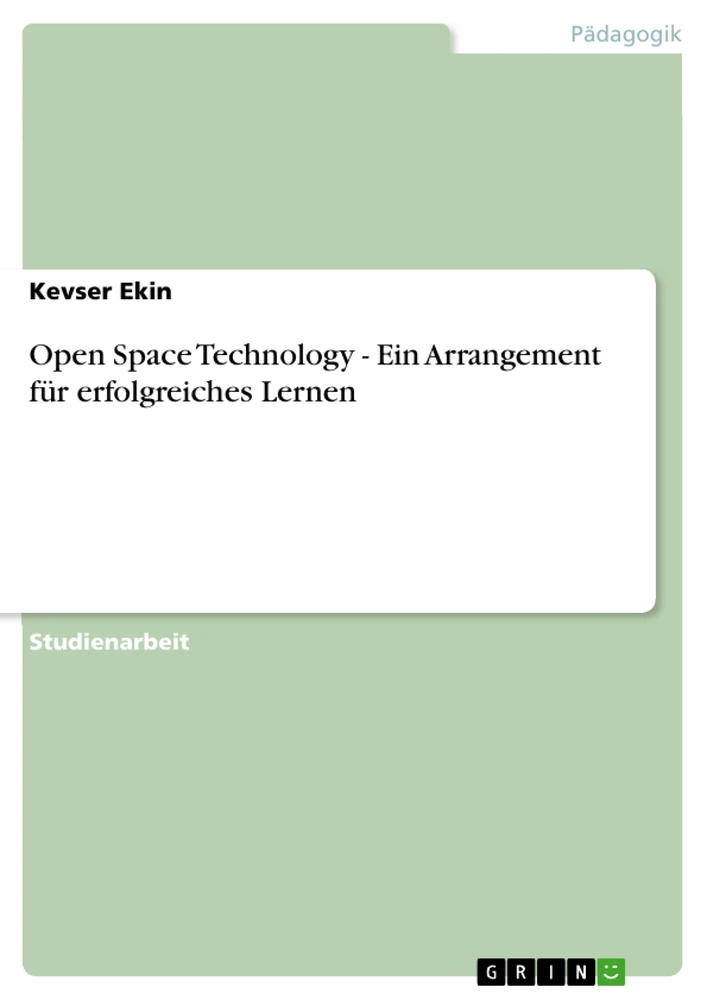Zunächst geht es um die Definition und Entstehung der Open Space Technologie. Die erzieherische Absicht beispielsweise ist nicht sehr stark ausgeprägt, denn ob gelernt wird oder nicht, muss abgewartet werden. Nun könnte man sich folgende Frage stellen: Wie ist es möglich, dass Open Space Technology tatsächlich funktioniert und dass etwas gelernt wird? Es soll geklärt werden wo das Geheimnis von Open Space liegt. In der Arbeit wird auch die Umsetzung dieser Methode vorgestellt. Es wird zum Einen auf die Vorbereitung und zum Anderen auf den Ablauf eingegangen. Es wird genau beschrieben wie die Konferenz abläuft.
Anschließend werden Grundregeln, besondere Eigenschaften und Arbeitsprinzipien vorgestellt, welche zum Gelingen der Open Space Methode viel beitragen.
Die typischen Eigenschaften von Arrangements, z.B. die Eröffnung und Begrenzung von Lernmöglichkeiten treffen ebenfalls auf Open Space zu. Deshalb sollen Möglichkeiten und Grenzen von Open Space vorgestellt werden.
Zum Schluss wird selbstgesteuertes Lernen, was bei Open Space schließlich durchgehend gefordert ist, noch einmal genauer betrachtet. Das Hauptanliegen bei selbstgesteuerten Lernprozessen ist ja kein möglichst großer Erwerb von neuem Wissen. Interessant wäre herauszufinden, wie die Wissensaneignung bei Open Space optimiert werden könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was versteht man unter Open Space Technology?
- 3. Die Entstehungsgeschichte
- 4. Verbindung mit einer Grundform pädagogischen Handelns: Das Arrangieren
- 5. Umsetzung in die Praxis
- 5.1 Vorbereitungsphase
- 5.2 Der Ablauf
- 6. Regeln und Besonderheiten der Open - Space - Methode
- 6.1 Vier Grundsätze
- 6.1.1 Wer immer kommt, es sind die richtigen Leute
- 6.1.2 Was immer geschieht, ist das einzige, was geschehen kann
- 6.1.3 Es fängt an, wenn die Zeit reif ist
- 6.1.4 Vorbei ist vorbei
- 6.2 Das Gesetz der zwei Füße
- 6.2.1 Erscheinungsformen des Gesetzes: Hummeln und Schmetterlinge
- 6.3 Überraschende Effekte
- 6.1 Vier Grundsätze
- 7. Möglichkeiten und Grenzen von Open Space Technology
- 7.1 Stärken von Open Space Technology
- 7.2 Schwächen von Open Space Technology
- 8. Open Space und selbstgesteuertes Lernen
- 9. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Open Space Technology (OST) als Methode für erfolgreiches Lernen. Ziel ist es, OST zu definieren, ihren Ursprung zu beleuchten und ihre Anwendung in der pädagogischen Praxis zu beschreiben. Dabei wird der Zusammenhang zu "Arrangieren" als Grundform pädagogischen Handelns hergestellt.
- Definition und Funktionsweise von Open Space Technology
- Die Entstehungsgeschichte und die zugrundeliegenden Prinzipien von OST
- Der Zusammenhang zwischen OST und "Arrangieren" als pädagogisches Handlungsmodell
- Praktische Umsetzung von OST: Vorbereitung und Ablauf
- Möglichkeiten und Grenzen von OST im Kontext selbstgesteuerten Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Open Space Technology (OST) ein und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit. Sie hebt die zentrale Frage nach dem Erfolg von OST als Lernmethode hervor und kündigt die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten der Methode an, von der Definition bis hin zur Betrachtung selbstgesteuerten Lernens.
2. Was versteht man unter Open Space Technology (OST)?: Dieses Kapitel definiert OST als eine Großgruppenmethode, die die Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmer in den Mittelpunkt stellt. Es betont die Selbstorganisation der Teilnehmer und die Betonung von freiwilliger Verantwortungsübernahme. Der Vergleich mit produktiven Kaffeepausen verdeutlicht den Fokus auf spontane und ungezwungene Interaktion im Gegensatz zu geplanten Vorträgen. Das Kapitel unterstreicht, dass bei OST nicht die Inhalte, sondern die Rahmenbedingungen für selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten geschaffen werden.
3. Die Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung von OST aus der Beobachtung, dass informelle Gespräche, etwa in Kaffeepausen, oft produktiver sind als formale Konferenzbeiträge. Es beleuchtet den Einfluss eines westafrikanischen Dorfes mit seiner kreisförmigen Struktur und der natürlichen Sammlung von Interessen auf die Entwicklung der Methode. Die Geschichte illustriert die pragmatische und erfahrungsbasierte Entwicklung von OST.
4. Verbindung mit einer Grundform pädagogischen Handelns: Das Arrangieren: Dieses Kapitel untersucht die Verbindung von OST mit dem Konzept des "Arrangierens" als pädagogischer Grundform. Es analysiert verschiedene Arten von Arrangements und deren Ziele, von der Schaffung eines pädagogischen Feldes bis zur Erzeugung emotionaler Stimmungen. OST wird als ein Arrangement dargestellt, das selbstorganisiertes Lernen ermöglicht und die Teilnehmer animiert, selbstständig zu lernen, ohne direkte Steuerung.
5. Umsetzung in die Praxis: Dieses Kapitel beschreibt die praktische Umsetzung von OST, unterteilt in Vorbereitung und Ablauf. Es erläutert detailliert die einzelnen Schritte einer OST-Konferenz und zeigt auf, wie die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Teilnehmer effektiv und selbstbestimmt arbeiten können. Die Betonung liegt auf der strukturierten Anleitung zur Selbstorganisation der Lernenden.
6. Regeln und Besonderheiten der Open - Space - Methode: Dieses Kapitel stellt die Grundregeln und Prinzipien von OST vor, insbesondere die vier Grundsätze und das "Gesetz der zwei Füße". Es erklärt, wie diese Regeln das Gelingen der Methode unterstützen und wie unerwartete Effekte entstehen können. Die Beschreibung der Prinzipien zeigt, wie die Methode die Eigenverantwortung und die Selbststeuerung der Teilnehmer fördert.
7. Möglichkeiten und Grenzen von Open Space Technology: Dieses Kapitel bewertet die Stärken und Schwächen von OST. Es beleuchtet die positiven Aspekte, wie die Förderung von Kreativität, Eigenverantwortung und selbstgesteuertem Lernen, aber auch die potenziellen Herausforderungen, wie die Abhängigkeit von der Motivation der Teilnehmer und die Schwierigkeit, alle Teilnehmer einzubeziehen. Die kritische Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Grenzen rundet das Verständnis der Methode ab.
8. Open Space und selbstgesteuertes Lernen: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen OST und selbstgesteuertem Lernen. Es diskutiert die Bedeutung von selbstgesteuertem Lernen und die möglichen Herausforderungen, die sich für Teilnehmer ergeben können, die an Druck gewöhnt sind. Die Kapitel beleuchtet, wie OST das selbstgesteuerte Lernen fördert und welche Rolle die Wissensaneignung in diesem Kontext spielt.
Schlüsselwörter
Open Space Technology, selbstgesteuertes Lernen, Arrangieren, Großgruppenmethode, partizipative Lernmethoden, Selbstorganisation, Kooperation, Kreativität, pädagogisches Handeln.
Häufig gestellte Fragen zu "Open Space Technology als Methode für erfolgreiches Lernen"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Open Space Technology (OST) als Methode für erfolgreiches Lernen. Sie beleuchtet die Definition, den Ursprung und die Anwendung von OST in der pädagogischen Praxis, insbesondere im Zusammenhang mit selbstgesteuertem Lernen.
Was ist Open Space Technology (OST)?
OST ist eine Großgruppenmethode, die die Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmer in den Mittelpunkt stellt. Sie basiert auf Selbstorganisation, freiwilliger Verantwortungsübernahme und spontaner Interaktion. Im Gegensatz zu geplanten Vorträgen werden bei OST die Rahmenbedingungen für selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten geschaffen.
Woher kommt OST?
OST entstand aus der Beobachtung, dass informelle Gespräche oft produktiver sind als formale Treffen. Die westafrikanische Dorfstruktur mit ihrer kreisförmigen Organisation und der natürlichen Sammlung von Interessen beeinflusste die Entwicklung der Methode. Es ist eine pragmatische und erfahrungsbasierte Methode.
Welcher Zusammenhang besteht zwischen OST und "Arrangieren" als pädagogischer Grundform?
Die Arbeit analysiert OST als ein Arrangement, das selbstorganisiertes Lernen ermöglicht. "Arrangieren" im pädagogischen Kontext umfasst die Schaffung eines Lernfeldes und die Erzeugung emotionaler Stimmungen. OST animiert die Teilnehmer, selbstständig zu lernen, ohne direkte Steuerung.
Wie wird OST in der Praxis umgesetzt?
Die praktische Umsetzung von OST gliedert sich in Vorbereitung und Ablauf. Das Kapitel beschreibt detailliert die einzelnen Schritte einer OST-Konferenz und zeigt, wie die Rahmenbedingungen für effektives und selbstbestimmtes Arbeiten geschaffen werden. Die Betonung liegt auf der strukturierten Anleitung zur Selbstorganisation der Lernenden.
Welche Regeln und Besonderheiten hat OST?
Die wichtigsten Regeln sind die vier Grundsätze ("Wer immer kommt...", "Was immer geschieht...", "Es fängt an...", "Vorbei ist vorbei") und das "Gesetz der zwei Füße". Diese Regeln unterstützen das Gelingen der Methode und ermöglichen unerwartete, positive Effekte. Sie fördern Eigenverantwortung und Selbststeuerung.
Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet OST?
OST fördert Kreativität, Eigenverantwortung und selbstgesteuertes Lernen. Potentielle Herausforderungen sind die Abhängigkeit von der Motivation der Teilnehmer und die Schwierigkeit, alle einzubeziehen. Die Arbeit bewertet kritisch die Stärken und Schwächen der Methode.
Welchen Zusammenhang hat OST mit selbstgesteuertem Lernen?
Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen OST und selbstgesteuertem Lernen, berücksichtigt dabei die Bedeutung von selbstgesteuertem Lernen und die möglichen Herausforderungen für Teilnehmer, die an Druck gewöhnt sind. Es wird beleuchtet, wie OST das selbstgesteuerte Lernen fördert und welche Rolle die Wissensaneignung spielt.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis von OST?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Open Space Technology, selbstgesteuertes Lernen, Arrangieren, Großgruppenmethode, partizipative Lernmethoden, Selbstorganisation, Kooperation, Kreativität, pädagogisches Handeln.
- Arbeit zitieren
- Kevser Ekin (Autor:in), 2007, Open Space Technology - Ein Arrangement für erfolgreiches Lernen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167409