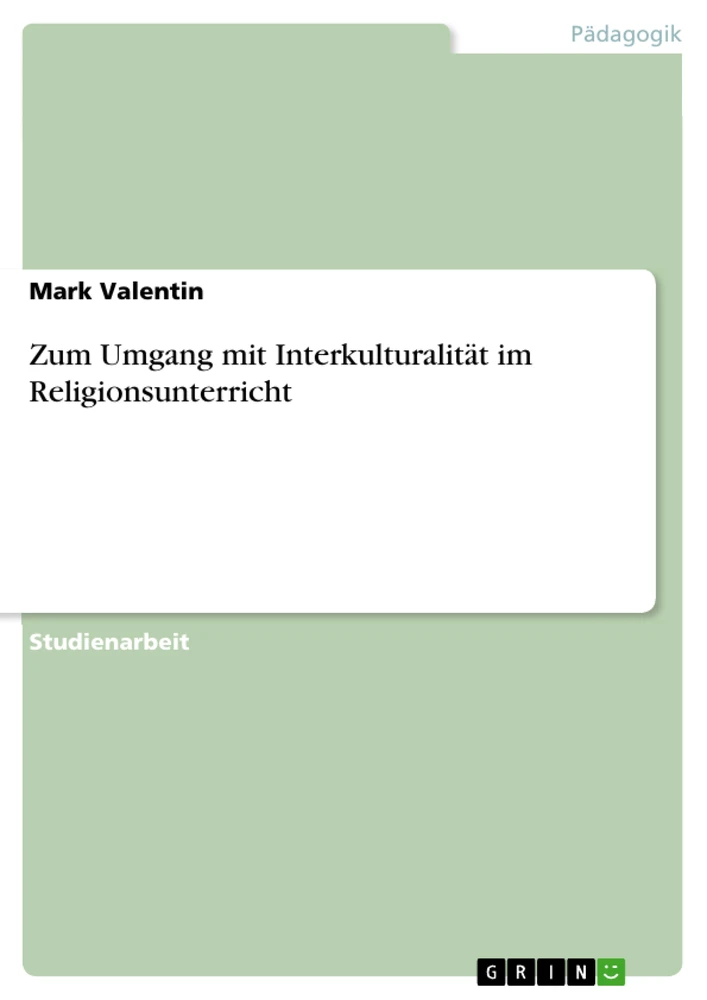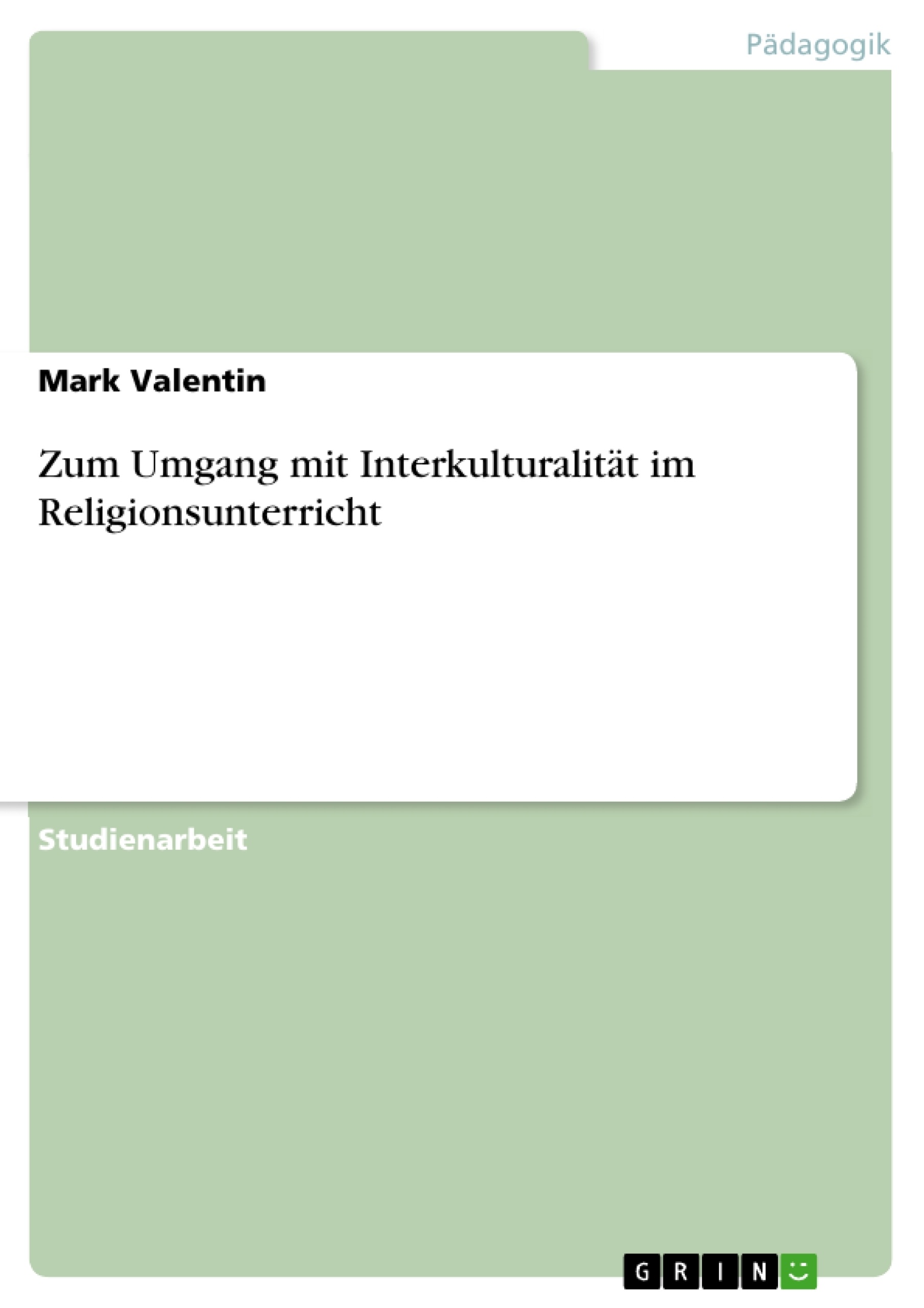Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos. Dies ist der Titel eines Seminares, welches ich in der vergangenen Woche im Rahmen meines Studiums der katholischen Religionslehre besuchte. Einen ganzen Abend lang erläuterte Walter Langer – Referent der Stiftung Weltethos und selbst erfahrener Gesamtschullehrer – im Kreise junger angehender Religionslehrer, wie es möglich ist, das Thema der Weltreligionen im katholischen Religionsunterricht umzusetzen und dabei einen Beitrag dazu zu leisten, den oftmals religiös heterogenen Schülergruppen mit der erforderlichen Sensibilität zu begegnen.
Im Rahmen seiner Präsentation über die Wirksamkeit von Bildern als gelungener Ansatzpunkt für Diskussionen mit den SchülerInnen kam Langer dabei auch auf das Thema Islam. In diesem Kontext präsentierte er den Teilnehmern das Bild einer jungen Muslima, die – ausgepeitscht, blutend und der Rücken mit Suren des Koran beschmiert – am Boden liegt. Dieser provokante Ansatz, so Langer, mache es möglich, in eine differenzierte Diskussion über den Islam einzusteigen, bei der mit Vorurteilen aufzuräumen sei.
Zunächst schockiert über die Direktheit Langers Vorgehen, möchte ich mich im Rahmen dieser Arbeit damit beschäftigen, ob sich adäquater Umgang mit einer heterogenen Schülerschaft im katholischen RU derartig gestalten kann oder ob das Vorgehen Langers hinsichtlich der besonderen Voraussetzungen einiger Modifikationen bedarf.
Dazu gilt es zunächst, grundlegende Unterschiede zwischen den SchülerInnen zu erarbeiten, die auf dem divergierenden Religionsbekenntnis basieren (II). Im Anschluss daran soll auf Grundlage von Thesen zur Interkulturalität erörtert werden, ob es im RU Möglichkeiten gibt, gerade hinsichtlich der Thematik Islam interkulturell zu lernen (III). Diese Ausführungen dienen als Grundlage für daran anschließende Konkretisierungen im Kontext der Aussage Aus Fremdheit lernen (IV). Letztlich soll – basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen – im Fazit ein Rückbezug auf die Vorgehensweise Langers erfolgen (V).
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Unterschiede im Religionsbekenntnis als Determinanten der aktuellen Situation
- II.1 Religionsunterricht und Pluralität
- II.2 Unterschiede im Ethos
- II.3 Gegenseitige Vorurteile
- III. Interkulturalität im Religionsunterricht leben. Ausführungen zum Thema Islam auf Grundlage von Thesen zur Interkulturalität
- IV. Aus Fremdheit lernen
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, wie im katholischen Religionsunterricht adäquat mit einer heterogenen Schülerschaft, insbesondere mit muslimischen SchülerInnen, umgegangen werden kann. Konkret wird die Frage untersucht, ob das Vorgehen von Walter Lange, der das Bild einer gepeitschten Muslima einsetzt, um eine Diskussion über den Islam anzustoßen, für den Religionsunterricht geeignet ist. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die durch die unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründe der SchülerInnen entstehen, und diskutiert Möglichkeiten für interkulturelles Lernen im Religionsunterricht.
- Unterschiedliche Religionsbekenntnisse und deren Einfluss auf den Religionsunterricht
- Die Bedeutung des interkulturellen Lernens im Religionsunterricht
- Das Thema Islam im katholischen Religionsunterricht
- Die Rolle von Vorurteilen und Fremdheit im interreligiösen Kontext
- Möglichkeiten, aus der Begegnung mit Andersartigkeit zu lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Ausgangslage für die Arbeit dar. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas Weltreligionen im katholischen Religionsunterricht und setzt die Arbeit in den Kontext der Diskussion um interkulturelles Lernen im Schulalltag. Kapitel II widmet sich den Unterschieden im Religionsbekenntnis als Determinanten der aktuellen Situation im Religionsunterricht. Es beleuchtet die Bedeutung des Religionsunterrichts im Kontext der Pluralität in der Schule und beschreibt die weitreichenden Auswirkungen des Unterschieds im Ethos zwischen christlichen und muslimischen SchülerInnen. Außerdem werden die Herausforderungen durch gegenseitige Vorurteile aufgezeigt. Kapitel III beschäftigt sich mit der Frage, wie interkulturelles Lernen im Religionsunterricht, insbesondere im Hinblick auf das Thema Islam, umgesetzt werden kann. Kapitel IV erörtert die Aussage "Aus Fremdheit lernen" und stellt konkrete Möglichkeiten zur Umsetzung im Religionsunterricht vor.
Schlüsselwörter
Religionsunterricht, Interkulturalität, Islam, Pluralität, Heterogenität, Ethos, Vorurteile, Fremdheit, interreligiöses Lernen, Weltreligionen.
Häufig gestellte Fragen
Wie geht man mit religiöser Pluralität im Religionsunterricht um?
Die Arbeit betont die Notwendigkeit von Sensibilität und interkulturellem Lernen, um heterogenen Schülergruppen gerecht zu werden.
Was bedeutet "Aus Fremdheit lernen"?
Es beschreibt das Konzept, die Begegnung mit anderen Religionen und Kulturen als Chance für persönliches Wachstum und den Abbau von Vorurteilen zu nutzen.
Welche Rolle spielt das Thema Islam im katholischen Religionsunterricht?
Es ist ein zentraler Bestandteil des interreligiösen Lernens, erfordert aber eine differenzierte Auseinandersetzung, um Klischees zu vermeiden.
Ist ein provokanter Bild-Ansatz im Unterricht sinnvoll?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob schockierende Bilder (wie eine gepeitschte Muslima) geeignet sind, um Diskussionen anzustoßen, oder ob sie Vorurteile eher verstärken.
Was sind Determinanten der aktuellen Situation im RU?
Unterschiede im Religionsbekenntnis, im Ethos und gegenseitige Vorurteile prägen das Lernumfeld in religiös heterogenen Klassen.
- Citar trabajo
- B.A. Mark Valentin (Autor), 2009, Zum Umgang mit Interkulturalität im Religionsunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167973