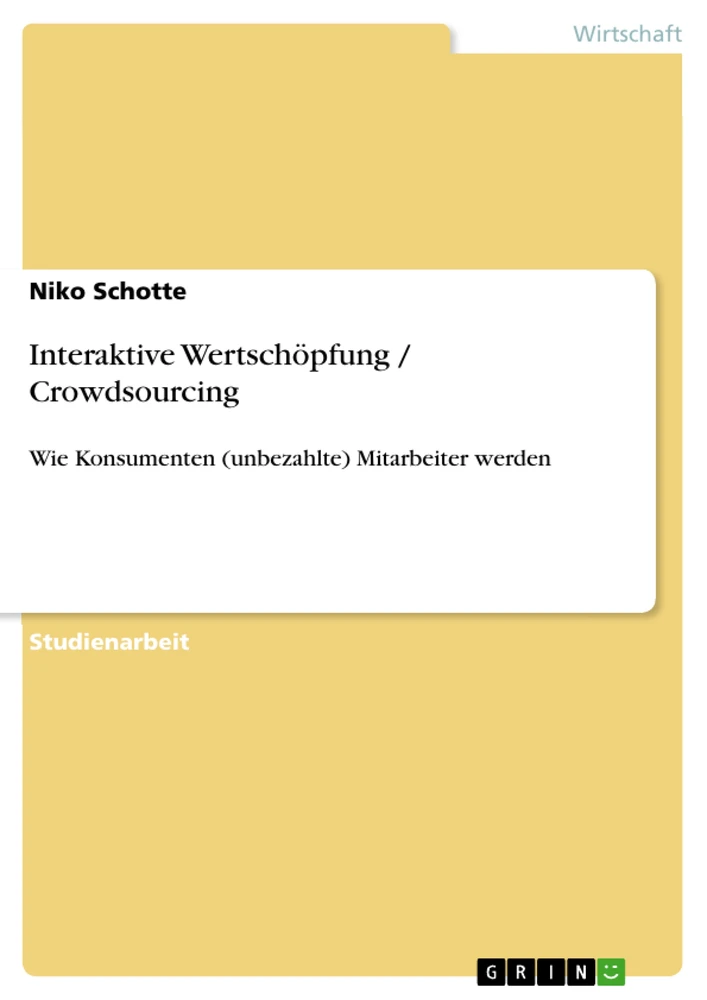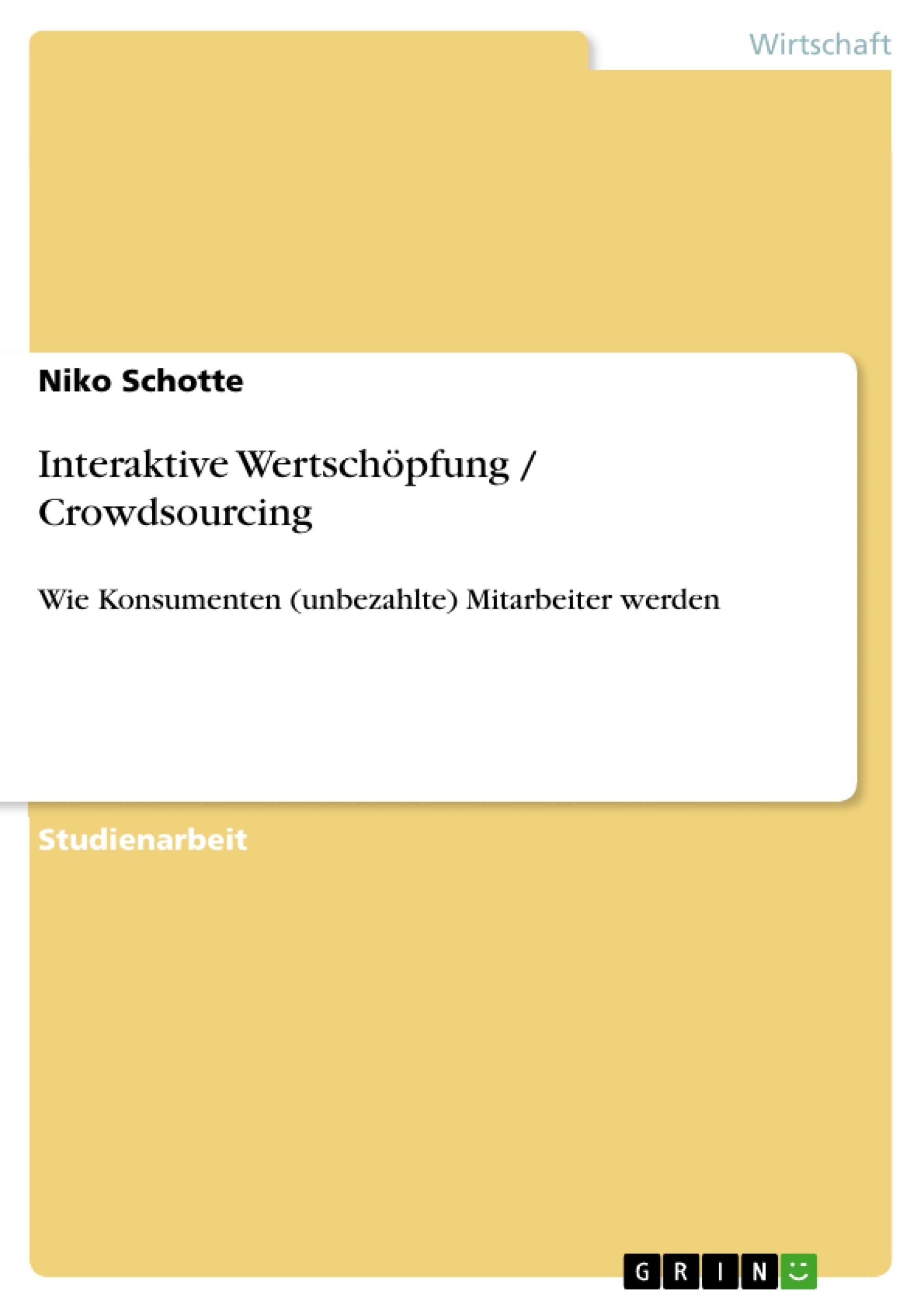Die wissenschaftliche Diskussion zeigt deutlich, dass die Idee, vorhandene Unternehmensgrenzen stärker aufzulösen und Konsumenten aktiver in den Wertschöpfungsprozess mit einzubeziehen, nicht wirklich neu ist. Diese Idee hat eine Vielzahl an Konzepten hervorgerufen, die starke Überschneidungen aufweisen. All diese Konzepte eint dieselbe Vorstellung, dass „Kunden schlauer und produktiver sein können als 'verkrustete' Abteilungen, wenn man sie [...] in den Leistungs- oder Ideenentwicklungsprozess des Unternehmens integriert“.
Heute zeigt sich immer deutlicher, dass Unternehmen es sich einfach nicht mehr leisten können, innovative Kunden an die Konkurrenz zu verlieren. Kunden haben ein hohes Produktinvolvement aufgrund ihres Produktwissens und ihrer Produkterfahrung. Meinungsführer und auch Innovatoren können entscheidend zur Marktdurchdringung neuer Produkte beitragen, indem sie über soziale Netzwerke aktiven Einfluss auf andere Konsumenten ausüben. Diese Kunden haben einen großen Wert für jedes Unternehmen. Daher muss erreicht werden, dass „geeignete Kunden von sich aus ihr Wissen bereitwillig preisgeben und ihre Fähigkeiten in den Dienst des Unternehmens stellen“.
„Grundlage der interaktiven Wertschöpfung ist ein freiwilliger Interaktionsprozess zwischen Unternehmen und Kunden, der sowohl gemeinsamer Problemlösungsprozess als auch sozialer Austauschprozess ist“.
Das Konzept „Interaktive Wertschöpfung“ (IWS) sieht Kunden nicht mehr nur als reine, passive Konsumenten an, sondern versteht sie vielmehr als Wertschöpfungspartner, die aktiv am Entwicklungs- und Herstellungsprozess von Produkten oder Dienstleistungen mitwirken. Durch die aktive Rolle der Kunden und anderer externer Akteure, wird aus der von Unternehmen dominierenden Wertschöpfung, die interaktive Wertschöpfung.
Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über das Thema „Interaktive Wertschöpfung“ (Crowdsourcing) zu geben und vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels zu erläutern, wie es zum aktiven Konsumenten und einer neuen Form der Arbeitsteilung in Unternehmen gekommen ist. Eine Besondere Aufmerksamkeit soll dabei den neuen Herausforderungen in Unternehmen und deren Veränderungen und Auswirkungen auf Organisationsstrukturen zukommen. Anhand von zwei Beispielen soll dargestellt werden, wie das Konzept „Interaktive Wertschöpfung“ (Crowdsourcing) bereits heute schon erfolgreich in der Praxis angewendet und umgesetzt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Interaktive Wertschöpfung/Crowdsourcing
- Wie Konsumenten (unbezahlte) Mitarbeiter werden
- Crowdsourcing als neuer Geschäftsansatz
- Definition und Abgrenzung
- Beispiele und Anwendungsgebiete
- Crowdsourcing in der Praxis
- Erfolgsfaktoren
- Risiken und Herausforderungen
- Rechtliche Aspekte
- Urheberrecht
- Datenschutz
- Zukünftige Entwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem Phänomen des Crowdsourcing und analysiert, wie Konsumenten zunehmend zu (unbezahlten) Mitarbeitern für Unternehmen werden. Der Text untersucht die Funktionsweise des Crowdsourcing als neuen Geschäftsansatz, beleuchtet die verschiedenen Anwendungsgebiete und skizziert die wichtigsten Erfolgsfaktoren und Risiken. Zudem werden die rechtlichen Aspekte im Zusammenhang mit Crowdsourcing, insbesondere in Bezug auf Urheberrecht und Datenschutz, beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung des Crowdsourcing
- Anwendungsgebiete und Beispiele für Crowdsourcing
- Erfolgsfaktoren und Risiken von Crowdsourcing-Projekten
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Crowdsourcing
- Zukünftige Entwicklungen im Bereich des Crowdsourcing
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel des Textes definiert den Begriff "Crowdsourcing" und grenzt ihn von anderen Formen der Zusammenarbeit ab. Es werden verschiedene Anwendungsgebiete des Crowdsourcing vorgestellt, beispielsweise in den Bereichen Produktentwicklung, Marketing und Kundenservice.
- Im zweiten Kapitel werden die Erfolgsfaktoren und Risiken von Crowdsourcing-Projekten untersucht. Es wird deutlich, dass die Motivation der Crowd und die Qualität der Crowd-Beiträge entscheidende Faktoren für den Erfolg eines Crowdsourcing-Projekts sind.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die rechtlichen Aspekte des Crowdsourcing, insbesondere in Bezug auf Urheberrecht und Datenschutz. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen für Crowdsourcing-Projekte in Deutschland erläutert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder des Textes sind: Crowdsourcing, Interaktive Wertschöpfung, Konsumenten als Mitarbeiter, Geschäftsansatz, Anwendungsgebiete, Erfolgsfaktoren, Risiken, Rechtliche Aspekte, Urheberrecht, Datenschutz, Zukünftige Entwicklungen.
- Citation du texte
- Niko Schotte (Auteur), 2011, Interaktive Wertschöpfung / Crowdsourcing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/169405