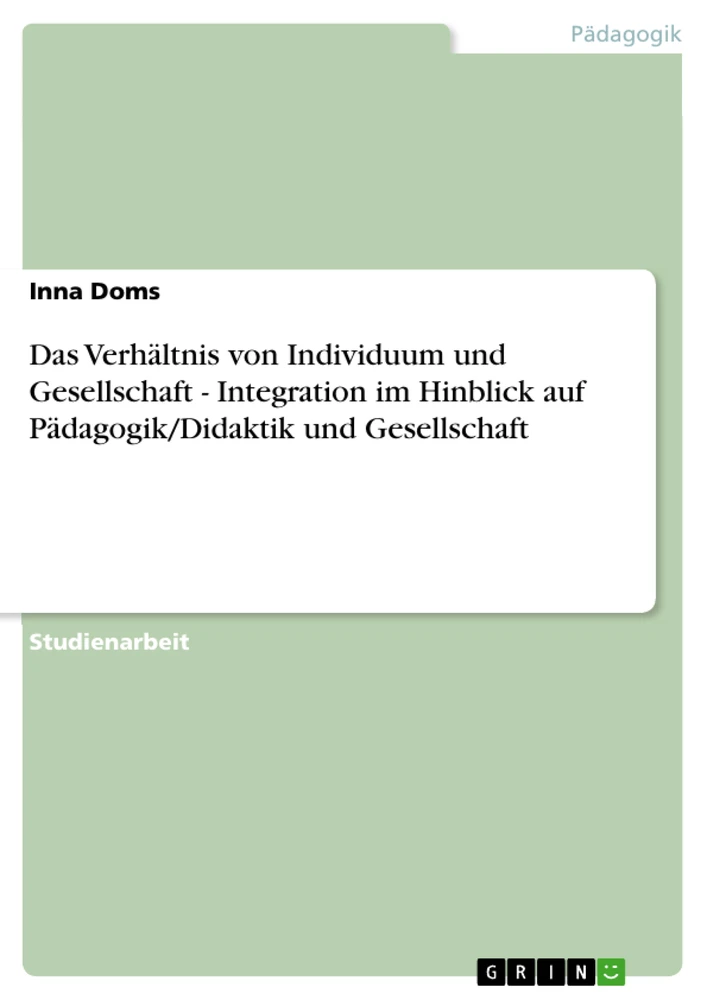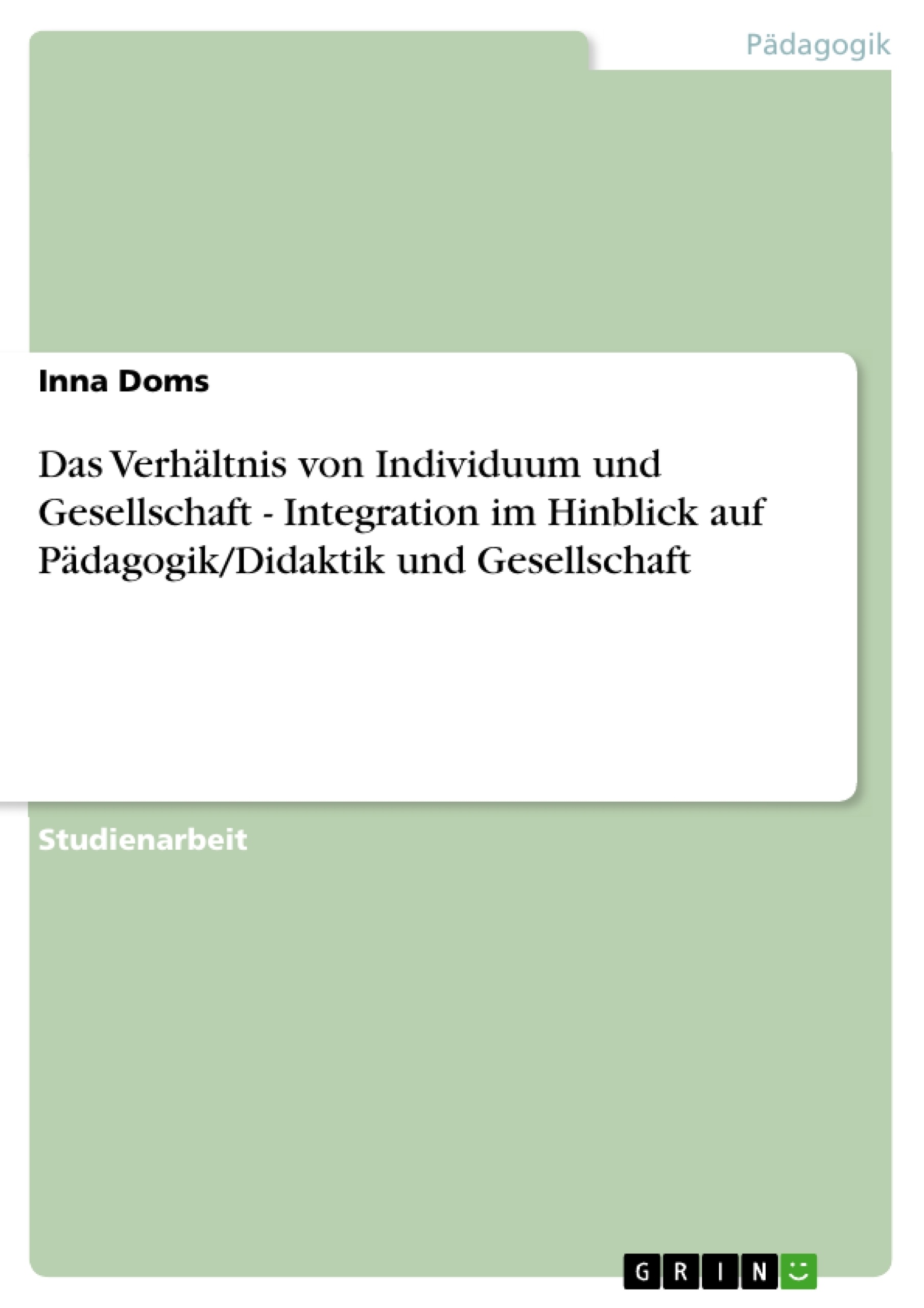Wirkliche Integration in der Praxis verlangt eine Auseinandersetzung mit ihrer geschichtlichen
Herleitung und Begründung. Hierbei gilt es das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft
im Besonderen zu analysieren, was einerseits das Erarbeiten der gesellschaftspolitischen
und sozio-ökonomischen Zusammenhänge und andererseits pädagogischdidaktische
Aspekte (Persönlichkeitsentwicklung) beinhaltet. So soll mit Hilfe der Dialektik
der Widerspruch zwischen Integration und Segregation aufgezeigt werden, um eine
Entwicklung hin zur Inklusion anzustoßen.
Da das eben dargestellte zunächst abstrakt erscheint, gilt es zuerst darzustellen, wo die
Problematik im Konkreten auftritt. Dies soll anhand einiger praktischer Beispiele verdeutlicht
werden.
Im weiteren Verlauf wird es darum gehen die Ausgrenzungsmechanismen im Laufe der
Geschichte aufzuzeigen und Integration zu begründen. Aufbauend hierauf gehe ich auf die
Begriffserklärungen von Integration, Segregation und Inklusion und ihre Umsetzung ein.
Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft stellt einen weiteren bedeutenden Themenkomplex
dar, den ich auszubreiten versuchen werde. Hierbei spielen die Persönlichkeitsentwicklung
und demnach auch die Bildung eine große Rolle sowie die Begrenzungen
dieser durch andere Wirkmechanismen. In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung/Funktion der Gesellschaft zu erarbeiten, die ebenso Einfluss auf den Widerspruch
Teilhabe und Ausschluss und deren Gewichtung ausübt. Anschließend sollen diese theoretischen
Auffassungen in das Feld der Erziehung und Bildung sowie in die Arbeit mit dem
Gemeinwesen übertragen werden im Hinblick auf Handlungsorientierungen. Abschließend
soll der Widerspruch als Quelle für Entwicklung aufgeschlossen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Widersprüche in der Praxis
- Herleitung und Begründung von Integration und Segregation
- Begriffserklärungen: Integration – Inklusion
- Das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft
- Der Bildungsbegriff
- Orientierung am Gemeinwesen
- Widerspruch als Quelle für Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem komplexen Verhältnis von Individuum und Gesellschaft im Kontext der Integration. Ziel ist es, die historischen Wurzeln und theoretischen Grundlagen von Integration und Segregation zu beleuchten und die Problematik der Ausgrenzung in der Praxis aufzuzeigen. Zudem soll die Entwicklung hin zur Inklusion im Hinblick auf Pädagogik und Gesellschaft diskutiert werden.
- Historische Entwicklung und Begründung von Integration und Segregation
- Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft im Kontext der Integration
- Die Bedeutung des Bildungsbegriffs für die Integration
- Die Rolle des Gemeinwesens und die Notwendigkeit einer handlungsorientierten Integration
- Widerspruch als Quelle für Entwicklung und Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Integration ein und stellt die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in diesem Kontext. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit den historischen Wurzeln und theoretischen Grundlagen der Integration und Segregation, um die Problematik der Ausgrenzung in der Praxis zu verstehen.
Widersprüche in der Praxis
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene aktuelle Beispiele für Ausgrenzungsphänomene in der Gesellschaft. Die Beispiele illustrieren die Widersprüche zwischen den Idealen von Integration und den realen Lebensbedingungen.
Herleitung und Begründung von Integration und Segregation
Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung von Integration und Segregation, ausgehend von der jüdisch-christlichen Kultur. Es werden verschiedene Phasen der Ausgrenzung und Integration in der Menschheitsgeschichte dargestellt, um die Entstehung und Funktionsweise von Ausgrenzungsmechanismen zu verstehen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den zentralen Themen Integration, Segregation und Inklusion. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind Individuum, Gesellschaft, Bildung, Gemeinwesen, Widerspruch, Ausgrenzung, Persönlichkeitsentwicklung und Handlungsorientierung. Die Arbeit untersucht das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft im Kontext der Integration und beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Entwicklung hin zur Inklusion verbunden sind.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration, Segregation und Inklusion?
Die Arbeit erläutert diese Begriffe als Phasen gesellschaftlicher Teilhabe: von der Ausgrenzung (Segregation) über die Eingliederung (Integration) hin zur vollen Teilhabe aller (Inklusion).
Wie hängen Individuum und Gesellschaft im Kontext der Integration zusammen?
Das Verhältnis ist dialektisch geprägt; gesellschaftliche Strukturen beeinflussen die Persönlichkeitsentwicklung und bestimmen den Grad der Teilhabe oder Ausgrenzung.
Welche Rolle spielt Bildung für die Integration?
Bildung wird als zentrales Element der Persönlichkeitsentwicklung gesehen, stößt jedoch oft an Grenzen durch äußere gesellschaftliche Wirkmechanismen.
Was bedeutet „Orientierung am Gemeinwesen“?
Es beschreibt einen handlungsorientierten Ansatz, bei dem Integration direkt im sozialen Umfeld und in der Gemeinschaft der Menschen stattfindet.
Warum wird der Widerspruch als Quelle für Entwicklung betrachtet?
Der Widerspruch zwischen Ideal (Teilhabe) und Realität (Ausgrenzung) erzeugt den notwendigen Druck für gesellschaftliche Veränderungen hin zur Inklusion.
- Quote paper
- Master of Arts in Inclusive Education Inna Doms (Author), 2010, Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft - Integration im Hinblick auf Pädagogik/Didaktik und Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/173995