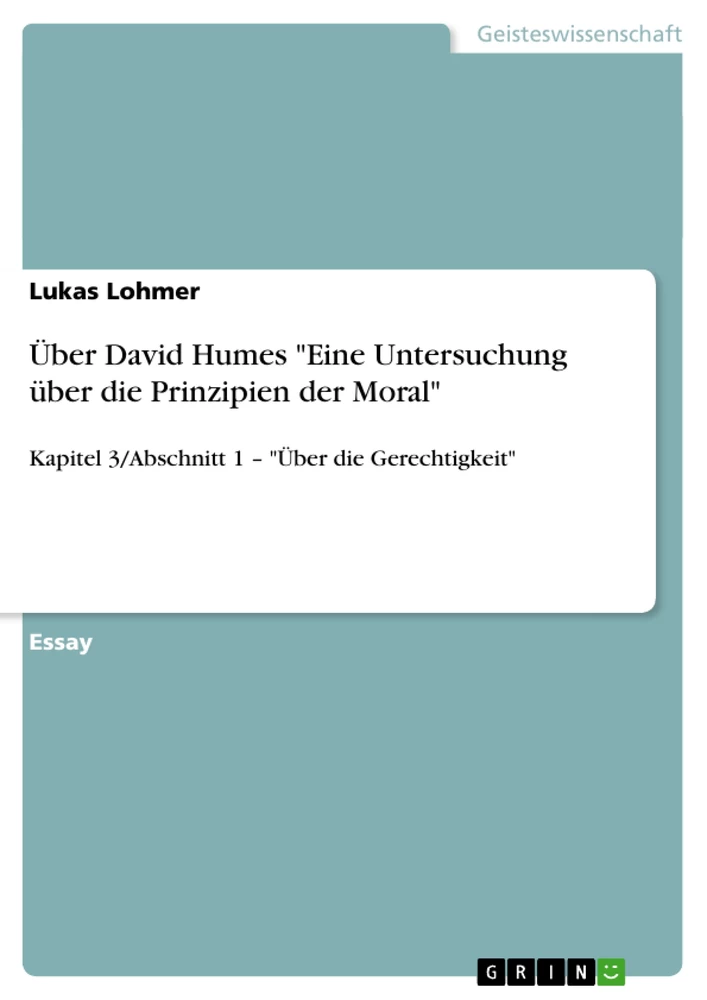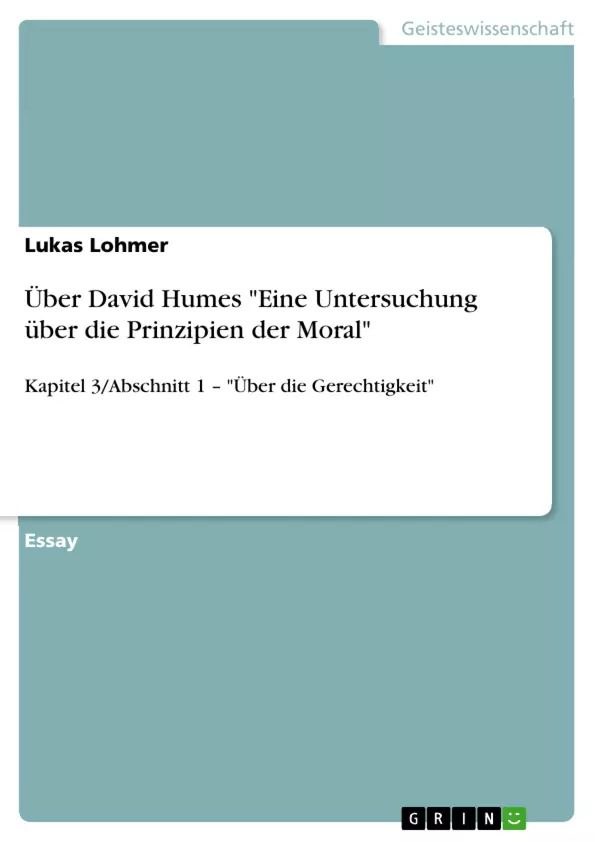In der folgenden Hausarbeit werde ich mich dem ersten Teil des dritten Abschnitts in David Humes Monographie „Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral“ widmen. Der Name des Abschnitts ist „Über die Gerechtigkeit“ und ich werde hauptsächlich versuchen die Argumentation David Humes zusammenzufassen, nachzuvollziehen und gegebenenfalls kritisch zu kommentieren.
Inhaltsverzeichnis
- Über die Gerechtigkeit
- Gerechtigkeit als künstliche Tugend
- Der öffentliche Nutzen als Ursprung von Gerechtigkeit
- Gedankenexperimente zur Gerechtigkeit
- Überfluss an Annehmlichkeiten
- Gesellschaft aus engelsgleichen Wesen
- Radikaler Mangel an Lebensnotwendigem
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert David Humes Argumentation über die Gerechtigkeit im ersten Teil des dritten Kapitels seiner Monographie „Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral“. Die Arbeit beleuchtet Humes Definition von Gerechtigkeit als künstliche Tugend, die durch Vernunft und Eigentumsschutz entsteht. Sie untersucht auch Humes Behauptung, dass der öffentliche Nutzen die Grundlage von Gerechtigkeit ist, und analysiert seine Gedankenexperimente, um die Rolle der Gerechtigkeit in verschiedenen Szenarien zu ergründen.
- Die Natur der Gerechtigkeit
- Der öffentliche Nutzen als Grundlage von Gerechtigkeit
- Humes Gedankenexperimente und ihre Implikationen
- Die Rolle von Eigentum und Eigeninteresse
- Der utilitaristische Charakter von Humes Gerechtigkeitsverständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Über die Gerechtigkeit
Dieser Abschnitt untersucht Humes Definition von Gerechtigkeit als künstliche Tugend, die auf Vernunft und Eigentumsschutz basiert. Er argumentiert, dass natürliche Impulse uns nicht zu rechtsgemäßem Handeln treiben, sondern dass Gerechtigkeit auf Erziehung und menschlicher Übereinkunft beruht.
Gedankenexperimente zur Gerechtigkeit
Überfluss an Annehmlichkeiten
Humes erstes Gedankenexperiment stellt sich eine Welt vor, in der es so viel Überfluss an allem gibt, dass es keine Notwendigkeit für Eigentum oder Gerechtigkeit gibt. In dieser utopischen Gesellschaft sind die Menschen von allen Ängsten befreit und leben in Harmonie.
Gesellschaft aus engelsgleichen Wesen
Humes zweites Gedankenexperiment untersucht eine Gesellschaft aus engelsgleichen Wesen, die keine Eifersucht oder Neid kennen. In dieser Gesellschaft gibt es keine Notwendigkeit für Grenzen zwischen Eigentum, da alle einander mit uneigennütziger Freundlichkeit begegnen.
Radikaler Mangel an Lebensnotwendigem
Humes drittes Gedankenexperiment stellt sich eine Welt vor, in der ein radikaler Mangel an Lebensnotwendigem herrscht. In diesem Szenario ist es unmöglich, die Regeln der Gerechtigkeit einzuhalten, da das Überleben Vorrang hat.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeit, künstliche Tugend, öffentlicher Nutzen, Eigentum, Gedankenexperimente, Überfluss, Mangel, utilitaristischer Charakter, Engelswesen, Eigentumsgrenzen, Selbsterhaltungstrieb, Humes „Hungersnot“-Beispiel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von David Humes Untersuchung über die Prinzipien der Moral?
Die Arbeit konzentriert sich auf den dritten Abschnitt von Humes Werk, in dem er die Natur der Gerechtigkeit analysiert und untersucht, ob diese eine natürliche oder künstliche Tugend ist.
Warum bezeichnet Hume die Gerechtigkeit als „künstliche Tugend“?
Hume argumentiert, dass Gerechtigkeit nicht auf natürlichen Impulsen beruht, sondern durch menschliche Übereinkunft, Erziehung und die Notwendigkeit des Eigentumsschutzes in einer Gesellschaft entsteht.
Welche Rolle spielt der „öffentliche Nutzen“ in Humes Theorie?
Laut Hume ist der öffentliche Nutzen der alleinige Ursprung der Gerechtigkeit. Regeln der Gerechtigkeit werden nur deshalb aufrechterhalten, weil sie für die Erhaltung der Gesellschaft und das Wohlergehen der Menschen notwendig sind.
Was illustriert Humes Gedankenexperiment zum „Überfluss an Annehmlichkeiten“?
Es zeigt, dass in einer Welt des absoluten Überflusses, in der alle Bedürfnisse sofort befriedigt werden, die Tugend der Gerechtigkeit unnötig wäre, da kein Bedarf an Eigentumsregelungen bestünde.
Wie wirkt sich ein radikaler Mangel auf die Gerechtigkeit aus?
Hume erklärt, dass in Situationen extremer Not (z. B. eine Hungersnot) die Regeln der Gerechtigkeit außer Kraft gesetzt werden, da der Selbsterhaltungstrieb Vorrang vor den Eigentumsrechten anderer hat.
Was versteht Hume unter einer Gesellschaft aus „engelsgleichen Wesen“?
In diesem Gedankenexperiment beschreibt er Wesen ohne Neid oder Egoismus. In einer solchen Gesellschaft wäre Gerechtigkeit ebenfalls überflüssig, da jeder das Wohl des anderen wie sein eigenes behandeln würde.
- Quote paper
- Lukas Lohmer (Author), 2010, Über David Humes "Eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/175018