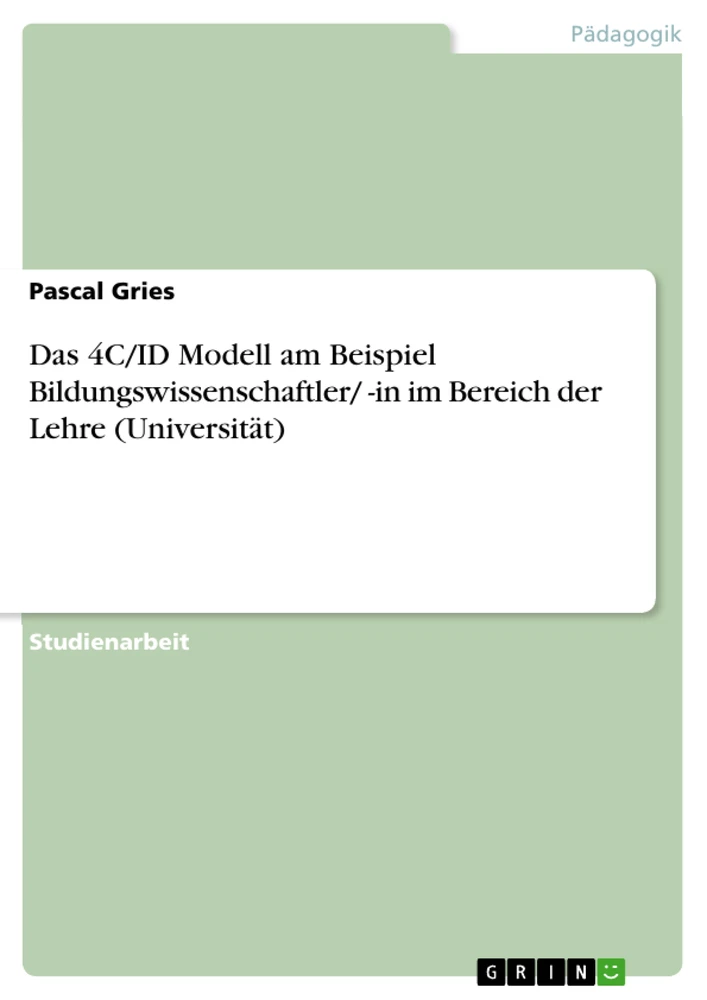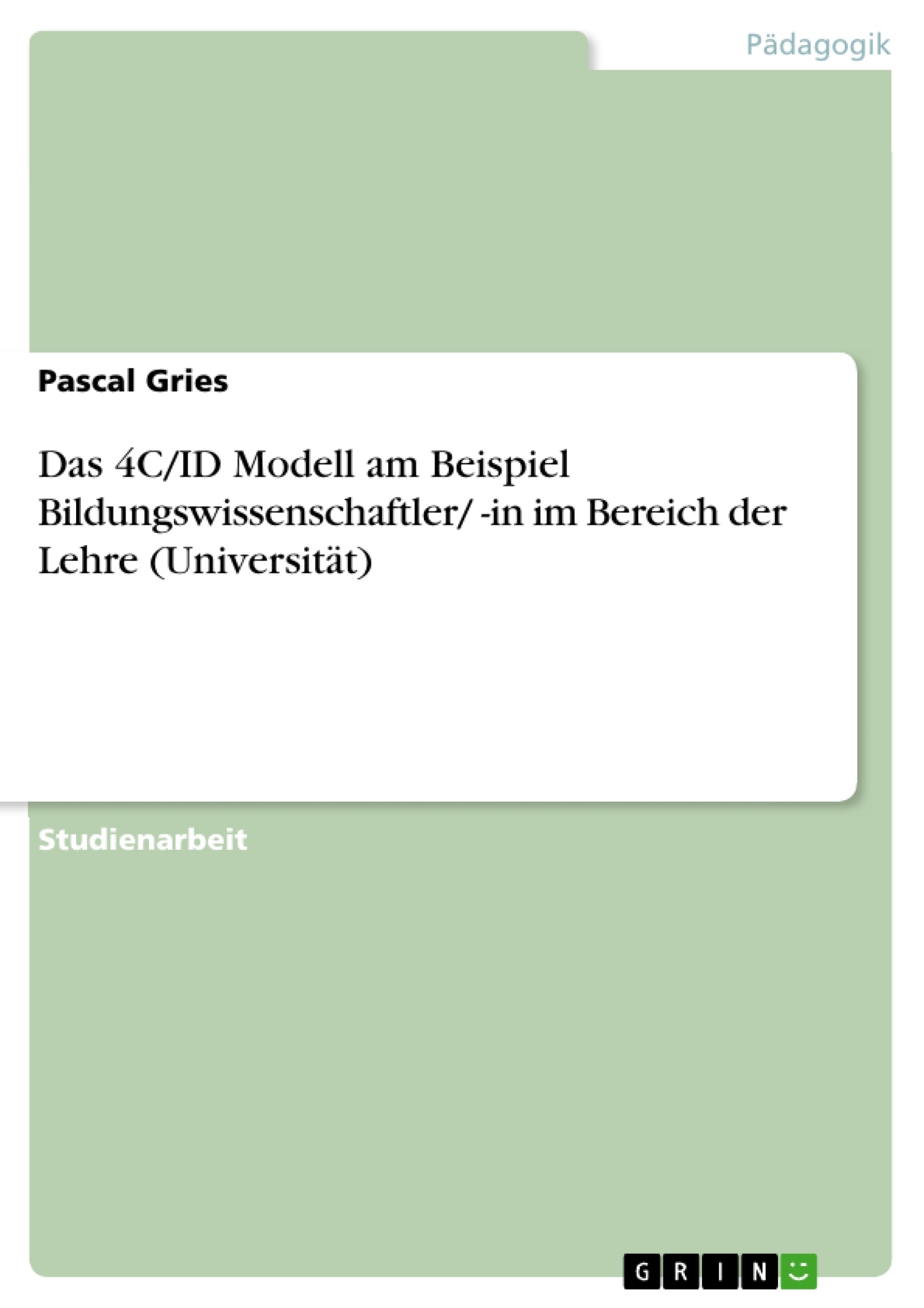Der Arbeitsmarkt bewegt sich in einem Umfeld stetig wachsender Anforderungen an die Arbeitnehmer, aufgrund des technologischen Fortschritts. Dies verlangt die permanente Aneignung neuer Qualifikationen und eine Weiterbildung für die Ausführung komplexer Fertigkeiten (van Merrienboer & Kirschner, 2007, S.4).
Um dies zu erreichen wandeln sich die Lehrmethoden der Vergangenheit, welche einen Fokus auf der Vermittlung von klassischem Faktenwissen hatten, hin zur Vermittlung von Kompetenz. Dabei müssen vornehmlich Studenten in die Lage versetzt werden komplexe Probleme zu lösen, mit denen sie in Zukunft konfrontiert werden (Gulikers, Bastiaens, & Martens, 2005, S. 510).
Neben dem erhöhten Anspruch der Kompetenzvermittlung, nehmen sowohl Anzahl, als auch der im Bildungssystem verweilenden Teilnehmer zu. Hier spricht man von der Bildungsexpansion. Dies äußert sich sowohl in einem Anstieg der Abiturienten, als auch der Studierenden (Hadjar, Becker, 2006, S.11 f.). Grund für die längere Verweildauer ist neben den Unternehmensanforderungen die Tatsache, dass Karrierechancen und die Vergabe gesellschaftlicher Positionen abhängig sind von der Anzahl der Bildungsabschlüsse. Hier spricht man vom bildungsmeritokratischem Prinzip (Faulstich, 2003, S.35).
Erhöhte Kompetenzanforderungen und steigende Studentenzahlen erhöhen letztlich die Anforderung an die Universitäten, welche ihre Lerninhalte so aufbereiten müssen, dass die gewandelten Rahmenbedingungen erfüllt werden. Dies hat Auswirkung auf die Gestaltung der Vorlesungen oder diverser Kurse. Um eine optimal Durchführung zu gewährleisten, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit im ersten Teil mit dem fiktiven Beispiel der Qualifizierung eines Bildungswissen-schaftlers an einer Universität mit Hilfe eines Blueprints . Konkret geht es dabei um die Kompetenz Seminare an der Universität durchführen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. DAS 4C/ID MODELL AM BEISPIEL BILDUNGSWISSENSCHAFTLER IM BEREICH DER LEHRE (UNIVERSITÄT)
- 2.1. Hierarchie der Fertigkeiten
- 2.2. Definition von Aufgabenklassen
- 2.3. Definition von Lernaufgaben
- 2.4. Unterstützende und just – in –time Informationen
- 3. THEORETISCHE BETRACHTUNG DES 4C/ID MODELLS
- 3.1. Lerntheoretische Überlegungen und Aspekte des situierten Lernens
- 3.2 Zur Integration in das 4C/ID Modell geeignete didaktische Szenarien
- 3.3. Unterstützende Medien für einen Blueprint
- 4. FAZIT UND REFLEXION EINER SITUIERTEN LERNUMGEBUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Gestaltung von Lernumgebungen, die auf die Vermittlung komplexer, kognitiver Fähigkeiten im Bereich der Bildungswissenschaft abzielen. Dabei wird das 4C/ID Modell als Grundlage für die Entwicklung eines Blueprints für die Qualifizierung von Bildungswissenschaftlern an Universitäten herangezogen.
- Das 4C/ID Modell und seine Anwendung im Bereich der Bildungswissenschaft
- Die Rolle des situierten Lernens und seiner Integration in das 4C/ID Modell
- Die Entwicklung und Gestaltung von Lernaufgaben im Rahmen des Modells
- Die Bedeutung von unterstützenden und zeitgerechten Informationen für den Lernerfolg
- Die Integration digitaler Medien in die Lernumgebung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den aktuellen Arbeitsmarkt und die wachsenden Anforderungen an Arbeitnehmer, die eine permanente Weiterbildung erfordern. Die Arbeit befasst sich mit der Kompetenzvermittlung und der Entwicklung von Lernumgebungen, die diesen Anforderungen gerecht werden. Das 4C/ID Modell wird als Grundlage für die Entwicklung eines Blueprints für die Qualifizierung von Bildungswissenschaftlern an Universitäten vorgestellt.
Kapitel 2 führt das 4C/ID Modell anhand des Beispiels der Qualifizierung von Bildungswissenschaftlern an Universitäten ein. Es werden die vier Komponenten des Modells erläutert und in zehn Schritte unterteilt, die den „Ten Steps of complex learning“ entsprechen. Die Hierarchie der Fertigkeiten, die Definition von Aufgabenklassen und Lernaufgaben sowie die Bedeutung von unterstützenden und zeitgerechten Informationen werden ausführlich dargestellt.
Kapitel 3 beleuchtet die theoretischen Hintergründe des 4C/ID Modells und setzt es in einen lerntheoretischen Zusammenhang. Es werden Aspekte des situierten Lernens sowie geeignete didaktische Szenarien für die Integration in das 4C/ID Modell vorgestellt. Des Weiteren werden die Einsatzmöglichkeiten von digitalen Medien im Rahmen des Blueprints diskutiert.
Schlüsselwörter
Das 4C/ID Modell, situiertes Lernen, Kompetenzvermittlung, Bildungswissenschaft, Blueprint, Aufgabenklassen, Lernaufgaben, unterstützende Informationen, Just-in-time Informationen, digitale Medien, Bildungsexpansion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 4C/ID Modell?
Das 4C/ID Modell (Four-Component Instructional Design) ist ein Ansatz zur Gestaltung von Lernumgebungen, die auf die Vermittlung komplexer kognitiver Fähigkeiten und Kompetenzen abzielen.
Welche Rolle spielt situiertes Lernen im 4C/ID Modell?
Situiertes Lernen betont, dass Lernen in Kontexten stattfinden sollte, die der späteren Anwendungspraxis ähneln, was im 4C/ID Modell durch die Gestaltung realitätsnaher Lernaufgaben umgesetzt wird.
Was sind Just-in-time Informationen?
Dies sind Informationen, die dem Lernenden genau in dem Moment zur Verfügung gestellt werden, in dem er sie zur Ausführung einer Teilaufgabe benötigt, um kognitive Überlastung zu vermeiden.
Warum ist Kompetenzvermittlung heute wichtiger als reines Faktenwissen?
Aufgrund des technologischen Fortschritts und steigender Anforderungen müssen Arbeitnehmer in der Lage sein, komplexe Probleme flexibel zu lösen, anstatt nur statisches Wissen abzurufen.
Was bedeutet der Begriff Bildungsexpansion?
Bildungsexpansion beschreibt den Trend zu immer höheren Bildungsabschlüssen und einer längeren Verweildauer im Bildungssystem, was die Anforderungen an universitäre Lehrmethoden erhöht.
Was ist ein Blueprint im Kontext der Lehre?
Ein Blueprint ist ein detaillierter Entwurf oder Plan für eine Lernumgebung, der festlegt, wie Aufgabenklassen, Lernaufgaben und unterstützende Informationen strukturiert sind.
- Citar trabajo
- Pascal Gries (Autor), 2011, Das 4C/ID Modell am Beispiel Bildungswissenschaftler/ -in im Bereich der Lehre (Universität), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177601