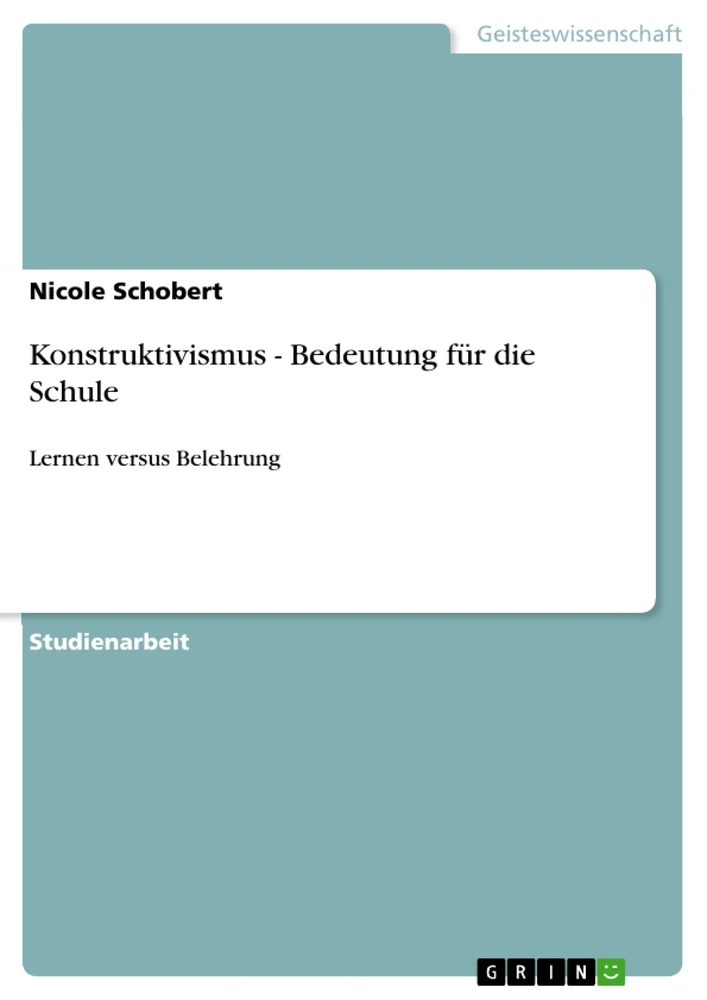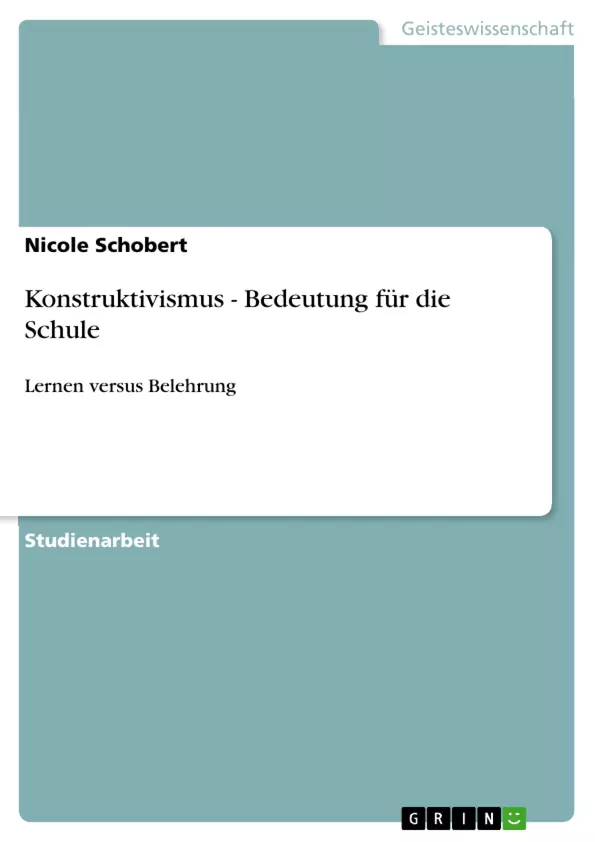Das menschliche Erleben, Erkennen und Lernen ist ein selbstkonstruierender Prozess. Dies ist die Kernaussage des Konstruktivismus, welche von den aktuellen Ergebnissen der Hirnforschung gestützt wird.
Ich werde in dieser Arbeit untersuchen, welche Konsequenzen diese Theorien für das „Wie“ des Lernens in der Schule haben und ob diese Berücksichtigung im deutschen Schulsystemfinden.
Einleitend gebe ich einen Überblick über die Inhalte konstruktivistischer Theorien. Dies geschieht zum einen aus der historischen Herleitung dieser ursprünglich philosophischen Strömung, und zum anderen über die spezifische Beleuchtung des „aktuellen“ oder auch „radikalen“ Konstruktivismus.
Letzteres werde ich über die Betrachtung der drei theoretischen Grundpfeiler des Konstruktivismus konkretisieren. Diese bilden sich aus dem Prinzip der undifferenzierten Codierung, der Theorie der Autopoiese und des Viabilitätskonzepts.
Die Vorstellung des Konstruktivismus schließe ich mit der Betrachtung aus ethischer Sicht ab.
Im Hauptteil (Kapitel 3) stelle ich den Bezug zwischen Schule und Konstruktivismus her. Dies geschieht beginnend über die Fokussierung auf die Ziele schulischen Lernens, definiert durch den gesellschaftlichen Anspruch, und führt weiter über die öffentliche Diskussion bzgl. der erreichten „Lernerfolge“ von Schule.
Im Folgenden werden konstruktivistische Ansätze des Lernens und Lehrens erörtert, sowie die aktuellen Erkenntnisse der Hirnforschung bzgl. des Lernens betrachtet.
Abschließend werde ich in Kapitel 3 die Projektmethode nach Karl Frey vorstellen, um die Möglichkeit einer praktischen Umsetzung des selbständigen, eigenverantwortlichen Lernens aufzuzeigen.
Im letzten Kapitel gehe ich auf die gesellschaftliche Position bzgl. der beleuchteten Lerntheorien und den damit verbunden Schlussfolgerungen ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Konstruktivismus
- Begriff und historische Herleitung des Konstruktivismus
- Der „aktuelle“ oder auch „radikale“ Konstruktivismus
- Das Prinzip der undifferenzierten Codierung
- Die Theorie der Autopoiese
- Das Viabilitätskonzept
- Die Ethik des Konstruktivismus
- Schule und Konstruktivismus
- Konstruktivistische Ansätze bzgl. des Lernens und Lehrens
- Erkenntnisse bzgl. des Lernens gemäß der Gehirnforschung
- Die Projektmethode nach Karl Frey - ein Beispiel für informelles Lernen
- Die Curriculumtheorie
- Symbiose des „Was“ und „Wie“ - der Schlüssel zum Erfolg
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung des Konstruktivismus für das Lernen in der Schule. Sie beleuchtet, welche Konsequenzen die konstruktivistischen Theorien für die Praxis des Lernens haben und ob diese im deutschen Schulsystem Berücksichtigung finden.
- Der Konstruktivismus als Theorie des selbstkonstruierenden Erlebens, Erkennens und Lernens
- Der „aktuelle“ oder „radikale“ Konstruktivismus mit seinen drei Grundpfeilern: dem Prinzip der undifferenzierten Codierung, der Theorie der Autopoiese und dem Viabilitätskonzept
- Die Relevanz konstruktivistischer Ansätze für die Gestaltung des Lernens und Lehrens in der Schule
- Die Ergebnisse der Hirnforschung im Hinblick auf das Lernen
- Die Projektmethode nach Karl Frey als Beispiel für eine praktische Umsetzung des eigenverantwortlichen Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Konstruktivismus als Theorie des selbstkonstruierenden Erlebens und Lernens vor und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet den „aktuellen“ Konstruktivismus und seine drei theoretischen Grundpfeiler. Es wird auch die Ethik des Konstruktivismus betrachtet. Kapitel 3 erörtert den Zusammenhang zwischen Schule und Konstruktivismus, betrachtet konstruktivistische Ansätze des Lernens und Lehrens und die Erkenntnisse der Hirnforschung. Abschließend wird die Projektmethode nach Karl Frey vorgestellt.
Schlüsselwörter
Konstruktivismus, Lernen, Schule, Belehrung, Selbstkonstruktion, Erkenntnisgewinnung, Hirnforschung, Projektmethode, Karl Frey
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage des Konstruktivismus?
Die Kernaussage ist, dass menschliches Erleben, Erkennen und Lernen ein aktiver, selbstkonstruierender Prozess ist und kein passives Abbild der Realität.
Was sind die drei Grundpfeiler des radikalen Konstruktivismus?
Diese bestehen aus dem Prinzip der undifferenzierten Codierung, der Theorie der Autopoiese (Selbsterzeugung) und dem Viabilitätskonzept (Gangbarkeit von Wissen).
Welche Konsequenzen hat der Konstruktivismus für die Schule?
Lernen wird als eigenverantwortlicher Prozess gesehen. Lehrer fungieren weniger als „Belehrende“, sondern als Gestalter von Lernumgebungen, die Selbstkonstruktion ermöglichen.
Was ist die Projektmethode nach Karl Frey?
Es ist ein Beispiel für praktisches, selbstständiges Lernen, bei dem die Schüler durch die Bearbeitung eines Projekts Wissen informell und eigenverantwortlich erwerben.
Wie stützt die Hirnforschung konstruktivistische Theorien?
Aktuelle Ergebnisse der Hirnforschung belegen, dass das Gehirn Informationen individuell verarbeitet und Wissen basierend auf bestehenden neuronalen Strukturen neu konstruiert.
Findet der Konstruktivismus im deutschen Schulsystem Berücksichtigung?
Die Arbeit untersucht genau diese Frage und analysiert die öffentliche Diskussion über Lernerfolge und die Umsetzung moderner Lerntheorien in der Praxis.
- Citation du texte
- Nicole Schobert (Auteur), 2011, Konstruktivismus - Bedeutung für die Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179715