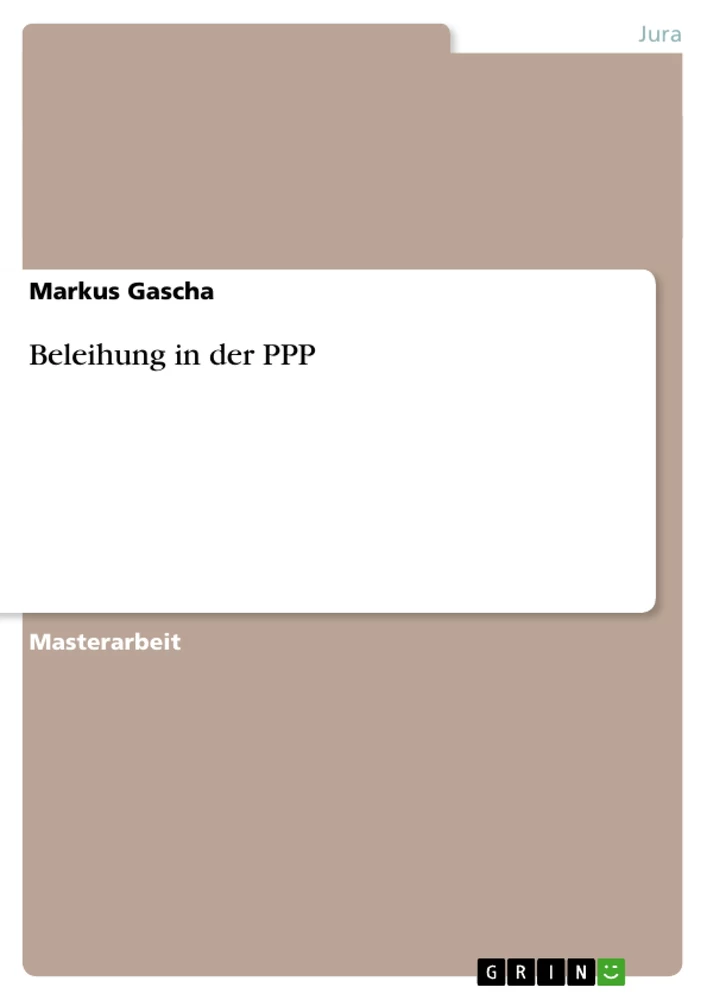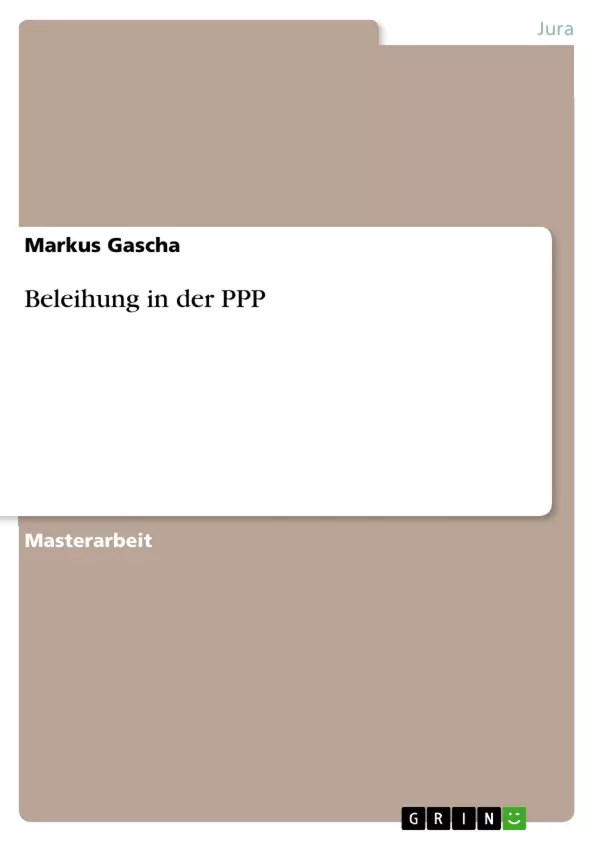Die öffentlichen Kassen sind allen Ortens leer. Wie lassen sich dennoch die Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge zuverlässig erfüllen oder gar wichtige Infrastrukturprojekte durchführen?
Bund, Länder und Gemeinden haben die Not zur Tugend gemacht und neue Kooperationsmodelle für sich entdeckt. Diese werden gemeinhin unter dem Begriff „Public Private Partnership“ oder kurz „PPP“ zusammengefasst. Was verbirgt sich hinter diesen Kunstbegriffen? Welche rechtlichen Hürden bestehen für PPP im Allgemeinen und die Beleihung eines privaten Unternehmers im Speziellen?
Diesen Fragen wird in dieser Masterarbeit nachgegangen. Anhand der Stiftung Elektro-Altgeräte Register in Fürth in Bayern wird untersucht, welches Potential Kooperationsformen zwischen Staat und Privaten bieten und zukünftig bieten können.
Inhaltsverzeichnis
- § 1 Grundlagen
- I. Die Privatisierung von Staatsaufgaben
- 1. Formelle Privatisierung
- 2. Funktionale Privatisierung
- 3. Vermögensprivatisierung
- 4. Materielle Privatisierung
- II. Public Private Partnerships
- 1. Der Begriff „Public Private Partnerships“
- 2. Gestaltungsmöglichkeiten in der PPP
- III. Beleihung
- 1. Der Begriff der Beleihung
- 2. Erscheinungsformen der Beleihung
- 3. Abgrenzung der Beleihung von anderen Rechtsinstituten der Einbeziehung Privater
- § 2 Privatisierung als Herausforderung der Staatsrechtswissenschaft
- I. Europarechtliche Vorgaben
- II. Verfassungsgrenzen von Privatisierungsvorhaben
- 1. Öffentliches Dienstrecht
- 2. Kompetenzverteilung der Art. 83 ff. GG
- 3. Demokratieprinzip
- 4. Rechtsstaatsprinzip
- 5. Sozialstaatsprinzip
- III. Schlussfolgerung
- § 3 Beleihung als Mittel der Privatisierung
- I. Anforderungen in verfassungsrechtlicher Hinsicht
- II. Vergaberecht als Beleihungshindernis?
- 1. Anwendungsbereich des Vergaberechts
- 2. Vergaberecht und Beleihung
- 3. Zusammenfassung
- III. Ausschreibungspflicht auf anderem Wege?
- 1. Art. 106 Abs. 2 AEUV (ex-Art. 86 Abs. 2 EG)
- 2. Beleihung als Beihilfe?
- 3. Kartellrechtlich indizierte Vergabepflicht?
- 4. Zusammenfassung
- IV. Staatliche Aufsichtspflicht
- V. Der beliehene Privatunternehmer im System des öffentlichen Haushalts- und Gebührenrechts
- 1. Der Beliehene als Unternehmer im Sinne des UStG
- 2. Unternehmerische Planungshoheit vor dem Hintergrund des öffentlich-rechtlichen Haushalts- und Gebührenrechts
- VI. Zusammenfassung
- § 4 Beleihung: ein modernes und effizientes Privatisierungsinstrument?
- I. Grundlagen der Beleihung nach dem ElektroG
- II. Beleihung der sog. Gemeinsamen Stelle der Hersteller (ElektroG)
- III. Interne Regelsetzung der Gemeinsamen Stelle der Hersteller
- 1. Funktionsvorbehalt und „interne Regelsetzung“
- 2. Rechtsnatur der Regeln im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ElektroG
- IV. Vergabefreie Beleihung nach dem ElektroG
- V. Zusammenfassung
- § 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Beleihung im Kontext von Public Private Partnerships (PPP) und deren verfassungsrechtliche Implikationen. Sie analysiert die Beleihung als Privatisierungsinstrument und beleuchtet die damit verbundenen rechtlichen Herausforderungen. Der Fokus liegt auf der Abgrenzung zur Ausschreibungspflicht und der Frage nach der Effizienz dieses Instruments.
- Privatisierung von Staatsaufgaben und deren rechtliche Rahmenbedingungen
- Public Private Partnerships und verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten
- Der Rechtsbegriff der Beleihung und dessen Abgrenzung zu anderen Rechtsinstituten
- Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Beleihung im Kontext der Privatisierung
- Vergaberechtliche Aspekte und deren Auswirkungen auf die Beleihung
Zusammenfassung der Kapitel
§ 1 Grundlagen: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die gesamte Arbeit. Es definiert zunächst den Begriff der Privatisierung und unterscheidet zwischen formeller, funktioneller, Vermögens- und materieller Privatisierung. Anschließend werden Public Private Partnerships (PPP) eingeführt, ihre verschiedenen Ausprägungen erläutert und der Begriff der Beleihung definiert und abgegrenzt. Die Kapitelteile bilden eine solide Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel, indem sie die zentralen Konzepte und Begrifflichkeiten einführen und differenzieren. Die Abgrenzung verschiedener Privatisierungsformen ist essenziell für die spätere Auseinandersetzung mit der Beleihung als spezifisches Instrument.
§ 2 Privatisierung als Herausforderung der Staatsrechtswissenschaft: Dieses Kapitel befasst sich mit den europarechtlichen Vorgaben und den verfassungsrechtlichen Grenzen von Privatisierungsvorhaben. Es analysiert die Auswirkungen von Privatisierungen auf das öffentliche Dienstrecht, die Kompetenzverteilung, das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und das Sozialstaatsprinzip. Die Kapitelteile untersuchen kritisch die potenziellen Konflikte zwischen der Effizienzsteigerung durch Privatisierung und dem Schutz grundlegender verfassungsrechtlicher Prinzipien. Die Berücksichtigung der verschiedenen Rechtsprinzipien zeigt die Komplexität der rechtlichen Bewertung von Privatisierungsmaßnahmen auf.
§ 3 Beleihung als Mittel der Privatisierung: Hier wird die Beleihung als Privatisierungsinstrument im Detail untersucht. Es werden die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Beleihung beleuchtet und die potenziellen Konflikte mit dem Vergaberecht analysiert. Die Kapitelteile untersuchen verschiedene Auslegungsmöglichkeiten des Vergaberechts im Kontext der Beleihung und diskutieren alternative Möglichkeiten der Ausschreibung. Die staatliche Aufsichtspflicht und die Rolle des beliehenen Privatunternehmers im öffentlichen Haushalts- und Gebührenrecht werden ebenfalls behandelt. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Zulässigkeit und der Gestaltung von Beleihungsverhältnissen unter Beachtung der einschlägigen Rechtsnormen.
§ 4 Beleihung: ein modernes und effizientes Privatisierungsinstrument?: Dieses Kapitel untersucht die Beleihung anhand des Beispiels des Elektrogesetzes (ElektroG). Es analysiert die Beleihung der Gemeinsamen Stelle der Hersteller und die damit verbundene interne Regelsetzung. Die Kapitelteile untersuchen die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine vergabefreie Beleihung möglich ist. Die Analyse des ElektroG dient als Fallstudie, um die praktischen Anwendungsmöglichkeiten und die Herausforderungen der Beleihung als Privatisierungsinstrument zu illustrieren. Die Frage nach der Effizienz wird anhand des konkreten Beispiels kritisch hinterfragt.
Schlüsselwörter
Privatisierung, Public Private Partnerships (PPP), Beleihung, Vergaberecht, Staatsrecht, Verfassungsrecht, Europarecht, ElektroG, öffentliches Dienstrecht, Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip, öffentlicher Haushalt.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Privatisierung durch Beleihung
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit untersucht die Beleihung als Privatisierungsinstrument im Kontext von Public Private Partnerships (PPP) und deren verfassungsrechtliche Implikationen. Schwerpunkte sind die Abgrenzung zur Ausschreibungspflicht und die Effizienz dieses Instruments.
Welche Arten der Privatisierung werden behandelt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen formeller, funktioneller, Vermögens- und materieller Privatisierung und beleuchtet Public Private Partnerships (PPP) als spezifische Form der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor. Die Beleihung wird als ein besonderes Privatisierungsinstrument detailliert analysiert.
Welche Rechtsgebiete werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst Staatsrecht, Verfassungsrecht, Europarecht und Vergaberecht. Sie untersucht die verfassungsrechtlichen Grenzen von Privatisierungsvorhaben unter Berücksichtigung des öffentlichen Dienstrechts, des Demokratieprinzips, des Rechtsstaatsprinzips und des Sozialstaatsprinzips.
Wie wird der Begriff der "Beleihung" definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert den Begriff der Beleihung und grenzt ihn von anderen Rechtsinstituten der Einbeziehung Privater ab. Die Abgrenzung zur Ausschreibungspflicht ist ein zentrales Thema der Arbeit.
Welche verfassungsrechtlichen Anforderungen werden an die Beleihung gestellt?
Die Arbeit analysiert die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Beleihung im Kontext der Privatisierung. Sie untersucht mögliche Konflikte mit dem Vergaberecht und diskutiert alternative Ausschreibungsmöglichkeiten.
Welche Rolle spielt das Vergaberecht?
Die Arbeit analysiert die potenziellen Konflikte zwischen der Beleihung und dem Vergaberecht. Sie untersucht den Anwendungsbereich des Vergaberechts und diskutiert die Frage, ob eine Beleihung als Beihilfe im Sinne des EU-Rechts gewertet werden kann.
Wie wird die staatliche Aufsichtspflicht behandelt?
Die Arbeit behandelt die staatliche Aufsichtspflicht über beliehene Privatunternehmen und deren Rolle im öffentlichen Haushalts- und Gebührenrecht.
Wird die Effizienz der Beleihung als Privatisierungsinstrument untersucht?
Die Arbeit untersucht kritisch die Effizienz der Beleihung als Privatisierungsinstrument, unter anderem anhand des Beispiels des Elektrogesetzes (ElektroG).
Welche Rolle spielt das ElektroG in der Arbeit?
Das Elektrogesetz (ElektroG) dient als Fallstudie zur Analyse der Beleihung in der Praxis. Die Arbeit untersucht die Beleihung der Gemeinsamen Stelle der Hersteller und die damit verbundene interne Regelsetzung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Privatisierung, Public Private Partnerships (PPP), Beleihung, Vergaberecht, Staatsrecht, Verfassungsrecht, Europarecht, ElektroG, öffentliches Dienstrecht, Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip, öffentlicher Haushalt.
- Citation du texte
- LL.M. Markus Gascha (Auteur), 2011, Beleihung in der PPP, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181002