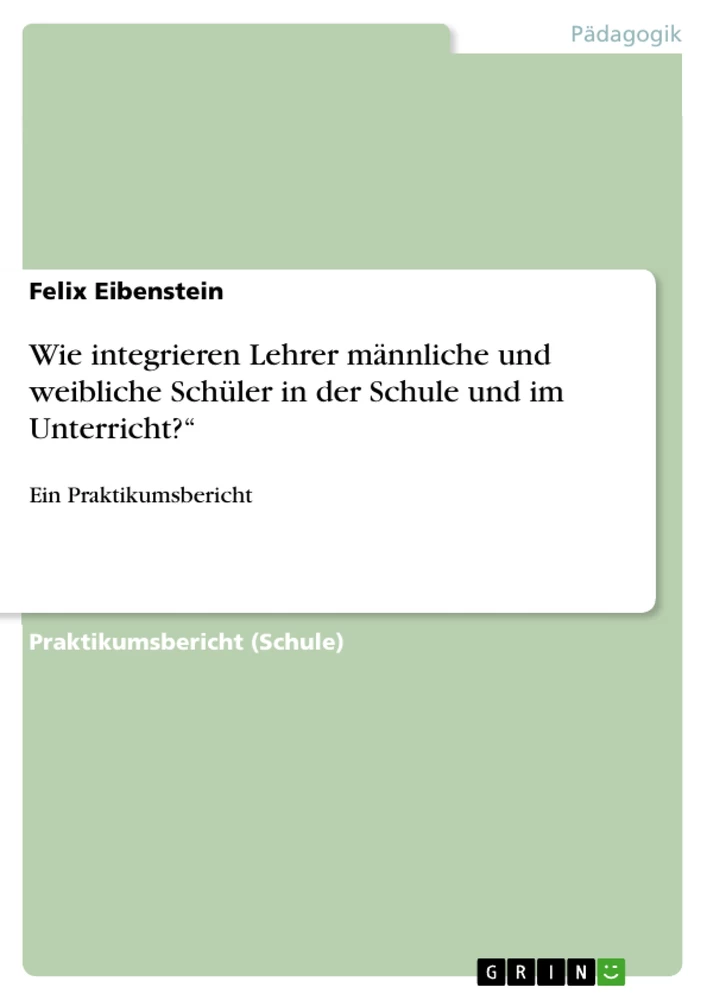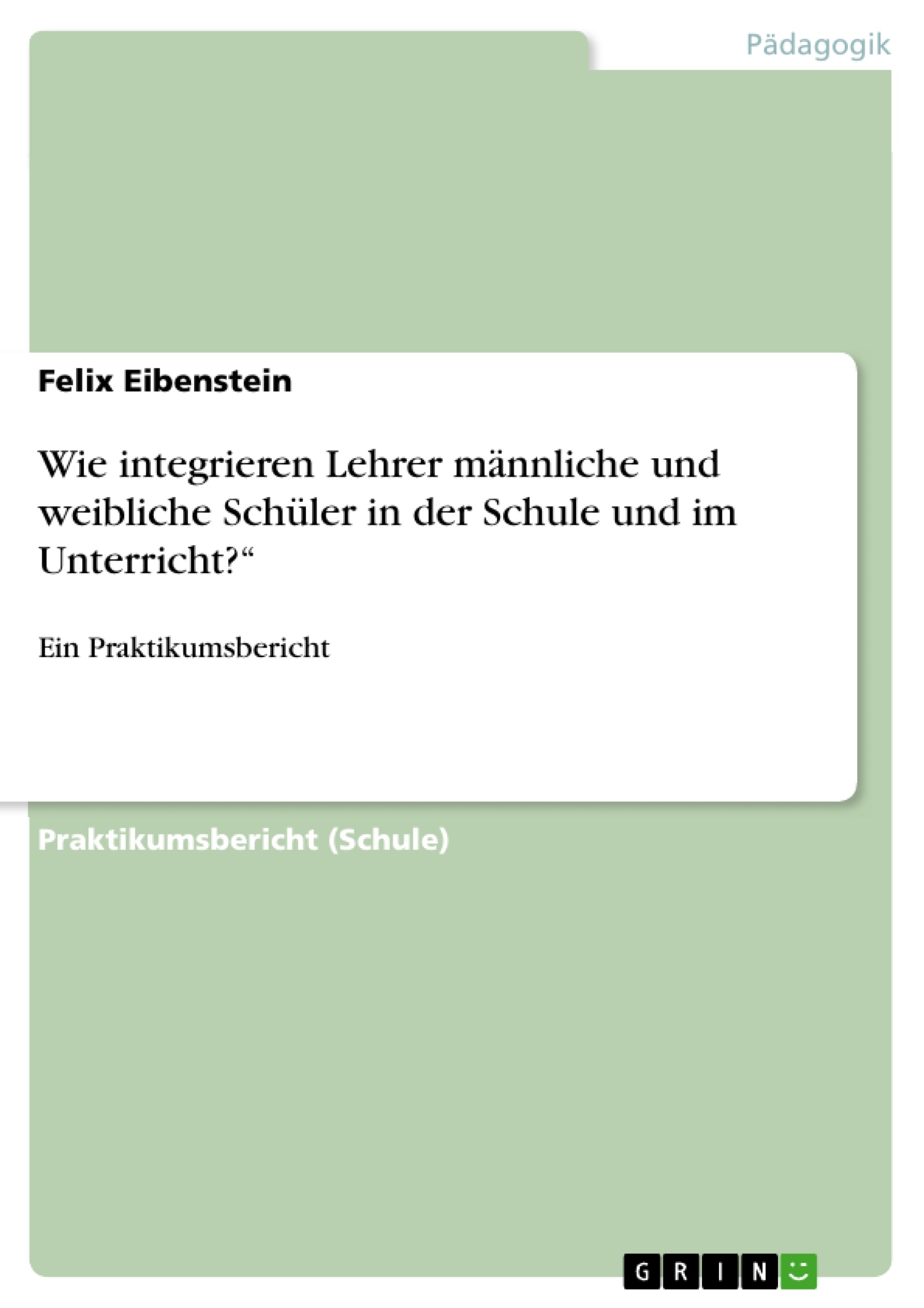Dieser Bericht erörtert die Frage nach den geschlechterspezifischen Unterschieden im Unterricht und wie Lehrer mit selbigen umgehen. Die Erkenntnisse aus 4 Wochen Praktikum fließen hier vollkommen ein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Die Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf
- 2. Ziele und methodische Vorgehensweise
- 3. Integration im Unterricht
- 3.1. Beteiligung am Frontalunterricht
- 3.2. Partner- und Gruppenarbeit
- 3.3. Projekt „Rock Challenge“
- 4. Umgang mit den Schülern außerhalb des Unterrichts
- 5. Ergebnisreflexion
- 6. Fazit und Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Praktikumsbericht untersucht, wie Lehrer männliche und weibliche Schüler an der Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf in den Unterricht integrieren. Die Studie fokussiert auf die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern beider Geschlechter und untersucht, ob bestimmte Gruppen aufgrund ihrer Dominanz in der Schülerschaft bevorzugt werden. Die methodische Vorgehensweise beinhaltet sowohl quantitative Beobachtungen im Unterricht als auch qualitative Gespräche mit Lehrkräften.
- Integration von männlichen und weiblichen Schülern im Unterricht
- Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern unterschiedlichen Geschlechts
- Beteiligung von Jungen und Mädchen am Frontalunterricht
- Einfluss der Geschlechterverteilung in den Klassen auf die Unterrichtsbeteiligung
- Methoden der Integration im Schulalltag
Zusammenfassung der Kapitel
1. Die Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf: Dieses Kapitel beschreibt die Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf, ihre räumlichen Gegebenheiten, die Schülerstruktur (knapp 250 Schüler aus umliegenden Ortschaften) und ihre Organisation als Gemeinschaftsschule, die Realschulabschluss und Abitur parallel anbietet. Es wird die Kooperation mit dem Gymnasium „Luisenstift“ in Radebeul erwähnt, welche einen fließenden Übergang ermöglicht. Der Bericht erläutert die Zuweisung einer Mentorin und die Entscheidung, über den eigenen Fachbereich (Geschichte und Physik) hinaus Beobachtungen bei verschiedenen Lehrern durchzuführen, um die Fragestellung nach dem Umgang von Lehrern mit männlichen und weiblichen Schülern umfassender zu untersuchen. Die Einordnung der Fragestellung in den Bereich „Umgang mit Heterogenität: Integration in der Schule“ wird hervorgehoben.
2. Ziele und methodische Vorgehensweise: Dieses Kapitel definiert die Ziele der Studie: die Untersuchung der Integration von Jungen und Mädchen im Unterricht und die Analyse der Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern beider Geschlechter. Es wird die methodische Vorgehensweise detailliert beschrieben: Eine empirische Erhebung in Form von Strichlisten zur Erfassung der Unterrichtsbeteiligung von Jungen und Mädchen im Frontalunterricht. Die Zählung der Schüler nach Geschlecht und Klassenstufe wird ebenfalls erwähnt, um eine durchschnittliche Verteilung aufzuzeigen. Zusätzlich wurden Gespräche mit Lehrkräften geführt, wobei Gedankenprotokolle anstatt detaillierter Gesprächsprotokolle erstellt wurden. Die Grenzen der gewählten Methode, wie z.B. die Möglichkeit von Auslassungen bei der Zählung der Schüler, werden offen angesprochen.
3. Integration im Unterricht: Dieses Kapitel befasst sich mit der Integration von Schülern im Unterricht, wobei der Begriff der Integration allgemein als die Verbindung von Personen und Gruppen zu einer gesellschaftlichen Einheit definiert wird. Der Fokus liegt auf der Beteiligung am Frontalunterricht. Die Ergebnisse der empirischen Erhebung zeigen, dass Mädchen im Frontalunterricht häufiger von Lehrern aufgefordert werden, sich zu beteiligen als Jungen. Dieser Befund wird im Kontext der unterschiedlichen Geschlechterverhältnisse in den einzelnen Klassenstufen diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass in Klassen mit einer Mädchenmehrheit auch mehr Mädchen am Unterricht teilnehmen. Die Analyse zeigt einen Trend, der von der Verteilung der Geschlechter abhängig zu sein scheint, ohne dabei von einer massiven Benachteiligung der Jungen auszugehen.
Schlüsselwörter
Integration, Geschlechterdifferenzierung, Schule, Unterricht, Frontalunterricht, Lehrer-Schüler-Beziehung, Mädchen, Jungen, Heterogenität, empirische Erhebung, Gemeinschaftsschule.
Häufig gestellte Fragen zum Praktikumsbericht: Integration an der Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf
Welche Schule ist Gegenstand des Praktikumsberichts?
Der Bericht befasst sich mit der Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf, einer Gemeinschaftsschule mit ca. 250 Schülern aus umliegenden Ortschaften, die sowohl den Realschulabschluss als auch das Abitur anbietet. Es besteht eine Kooperation mit dem Gymnasium „Luisenstift“ in Radebeul.
Was ist die zentrale Fragestellung des Praktikumsberichts?
Der Bericht untersucht die Integration männlicher und weiblicher Schüler im Unterricht an der Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf und analysiert die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern beider Geschlechter. Ein Fokus liegt darauf, ob bestimmte Gruppen aufgrund ihrer Dominanz in der Schülerschaft bevorzugt werden.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden. Quantitativ wurden im Unterricht Beobachtungen mittels Strichlisten durchgeführt, um die Beteiligung von Jungen und Mädchen am Frontalunterricht zu erfassen. Qualitativ wurden Gespräche mit Lehrkräften geführt, wobei Gedankenprotokolle anstatt detaillierter Transkripte erstellt wurden.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die quantitative Erhebung zeigt, dass Mädchen im Frontalunterricht häufiger von Lehrern zur Teilnahme aufgefordert werden als Jungen. Dieser Befund wird im Kontext der unterschiedlichen Geschlechterverhältnisse in den einzelnen Klassenstufen diskutiert. Ein Trend deutet darauf hin, dass in Klassen mit einer Mädchenmehrheit auch mehr Mädchen am Unterricht teilnehmen. Es wird jedoch betont, dass keine massive Benachteiligung der Jungen festgestellt wurde.
Welche Kapitel umfasst der Bericht?
Der Bericht gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Die Kurfürst-Moritz-Schule Boxdorf; 2. Ziele und methodische Vorgehensweise; 3. Integration im Unterricht (inkl. Unterkapitel zu Frontalunterricht, Partner-/Gruppenarbeit und dem Projekt „Rock Challenge“); 4. Umgang mit den Schülern außerhalb des Unterrichts; 5. Ergebnisreflexion; 6. Fazit und Schlussbemerkungen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die zentralen Themen sind die Integration von männlichen und weiblichen Schülern, die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern unterschiedlichen Geschlechts, die Beteiligung von Jungen und Mädchen am Frontalunterricht, der Einfluss der Geschlechterverteilung auf die Unterrichtsbeteiligung und die Methoden der Integration im Schulalltag.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Bericht?
Schlüsselwörter sind: Integration, Geschlechterdifferenzierung, Schule, Unterricht, Frontalunterricht, Lehrer-Schüler-Beziehung, Mädchen, Jungen, Heterogenität, empirische Erhebung, Gemeinschaftsschule.
Welche Einschränkungen der Methodik werden genannt?
Der Bericht benennt die Möglichkeit von Auslassungen bei der Zählung der Schüler als eine Einschränkung der quantitativen Methode. Die Verwendung von Gedankenprotokollen anstelle detaillierter Gesprächsprotokolle stellt eine weitere Limitation dar.
- Quote paper
- Felix Eibenstein (Author), 2010, Wie integrieren Lehrer männliche und weibliche Schüler in der Schule und im Unterricht?“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181780