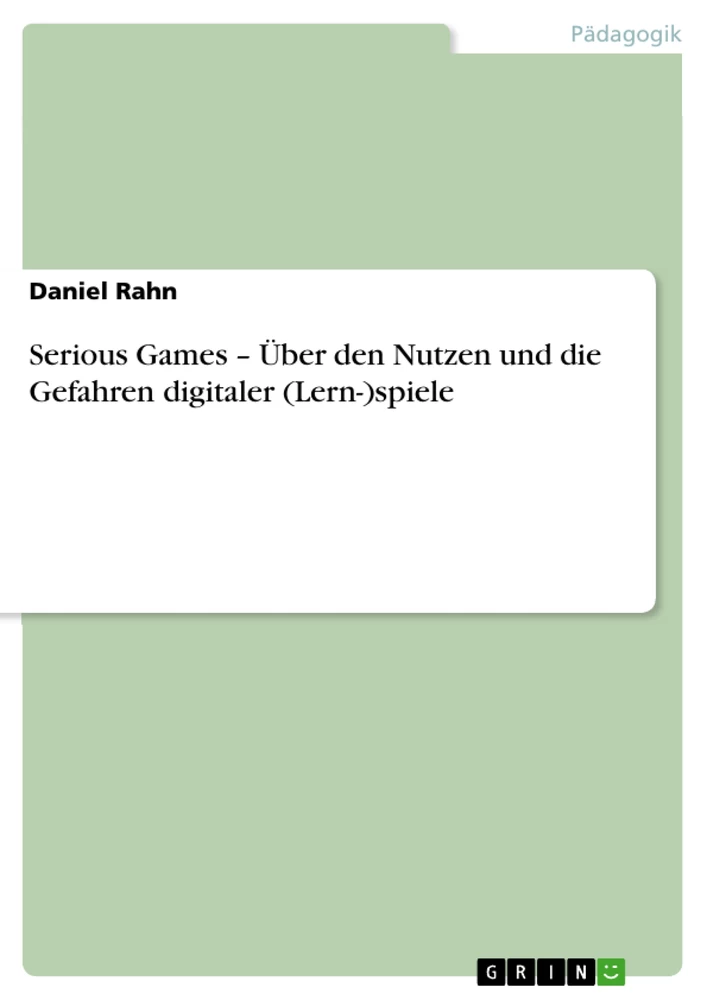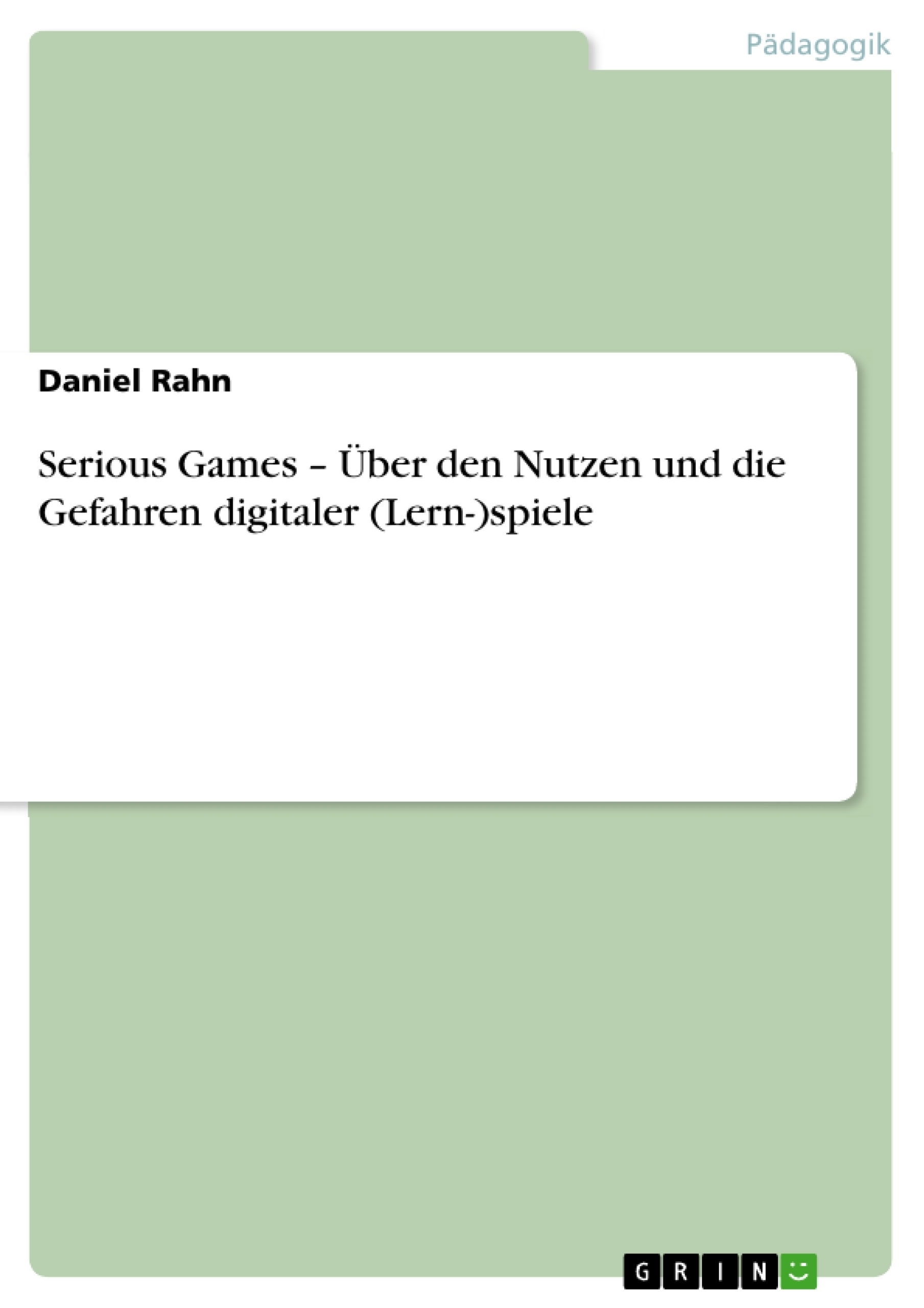In den meisten öffentlichen Diskussionen und den medialen Berichterstattungen werden digi-tale Spiele oft misstrauisch betrachtet und analysiert, oft wird ihnen auch mit Ablehnung ge-genübergetreten . In manchen Fällen werden die jeweiligen Nutzer – gerade die der sogenann-ten Killerspiele, Ego-Shooter oder Besucher sogenannter LAN-Partys – diffamiert und/oder beleidigt, wie kürzlich in der Sendung „Explosiv“ vom 19.08.2011 des privaten Senders RTL. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Computerspiele negativen Einfluss auf die Nutzer haben und diese u.U. sozial isolieren, sie süchtig oder aggressiv machen .
Für fast alle Kinder, Jugendliche („digital natives“) und immer mehr Erwachsene („digital immigrants“ ) sind digitale Spiele jedoch inzwischen fester Bestandteil der Lebenswelt. Sie fesseln die Spieler durch ein Potpourie aus Faszinationskraft, Virtualität, Realität, Interaktion, Präsenz, Involvierung und Narrativität und sind mittlerweile ein beachtlicher Wirtschaftsfak-tor mit zweistelligen Zuwachsraten. In Deutschland werden jährlich zwei Milliarden Euro und weltweit zwischen 25 bis 30 Milliarden Euro für digitale Spiele ausgegeben .
Vor diesem finanziellen Hintergrund, der wachsenden Begeisterung für respektive dem wach-senden Kontakt mit Computerspielen sowie aufgrund des einsetzenden Wandels der Sichtwei-sen auf und über digitale Spiele, erscheint es nicht verwunderlich, ja sogar legitim, dass die Branche und die Entwickler dieses Phänomen instrumentalisieren, was dann u.a. „in der Frage nach der Möglichkeit mündet, Computerspiele(n) für pädagogische Zwecke zu nutzen“ – durch Angebote der Gattungen Serious Games, Edutainment oder Game-based Learning. Da-bei ist von Beginn an wichtig festzuhalten, dass bei Serious Games (aber auch Edutainment und Games-based Learning) Bildung nicht i.S. von Ausbildung oder Lernen verstanden wer-den sollte, kann und darf, sondern eher i.S. „der humanistischen Bildungstheorie als selbstre-flexiver Prozess der Veränderung der Welt- und Selbstreferenzen“ zu verstehen ist. Es ist also durchaus lohnenswert einerseits den finanziellen Gewinn zu optimieren, indem man sich dem wachsenden Interesse und dem Umdenken der digitalen Spiele bedient, und sich durch digitale Lernspiele der Gattungen Serious Games, Edutainment, oder Game-based Learning Zugang zu einem neuen absatzstarken Markt, dem der Pädagogik und Bildung verschafft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 2.1 Definition Spielen
- 2.2 Definition Game-based Learning
- 2.3 Definition Edutainment
- 2.4 Definition Serious Games
- 3. Reflexion der Gruppenarbeit und des Referats zum Thema „Serious Games“
- 3.1 Reflexion der Gruppenarbeit
- 3.2 Reflexion des Vortrages und der im Seminar entstandenen Diskussion
- 4. Über den Nutzen und die Chancen digitaler (Lern-)spiele
- 5. Über die Risiken und Gefahren digitaler (Lern-)spiele
- 6. Resümee und Ausblick
- 7. Anhang
- 8. Literaturverzeichnis
- 9. Internetverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Nutzen und die potenziellen Gefahren digitaler Lernspiele, insbesondere Serious Games, Edutainment und Game-based Learning, für Kinder und Jugendliche. Der Fokus liegt auf der Analyse des Beitrags solcher Spiele zum Erkenntnisgewinn, Wissenszuwachs, der Entwicklung motorischer Fähigkeiten, der Gesundheitsförderung und dem Kompetenzerwerb. Gleichzeitig werden mögliche Risiken der Nutzung beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung von Serious Games, Edutainment und Game-based Learning
- Analyse des Nutzens digitaler Lernspiele für kognitive, motorische und soziale Entwicklung
- Untersuchung potenzieller Risiken und Gefahren der Nutzung digitaler Spiele
- Reflexion der Gruppenarbeit und des Referats zum Thema "Serious Games"
- Einordnung der Thematik im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und wirtschaftlicher Interessen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert den aktuellen Diskurs um digitale Spiele und deren kontroverse Wahrnehmung. Kapitel 2 klärt die Begriffe "Spielen", "Game-based Learning", "Edutainment" und "Serious Games", wobei die Schwierigkeiten bei der wissenschaftlichen Abgrenzung dieser Konzepte hervorgehoben werden. Die Reflexion der Gruppenarbeit und des Vortrags (Kapitel 3) wird thematisiert, ohne konkrete Inhalte zu verraten. Kapitel 4 widmet sich den Chancen und dem Nutzen digitaler Lernspiele, während Kapitel 5 die potenziellen Risiken und Gefahren beleuchtet.
Schlüsselwörter
Serious Games, Edutainment, Game-based Learning, digitale Lernspiele, Kinder, Jugendliche, Nutzen, Risiken, Gefahren, kognitive Entwicklung, motorische Fähigkeiten, soziale Entwicklung, Bildung, Pädagogik, Humankapital.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Serious Games?
Serious Games sind digitale Spiele, die primär für pädagogische oder informative Zwecke und nicht nur zur Unterhaltung entwickelt wurden.
Was ist der Unterschied zwischen Edutainment und Game-based Learning?
Edutainment vermischt Bildung und Unterhaltung, während Game-based Learning den gezielten Einsatz von Spielelementen in Lernprozessen beschreibt.
Welchen Nutzen haben digitale Lernspiele für Kinder?
Sie können den Wissenszuwachs fördern, motorische Fähigkeiten trainieren und soziale Kompetenzen durch Interaktion stärken.
Welche Risiken bergen Computerspiele laut der Arbeit?
Diskutiert werden Gefahren wie soziale Isolation, Suchtpotenzial und die mögliche Steigerung von Aggressionen.
Wer sind "Digital Natives" und "Digital Immigrants"?
Digital Natives sind mit digitalen Medien aufgewachsen (Kinder/Jugendliche), während Digital Immigrants diese Technologien erst im Erwachsenenalter erlernt haben.
- Quote paper
- Daniel Rahn (Author), 2011, Serious Games – Über den Nutzen und die Gefahren digitaler (Lern-)spiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182912