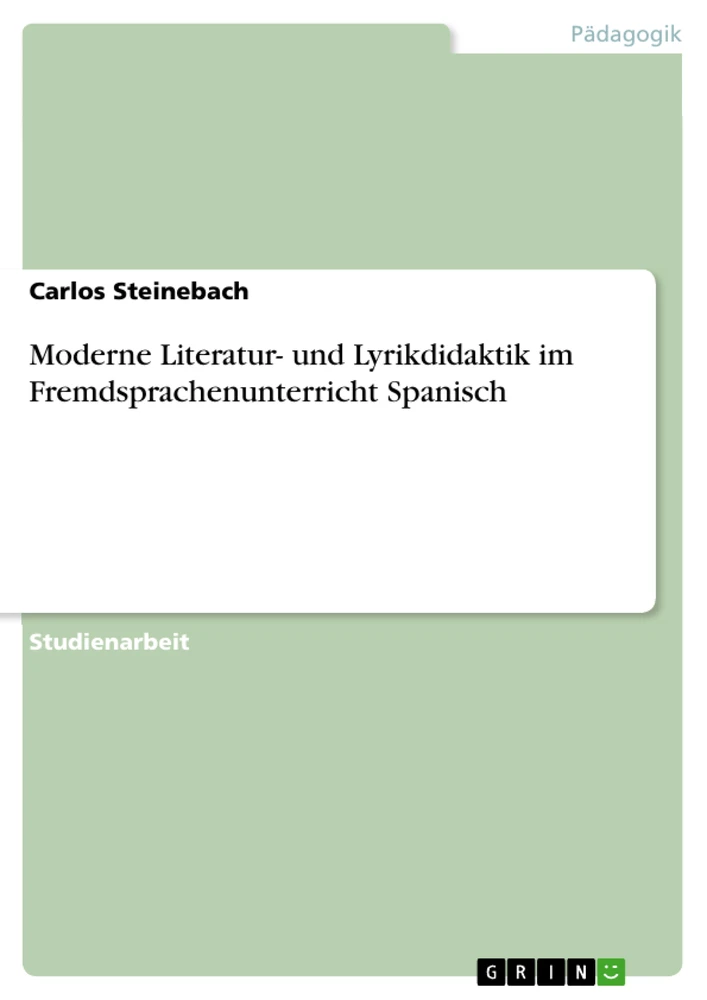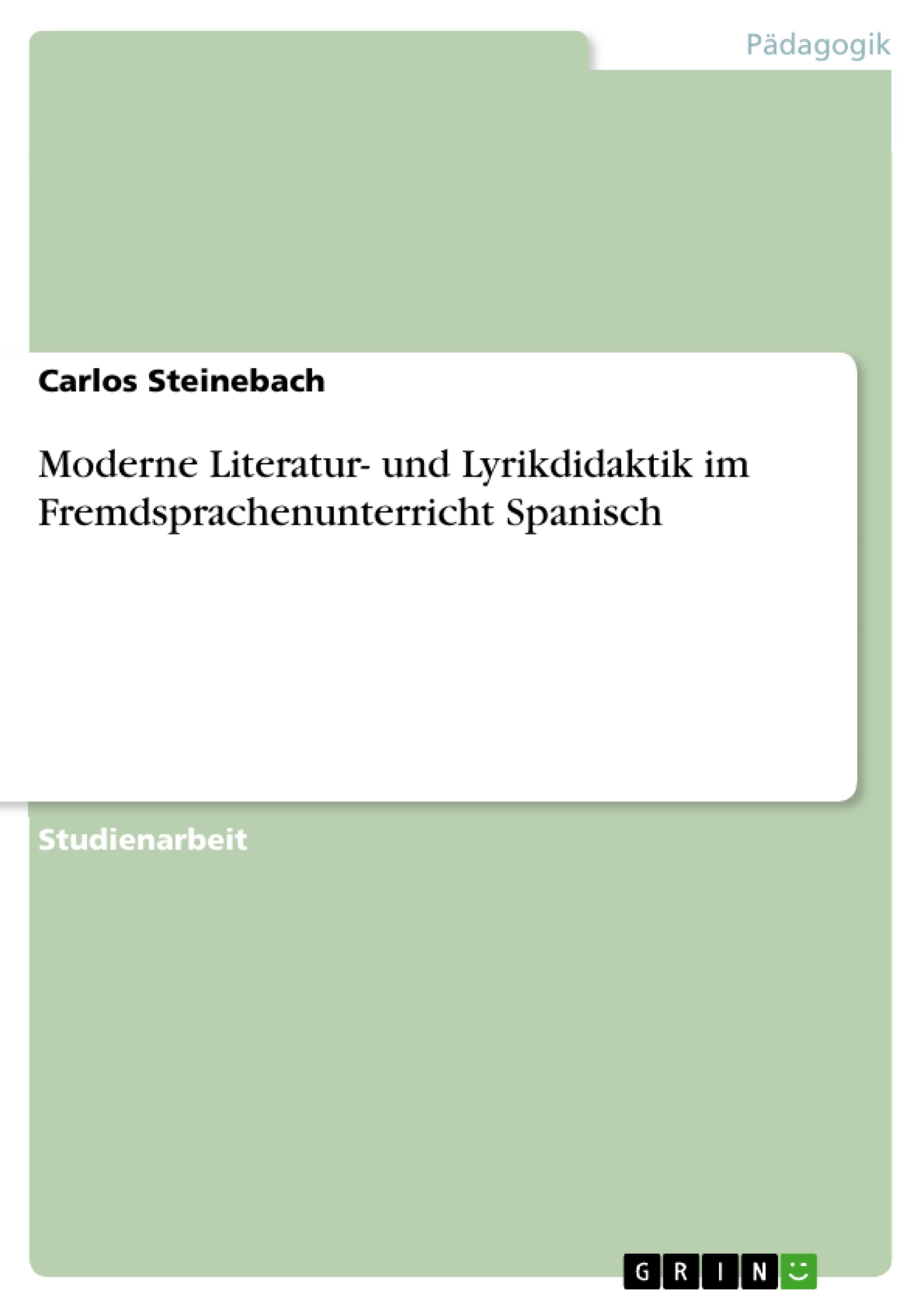„Gedichte spielen weder im Mutter- noch im Fremdsprachenunterricht eine wichtige Rolle. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Einer der Gründe besteht wohl darin, dass sie bei Schülern nicht beliebt sind.“
Diese Aussage ist aktuell und die Einstellung war schon früher bei Lernenden zu finden, nämlich dass Lyrik im Allgemeinen unverständliche und komplizierte Texte sind, die man einer rhetorischen Analyse unterziehen muss und damit die Unterrichtseinheit beendet ist. Ein solch negatives Bild der Gedichte ist zu großen Teilen die Schuld eines wenig motivierenden Unterrichts. Die Lyrikdidaktik ist, vor allem im Fremdsprachenunterricht, kein Schwerpunktthema, sodass moderne Methoden und Ansätze rar sind. Für das Fach Spanisch gibt es noch weniger spezielle Literatur als beispielsweise für das Fach Französisch, die einen angemessenen Lyrikunterricht für Schülerinnen und Schüler bieten kann. Überregional anerkannte Standards sind für die zweite und/oder dritte Fremdsprache (noch) nicht vorhanden, sodass der Unterricht auf den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen zurückgreifen muss.
Daher sollen in dieser Arbeit Aufsätze für einen modernen Lyrikunterricht im Fach Spanisch skizziert werden. Dafür ist es, aufgrund der fehlenden einschlägigen Literatur, naheliegend und erforderlich, die Bestimmungen und Methoden aus anderen Fremdsprachendidaktiken zu analysieren und sinngemäß auf den Spanischunterricht zu übertragen. Zunächst analysiert diese Arbeit die neuere Geschichte der Fremdsprachendidaktik, um die Entwicklung zu erkennen und unterschiedliche Trends zu ermitteln. Dabei wird vor allem auf den gegenwärtig wichtigsten Aspekt der Lernerautonomie eingegangen und die Fragen, wieso diese Ausrichtung so vielversprechend ist. Daraufhin wird explizit die Literaturdidaktik näher betrachtet und die beiden letzten Strömungen, der New Criticism und die Rezeptionsästhetik beleuchtet, miteinander verglichen und die Einflüsse auf die heutige Didaktik erläutert. Von diesen Erkenntnissen ausgehend, wird explizit der kreative Ansatz behandelt, der im Fremdsprachenunterricht Schülerinnen und Schülern einen neuen Zugang zu Literatur bieten soll. Wie dies realisiert wird und was der Unterschied zum traditionellen Literaturunterricht ist, soll damit gezeigt werden. Am Ende der Arbeit steht ein Absatz zum konkreten Umgang mit Lyrik im Unterricht. Dabei spielen das Verständnis und der richtige Umgang mit dieser Gattung eine zentrale Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abriss des aktuellen Forschungsstandes des modernen Fremdsprachenunterrichts
- Lernerautonomie
- Literatur im Fremdsprachenunterricht
- Der kreative Ansatz
- Der Umgang mit Lyrik im modernen Fremdsprachenunterricht
- Die kreative Analyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich dem Thema Lyrik im Spanischunterricht und skizziert Aufsätze für einen modernen, kreativen Umgang mit dieser Gattung. Aufgrund des Mangels an einschlägiger Literatur für den Spanischunterricht werden Methoden aus anderen Fremdsprachendidaktiken analysiert und auf den Spanischunterricht übertragen.
- Analyse der Entwicklung der Fremdsprachendidaktik und der Bedeutung von Lernerautonomie
- Vergleich von New Criticism und Rezeptionsästhetik und deren Einfluss auf die heutige Didaktik
- Erörterung des kreativen Ansatzes im Fremdsprachenunterricht und dessen Bedeutung für einen neuen Zugang zu Literatur
- Behandlung des Umgangs mit Lyrik im Unterricht, insbesondere die Rolle von Verständnis und dem richtigen Umgang mit der Gattung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung thematisiert die geringe Rolle von Gedichten im Muttersprachen- und Fremdsprachenunterricht und die Gründe dafür, insbesondere die negative Wahrnehmung von Lyrik bei Lernenden. Sie argumentiert für einen motivierenderen Lyrikunterricht und hebt die Bedeutung des kreativen Ansatzes hervor. Die Arbeit zielt darauf ab, Aufsätze für einen modernen Lyrikunterricht im Fach Spanisch zu skizzieren, indem sie Erkenntnisse aus anderen Fremdsprachendidaktiken nutzt.
Abriss des aktuellen Forschungsstandes des modernen Fremdsprachenunterrichts
Dieser Abschnitt betrachtet die Entwicklung der Fremdsprachendidaktik in Deutschland, beginnend mit den 1960er Jahren. Es werden die historischen und gesellschaftlichen Faktoren beleuchtet, die den Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen verstärkten. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von der Grammatik-Übersetzungmethode hin zu einem kommunikativen Ansatz, der Lernerautonomie und Interkulturellem Lernen betont. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Strömungen der Fremdsprachendidaktik und deren Bedeutung für den heutigen Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Lyrik im Fremdsprachenunterricht oft vernachlässigt?
Häufig wird Lyrik als unverständlich und kompliziert wahrgenommen, zudem mangelt es an motivierenden Unterrichtsmethoden und spezieller Fachliteratur für Fächer wie Spanisch.
Was ist das Ziel dieser Arbeit zur Spanischdidaktik?
Die Arbeit skizziert Ansätze für einen modernen Lyrikunterricht im Fach Spanisch, indem sie Methoden aus anderen Fremdsprachendidaktiken analysiert und überträgt.
Welche Rolle spielt die Lernerautonomie?
Lernerautonomie wird als gegenwärtig wichtigster Aspekt der Fremdsprachendidaktik untersucht, um die Motivation und Selbstständigkeit der Schüler zu fördern.
Welche literaturdidaktischen Strömungen werden verglichen?
Die Arbeit beleuchtet und vergleicht den "New Criticism" und die "Rezeptionsästhetik" sowie deren Einflüsse auf die heutige Didaktik.
Was beinhaltet der kreative Ansatz im Literaturunterricht?
Der kreative Ansatz soll Schülern einen neuen Zugang zur Literatur bieten und unterscheidet sich deutlich vom traditionellen, rein analytischen Literaturunterricht.
- Quote paper
- Carlos Steinebach (Author), 2011, Moderne Literatur- und Lyrikdidaktik im Fremdsprachenunterricht Spanisch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183931