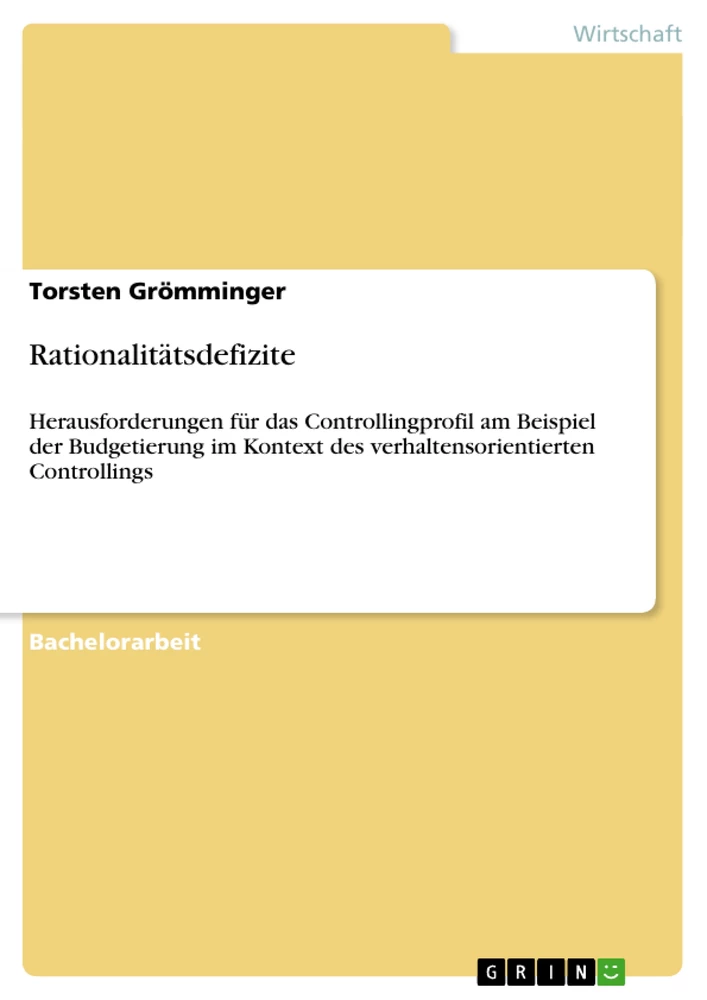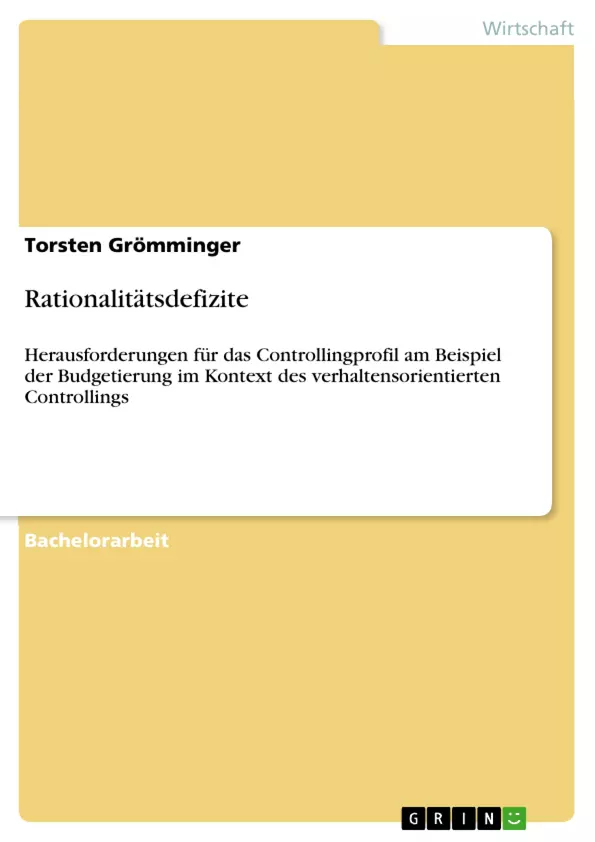Quo vadis Controlling?
Das Controlling ist ein junges betriebswirtschaftliches Forschungsgebiet mit praxisorientiertem Ursprung. Trotzdem ist es in der Lehre der betriebswirtschaftlichen Studiengänge mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Es ist seit jeher einem steten Wandel unterworfen, es befindet sich quasi in einem Selbstfindungsprozess. Und ebenso verhält es sich mit den Aufgaben des Controllers, der sich vom Zahlenknecht zum Businesspartner und Counterpart des Managements entwickelt hat, bzw. haben sollte. Der Alltag ist voller Phänomene, die mit den bisherigen Erkenntnissen und Methoden nicht mehr adäquat erklärt werden können. Bisher wird Controlling mit Rationalität, Nüchternheit, Analytik und Zahlenfixiertheit assoziiert. Neben den Fakten besteht kein Platz für Emotionen oder Intuition. Doch angelsächsische Forscher kamen vor einiger Zeit zu der Überzeugung, dass es zwischen betriebswirtschaftlichen und verhaltenswissenschaftlichen Fragestellungen nicht zu leugnende Schnittmengen gibt.
Der Controller muss nicht nur Messinstrumente als Grundlage einer Orientierung oder Koordination zur Verfügung stellen, vielmehr muss er auch auf Eigenschaften, Präferenzen oder Zielvorstellungen der Manager eingehen können. Dies alles differiert von Mensch zu Mensch, da jeder einen individuellen Charakter besitzt. Je nach Situation muss der Controller in der Lage sein abzuschätzen, ob es sich um ein eigenes Ziel des Managers oder um ein Unternehmensziel handelt und die Menge und Komplexität der grundlegenden Informationen dementsprechend anzupassen.
Mit dieser Thematik befasst sich der verhaltensorientierte Controlling Ansatz. Denn jedes Unternehmen ist abhängig von den Entscheidungen, die ein Mensch zu treffen hat, ein Mensch, der wie alle anderen über limitierte Fähigkeiten und menschliche Eigenschaften verfügt. Doch in der Controlling Forschung, speziell hierzulande, wurde das Thema Mensch viel zu lange vernachlässigt. Im angelsächsischen Raum hingegen befasst man sich schon seit geraumer Zeit mit Behavioral Accounting, was eine bereits etablierte Forschungsbasis zur Folge hat. Dies wird nun langsam nachgeholt.
In der vorliegenden Arbeit wird sowohl der Ansatz eines verhaltensorientierten Controllings, als auch der Einfluss von Rationalität und Rationalitätsverlust auf ein Controllinginstrument wie die Budgetierung beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Merkmale und Problemfelder des traditionellen Controllings
- Klassisches Verständnis des Controllings
- Der ökonomische Ansatz
- Homo Oeconomicus als Basis des traditionellen Controllings
- Besondere Merkmale
- Problemfelder des konventionellen Ansatzes
- Bedeutung von Information im Controlling
- Begriffsdefinition und allgemeines Verständnis
- Wahrnehmung und Wirkung von Information
- Information Overload
- Begriffserläuterung und Ursachen
- Konsequenzen für das Controlling
- Konsequenzen für das Management
- Psychologie als Bezugsrahmen verhaltensorientierten Controllings
- Der Mensch im psychologischen Verständnis
- Soziale Einflüsse
- Urteilsverzerrungen
- Rationalität
- Begriffsdefinition
- Kognitive und beschränkte Rationalität
- Verhaltensorientierung im Controlling
- Die neue Institutionenökonomik
- Principal-Agent-Theorie
- Grundlagen
- Annahmen
- Auftretende Probleme
- Das interne/mentale Modell
- Transaktionskostenansatz
- Grundbegriffe
- Annahmen über Akteure und Rahmenbedingungen
- Determinanten der Transaktionskostenhöhe
- Hauptaussagen
- Verhaltensrelevanz in der Budgetierung
- Definition
- Begriffsbestimmung und Einordnung der Budgetierung
- Funktionen der Budgetierung
- Planungssystembezogene Funktionen
- Verhaltensorientierte Funktionen
- Verhaltensbedingte Problemfelder im Budgetierungsprozess
- Rationalitätsbeschränkung als verhaltensbeeinflusste Problemursache
- Rationalitätsbeschränkung aufgrund von Wahrnehmung
- Zeitliche Reihenfolge der Präsentation von Stimuli
- Definition und Erklärung anhand des Primacy- und Recency-Effektes
- Relevanz für die Budgetierung
- Wahrnehmungskatalysierende Eigenschaften von Stimuli
- Definition und Erklärung
- Relevanz für die Budgetierung
- Rationalitätsbeschränkung aufgrund von Bewertung – Status Quo Bias
- Definition und Erklärung
- Relevanz für die Budgetierung
- Fehlerhafte Fremd- oder Selbsteinschätzung - Illusion of Control
- Definition und Erklärung
- Relevanz für die Budgetierung
- Fazit
- Neue Herausforderungen an den Controller
- Problemfelder des Controllers
- Anforderungs- und Fähigkeitsprofil
- Fachliche Anforderungen
- Tiefergehende Anforderungen
- Möglichkeiten und Grenzen des verhaltensorientierten Controllings
- Schlussbetrachtung
- Anhang
- Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow
- Formen der Informationsasymmetrie
- Linguistische Studie zum mentalen Modell
- Studien
- DAX 30 Studie
- ICV Studie
- Studie an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Einfluss von Rationalitätsdefiziten auf das Controllingprofil. Im Fokus steht die Budgetierung im Kontext des verhaltensorientierten Controllings. Die Arbeit analysiert die Problemfelder, die durch Rationalitätsdefizite im Budgetierungsprozess entstehen, und untersucht die Auswirkungen auf das Controllingprofil.
- Rationalitätsdefizite im Budgetierungsprozess
- Verhaltensorientiertes Controlling
- Anforderungen an das Controllingprofil
- Möglichkeiten und Grenzen des verhaltensorientierten Controllings
- Praxisrelevante Implikationen für die Budgetierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung der Arbeit ein und erläutert den Gang der Untersuchung. Kapitel 2 beleuchtet die Merkmale und Problemfelder des traditionellen Controllings, wobei der Fokus auf dem ökonomischen Ansatz und dem Homo Oeconomicus liegt. Kapitel 3 befasst sich mit der Bedeutung von Information im Controlling und analysiert das Phänomen des Information Overload. Kapitel 4 untersucht die Psychologie als Bezugsrahmen für verhaltensorientiertes Controlling und beleuchtet den Menschen im psychologischen Verständnis, soziale Einflüsse, Urteilsverzerrungen und die Konzepte der Rationalität. Kapitel 5 widmet sich der Verhaltensorientierung im Controlling und stellt die neuen Herausforderungen für das Controllingprofil dar. Kapitel 6 analysiert die neue Institutionenökonomik, insbesondere die Principal-Agent-Theorie und den Transaktionskostenansatz. Kapitel 7 untersucht die verhaltensbedingten Problemfelder im Budgetierungsprozess, wobei Rationalitätsbeschränkungen im Fokus stehen. Kapitel 8 beleuchtet die neuen Herausforderungen an den Controller und analysiert das Anforderungs- und Fähigkeitsprofil. Kapitel 9 diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen des verhaltensorientierten Controllings. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Rationalitätsdefizite, verhaltensorientiertes Controlling, Budgetierung, Controllingprofil, Information Overload, Psychologie, Homo Oeconomicus, Principal-Agent-Theorie, Transaktionskostenansatz, neue Institutionenökonomik, Anforderungen an den Controller, Möglichkeiten und Grenzen des verhaltensorientierten Controllings.
- Quote paper
- Torsten Grömminger (Author), 2010, Rationalitätsdefizite, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184339