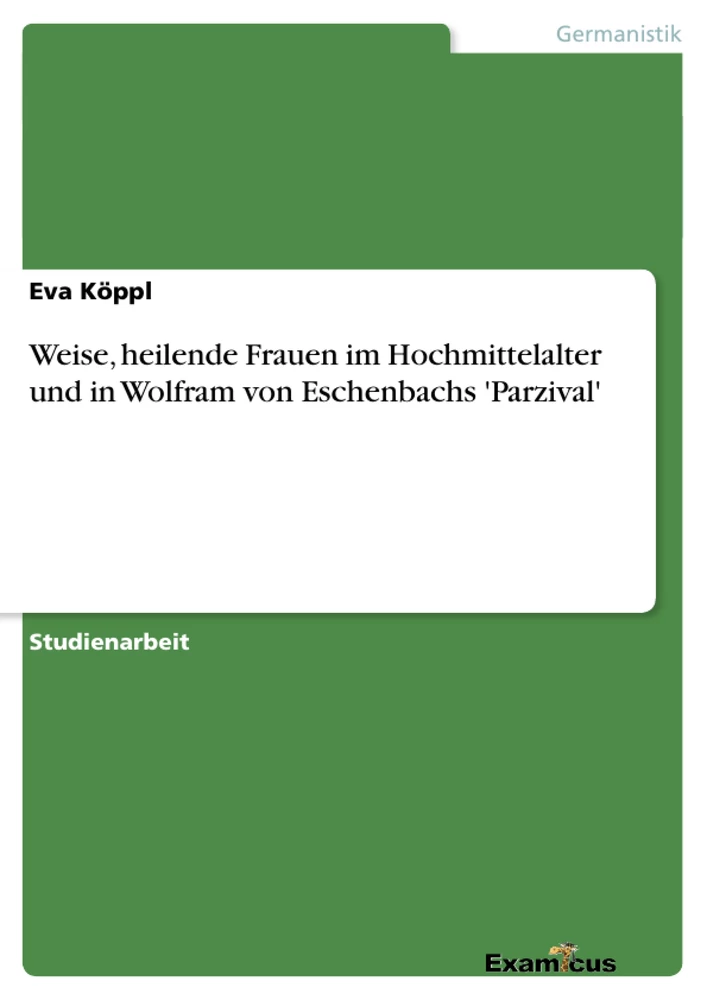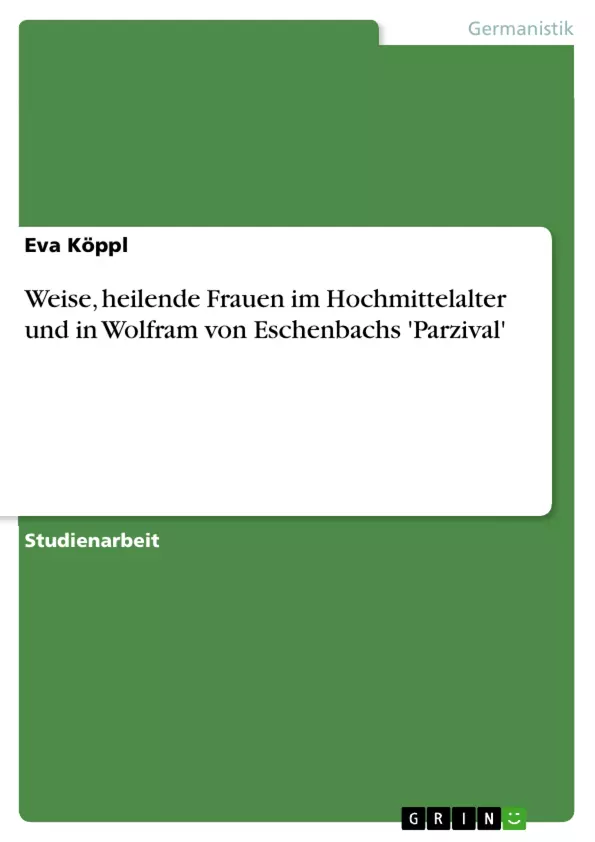Die Arbeit untersucht in umfassender Weise die Funktion von Heilerinnen im Mittelalter sowie im besonderen die der höfischen Heilerinnen in Wolframs "Parzival". Sie thematisiert überdies das Verhältnis magischer und "wissenschaftlicher" Heilmethoden und liefert diesbezüglich einen Abriss der Forschungsergebnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Zur Situation heilender Frauen im Mittelalter und zum Verhältnis von Magie und Wissenschaftlichkeit
- Heilende Frauen im Mittelalter und die Trennung von Schul- und Volksmedizin. Zum Forschungsstand
- Stephan Maksymiuks Postulat der Mentalitätsforschung und der heilkundliche Bereich
- Das Phänomen der Hofmagier und die Heilkunde am Hof
- Zur Bedeutung heilkundlich tätiger Frauen im Mittelalter
- Gebildete Frauen im höfischen Bereich, ihre heilkundliche Tätigkeit und ihr „traditionelles Erbe“
- Weise Frauen
- „Pagane“ Wurzeln
- Die weise Frau im Mittelalter
- Ausgebildete Ärztinnen
- Andere Arten von Heilerinnen
- Exkurs zum Thema Mentalitätsgeschichte: Die Verdrängung der Frau aus traditionellen Heilberufen und die Auswirkungen auf das heutige Denken
- Mythologische Bezugspunkte
- Heilende Frauen im „Parzival“
- Wolframs von Eschenbach „Parzival“
- Mythologischer Hintergrund der Schastel marveile-Episode
- Die literarische Inszenierung des Heilungsprozesses. Arnive als dominierende Figur
- 1. Stufe: Vorbereitung der Heilung durch Zuwendung, Schönheit und sublimierte Erotik
- 2. Stufe: Arnive als Wundheilerin und Cundrie als Bereitstellerin der Salbe
- Vermischung des medizinischen und des historisch-mythologischen Diskurses im zweiten Schritt der Heilung. Arnive als kluge höfische Dame und weise Heilerin
- Arnive und die Wundersäule
- Gawan und Arnive. Das Verhältnis von „weiblicher“ Weisheit und „Königinnenmacht“ zu „männlichem“ Rittertum
- Die „seelische Heilung Gawans“. Arnive als weise „Ärztin der Seele“ und Orgeluse als „schöne Hexe“
- Cundrie la surziere
- Vergleich mit Hartmanns „Erec“. Cundrie und Famurgan als „Bereitstellerinnen“ des Heilmittels
- Die Heterogenität der Cundriegestalt
- Cundrie und die „Töchter Adams“
- Mythologische Tiersymbolik im Vergleich zu Thüring von Ringoltingens „Melusine“
- Abschwächung des magischen Elements und das schwankende Urteil gegenüber der magischen Heilkunst der Cundrie
- Die Bildung der Cundrie. Cundrie als Hofmagierin
- Zur mythologischen Herkunft der Cundriefigur
- Schluss
- Literaturliste
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Rolle heilender Frauen in der hochmittelalterlichen Gesellschaft und im „Parzival“ Wolfram von Eschenbachs. Ziel ist es, die Forschung zu diesem Thema zu beleuchten, verschiedene Arten von Heilerinnen zu analysieren und ihre Funktion im Kontext des „Parzival“ zu bewerten. Dabei wird insbesondere das Verhältnis von „magischer“ und „wissenschaftlicher“ Heilkunst im Mittelalter und im Werk Wolfram von Eschenbachs untersucht.
- Die Bedeutung heilender Frauen im Mittelalter und die Trennung von Schul- und Volksmedizin
- Das Verhältnis von „magischer“ und „wissenschaftlicher“ Heilkunst im Mittelalter
- Die verschiedenen Arten von Heilerinnen im Mittelalter, wie z.B. weise Frauen, höfisch gebildete Frauen, Wundheilerinnen und ausgebildete Ärztinnen
- Die Funktion und die mythologischen Wurzeln heilender Frauen im „Parzival“
- Die literarische Inszenierung des Heilungsprozesses im „Parzival“ und die Rolle der Frauen als Heilerinnen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungslücke und die Zielsetzung der Hausarbeit dar. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas und die Notwendigkeit einer Neubewertung der verschiedenen Arten von Heilerinnen im Mittelalter und im „Parzival“.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Situation heilender Frauen im Mittelalter und dem Verhältnis von Magie und Wissenschaftlichkeit. Es werden verschiedene Forschungspositionen zum Thema vorgestellt und die Bedeutung der Mentalitätsforschung für die Analyse der mittelalterlichen Heilkunde hervorgehoben. Das Kapitel beleuchtet die Trennung von Schul- und Volksmedizin und die Rolle der „Magie“ als Differenzfaktor zur neuzeitlichen Konzeption von Medizin. Es werden verschiedene Arten von Heilerinnen vorgestellt, wie z.B. weise Frauen, höfisch gebildete Frauen, Wundheilerinnen und ausgebildete Ärztinnen.
Das dritte Kapitel analysiert die Rolle heilender Frauen im „Parzival“. Es werden die Figuren der Königin Arnive und der Gralsbotin Cundrie im Kontext des Heilungsprozesses von Gawan untersucht. Das Kapitel beleuchtet die mythologischen Wurzeln der Figuren, die literarische Inszenierung des Heilungsprozesses und das Verhältnis von „magischer“ und „wissenschaftlicher“ Heilkunst im Werk Wolfram von Eschenbachs.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die heilenden Frauen, die hochmittelalterliche Gesellschaft, Wolfram von Eschenbachs „Parzival“, die Trennung von Schul- und Volksmedizin, das Verhältnis von Magie und Wissenschaftlichkeit, die verschiedenen Arten von Heilerinnen, die Funktion und die mythologischen Wurzeln heilender Frauen im „Parzival“, die literarische Inszenierung des Heilungsprozesses und die Rolle der Frauen als Heilerinnen.
Häufig gestellte Fragen zu heilenden Frauen im Mittelalter
Welche Rolle spielten Heilerinnen im Hochmittelalter?
Heilerinnen reichten von weisen Frauen der Volksmedizin bis hin zu gebildeten Damen am Hof. Sie verfügten oft über tiefes Wissen in Kräuterkunde und Wundheilung.
Wie wird die Figur Arnive in Wolframs „Parzival“ dargestellt?
Arnive agiert als dominante Heilerin und „Ärztin der Seele“, die medizinische Kenntnisse mit kluger höfischer Diplomatie verbindet, um Ritter wie Gawan zu heilen.
Was symbolisiert Cundrie la surziere im „Parzival“?
Cundrie ist eine heterogene Figur, die als Gralsbotin sowohl über magisches als auch wissenschaftliches Wissen verfügt und als Vermittlerin von Heilmitteln fungiert.
Wie unterschieden sich Magie und Wissenschaft in der mittelalterlichen Medizin?
Die Grenzen waren fließend; oft wurden Gebete und magische Rituale mit empirischem Kräuterwissen kombiniert, bevor eine strikte Trennung durch die aufkommende Schulmedizin erfolgte.
Warum wurden Frauen später aus Heilberufen verdrängt?
Die Professionalisierung und Akademisierung der Medizin führte dazu, dass traditionelles weibliches Wissen abgewertet wurde, was langfristige Auswirkungen auf das Rollenbild von Frauen im Gesundheitswesen hatte.
- Citation du texte
- Magistra Artium Eva Köppl (Auteur), 2001, Weise, heilende Frauen im Hochmittelalter und in Wolfram von Eschenbachs 'Parzival', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186269