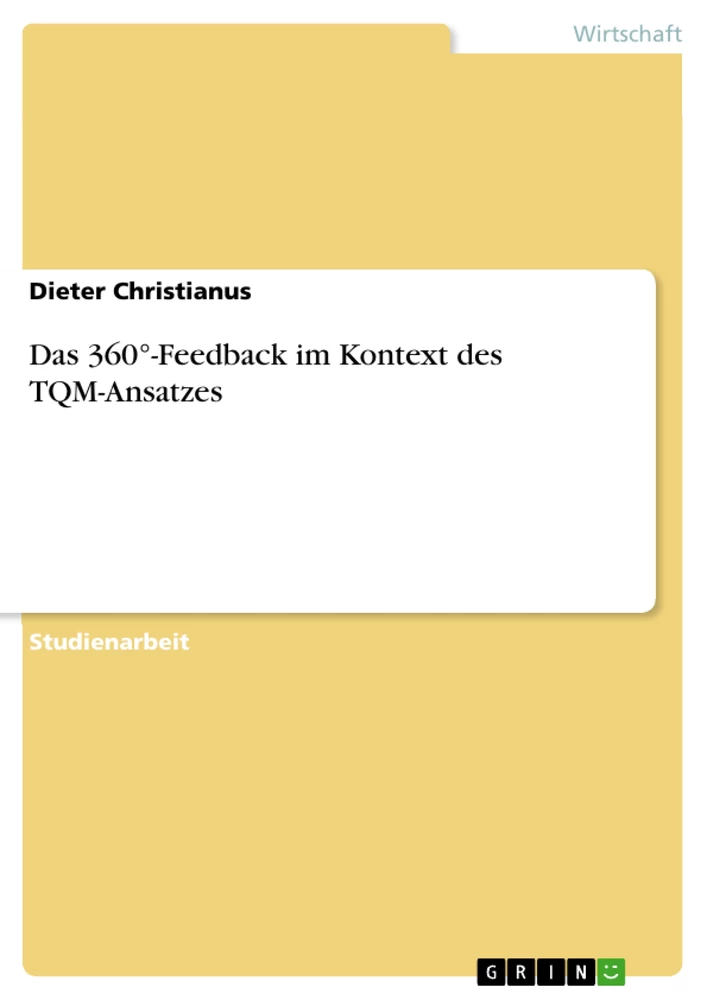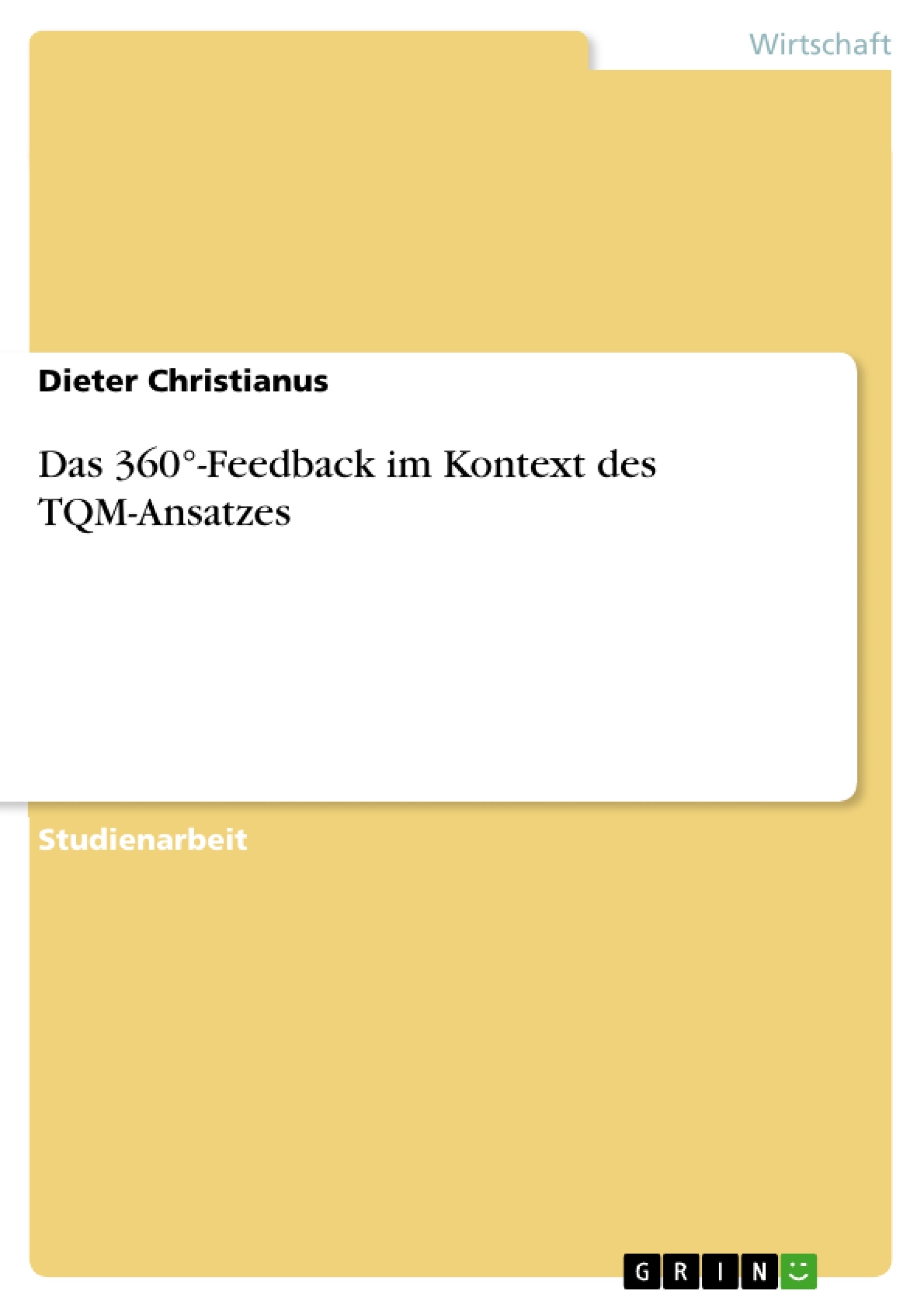Neue Technologien, z.B. Web-Applikationen und Emails, haben die klassischen Formen der Mitarbeiterbefragung deutlich verändert. So wurden die schriftlichen Erhebungen weitgehend durch Web-Applikationen verdrängt, was dazu führte, dass die Kosten von Mitarbeiterbefragungen deutlich gesenkt werden konnten. Diese Technologien führten auch dazu, dass im Rahmen der Mitarbeiterbefragung auch andere Stakeholder (z.B. Kunden, Lieferanten, etc.) relativ einfach befragt werden können. Der Begriff des 360°-Feedbacks hat sich für derartige Rundum-Befragungen etabliert. Doch was leisten diese 360°-Feedbacks und wie können sie im Rahmen eines TQM-Ansatzes eingesetzt werden?
Der Autor erörtert die 360°-Befragung im praktischen Einsatz, geht aber auch auf problematische Rahmenbedingungen (z.B. Datenschutz) ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziel der Arbeit / Abgrenzung
- Aufbau und Methodik
- Theoretische Grundlagen
- Das EFQM-Modell
- Von der Mitarbeiterbefragung zum 360°-Feedback
- Die Mitarbeiterbefragung
- Das 360°-Feedback
- Hauptteil
- Die Korrelation zwischen dem EFQM-Modell und dem 360°-Feedback
- Welche Messgrößen des 360°-Feedbacks erfüllen die Anforderungen des TQM-Ansatzes?
- Die mitarbeiterspezifischen Informationen
- Die kundenspezifischen Informationen
- Informationen der Externen Kunden
- Informationen der Internen Kunden
- Die ergänzenden Informationen
- Datenschutzrechtliche Problematik bei der Durchführung von 360°-Befragungen
- Zusammenfassung und Implikationen für die Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Einsatzmöglichkeiten von 360°-Feedbacks im Kontext eines TQM-Ansatzes und untersucht die Grenzen ihres Einsatzes. Die Arbeit beleuchtet die Einbindung von 360°-Feedback-Daten in das EFQM-Modell und zeigt auf, welche zusätzlichen Informationen aus 360°-Befragungen für die TQM-Praxis relevant sind. Des Weiteren werden datenschutzrechtliche Aspekte der Nutzung von 360°-Feedbacks für EFQM-Zwecke betrachtet.
- Integration von 360°-Feedback in das EFQM-Modell
- Relevanz von 360°-Feedback-Daten für die TQM-Praxis
- Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für 360°-Befragungen
- Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von 360°-Feedback im TQM-Kontext
- Zusammenhang zwischen 360°-Feedback und Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Veränderung klassischer Mitarbeiterbefragungen durch neue Technologien und den Aufstieg des 360°-Feedbacks dar. Sie skizziert die Forschungsfragen, die in der Arbeit behandelt werden.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel erläutert das EFQM-Modell und den Übergang von der Mitarbeiterbefragung zum 360°-Feedback. Es definiert die verschiedenen Arten von Befragungen und die Besonderheiten des 360°-Feedbacks.
- Hauptteil: Der Hauptteil befasst sich mit der Korrelation zwischen dem EFQM-Modell und dem 360°-Feedback. Es analysiert, welche Messgrößen des 360°-Feedbacks relevant für den TQM-Ansatz sind und welche Informationen aus den verschiedenen Perspektiven (Mitarbeiter, Kunden, etc.) gewonnen werden können. Des Weiteren werden datenschutzrechtliche Aspekte bei der Durchführung von 360°-Befragungen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselwörter 360°-Feedback, TQM-Ansatz, EFQM-Modell, Mitarbeiterbefragung, Datenschutzrecht, Stakeholder, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit.
- Citar trabajo
- Dieter Christianus (Autor), 2012, Das 360°-Feedback im Kontext des TQM-Ansatzes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189856