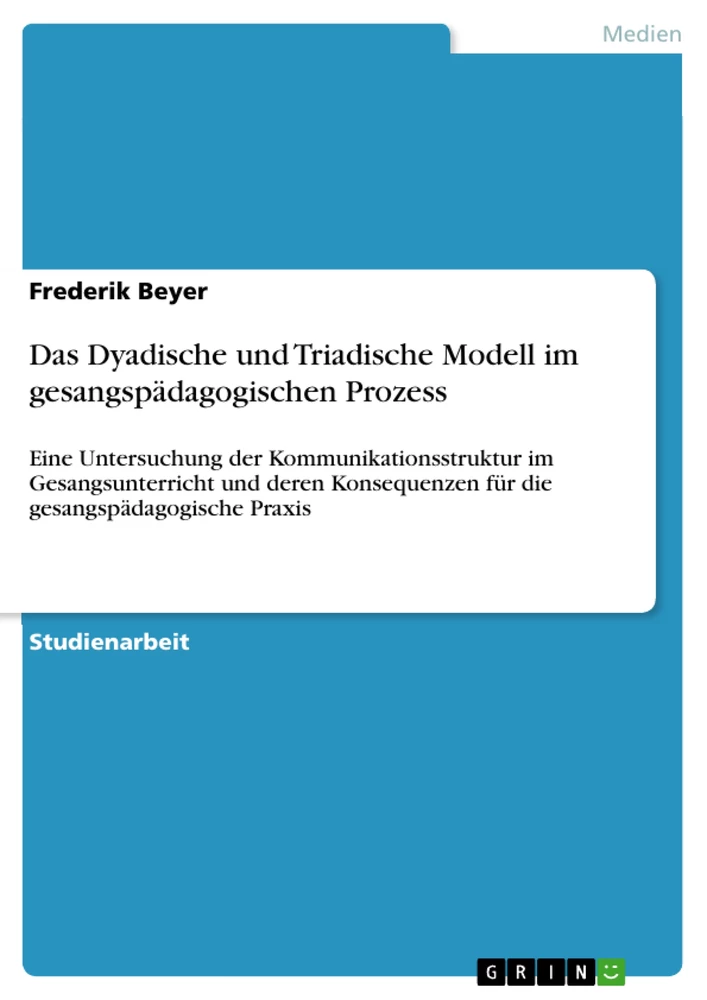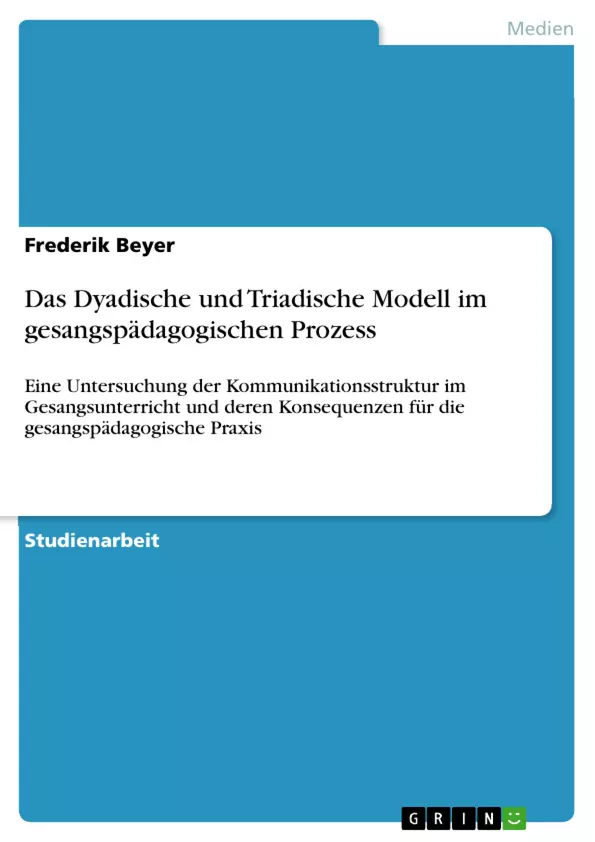Welche kommunikativen Strukturen liegen dem Lehrer-Schüler-Verhältnis im Gesangsunterricht zugrunde? Wie wirken sich diese Strukturen auf den gesangspädagogischen Prozess aus? Wie genau können Gesangslehrer ihre Kommunikationsstrategie ändern, um den gesangspädagogischen Prozess erfolgreicher zu gestalten? Das sind die zentralen Fragen, die in dieser Arbeit erörtert werden.
Der Autor führt zunächst in verschiedene Definitionen des Begriffsfeldes "Kommunikation" ein. Bezogen auf den gesangspädagogischen Kontext werden zunächst die metakommunikativen Axiome Watzlawicks, das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun sowie die Wahrnehmungspositionen aus dem NLP vorgestellt.
Vor diesem Hintergrund entwickelt der Autor dann das Dyadische und Triadische Kommunikationsmodell: Im Dyadischen Modell findet Kommunikation ausschließlich zwischen Lehrer und Schüler statt, im Triadischen hingegen tritt die Stimme als dritter Kommunikationspartner hinzu. Anhand zahlreicher Beispiele wird gezeigt, welche Kommunikationsstrategien mit dem jeweiligen Kommunikationsmodell verbunden sind.
Nach Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile wird klar: das Triadische Kommunikationsmodell erlaubt - aufgrund wirklicher Wahlfreiheit in den Kommunikationswegen und einem damit verbundenem Höchstmaß an Flexibilität in der Kommunikation - verstärkten pädagogischen Erfolg.
Inhaltsverzeichnis
- Zielstellung
- Was ist Kommunikation?
- Definitionen des Begriffsfeldes „Kommunikation”
- Unterrichtskommunikation
- Definitionen und Axiome in der gesangspädagogischen Praxis
- Induktive vs. deduktive Methode
- Kommunikationsmodelle und Wahrnehmungspositionen
- Modell nach Schulz von Thun
- Assoziation, Dissoziation und Wahrnehmungspositionen aus dem NLP
- Kommunikationsmodelle im Einzelunterricht
- Dyadisches Modell
- Triadisches Modell
- Vergleich der Modelle - Vor- und Nachteile
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, die Kommunikationsstrukturen im Gesangsunterricht zu untersuchen und daraus konkrete Schlussfolgerungen für eine Optimierung der Kommunikation im gesangspädagogischen Prozess zu ziehen. Die Arbeit beantwortet die folgenden zentralen Fragen:
- Welche kommunikativen Strukturen liegen dem Lehrer-Schüler-Verhältnis zugrunde?
- Wie wirken sich diese Strukturen auf den gesangspädagogischen Prozess aus?
- Wie können Gesangslehrer ihre Kommunikationsstrategie ändern, um den gesangspädagogischen Prozess erfolgreicher zu gestalten?
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt die Zielstellung der Arbeit und die zentralen Fragen, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden, ein. Kapitel 2 liefert einen Überblick über verschiedene Definitionen des Begriffs Kommunikation, beleuchtet die Anwendung dieser Definitionen im Kontext der Gesangspädagogik und stellt die Phasen des Unterrichts nach E. Rabine sowie die induktive und deduktive Methode vor. Kapitel 3 analysiert verschiedene Kommunikationsmodelle, darunter das Modell nach Schulz von Thun und die Konzepte der Assoziation, Dissoziation und Wahrnehmungspositionen aus dem NLP. In Kapitel 4 werden neue, speziell für die Gesangspädagogik entwickelte Kommunikationskonzepte, das dyadische und das triadische Modell, vorgestellt. Es werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Kommunikationsstrategien anhand von sprachlichen Beispielen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema Kommunikation im Gesangsunterricht, insbesondere mit den strukturellen Aspekten und den Auswirkungen auf den gesangspädagogischen Prozess. Dabei stehen Kommunikationsmodelle, wie das Dyadische und Triadische Modell, sowie die Definitionen und Axiome der Kommunikation im Vordergrund. Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Optimierung der Kommunikation im Unterricht und stellt die Bedeutung der verschiedenen Kommunikationsstrategien für den Erfolg des gesangspädagogischen Prozesses heraus.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das triadische Modell im Gesangsunterricht?
Im triadischen Modell tritt die Stimme als dritter, eigenständiger Kommunikationspartner zwischen Lehrer und Schüler, was die pädagogische Flexibilität erhöht.
Wie unterscheidet sich das dyadische vom triadischen Modell?
Im dyadischen Modell findet die Kommunikation ausschließlich direkt zwischen Lehrer und Schüler statt, was oft zu einer stärkeren persönlichen Abhängigkeit führen kann.
Welche Rolle spielt NLP in der Gesangspädagogik?
NLP-Konzepte wie Assoziation, Dissoziation und verschiedene Wahrnehmungspositionen helfen Lehrern, ihre Kommunikation präziser auf den Schüler abzustimmen.
Was sind die metakommunikativen Axiome von Watzlawick?
Sie bilden die theoretische Basis für das Verständnis von Beziehungs- und Inhaltsebene im Unterricht, was für den Erfolg des gesangspädagogischen Prozesses entscheidend ist.
Warum ist das triadische Modell erfolgreicher?
Es ermöglicht eine größere Wahlfreiheit in den Kommunikationswegen und entlastet die Lehrer-Schüler-Beziehung von unnötigen emotionalen Spannungen.
- Quote paper
- Frederik Beyer (Author), 2011, Das Dyadische und Triadische Modell im gesangspädagogischen Prozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191136