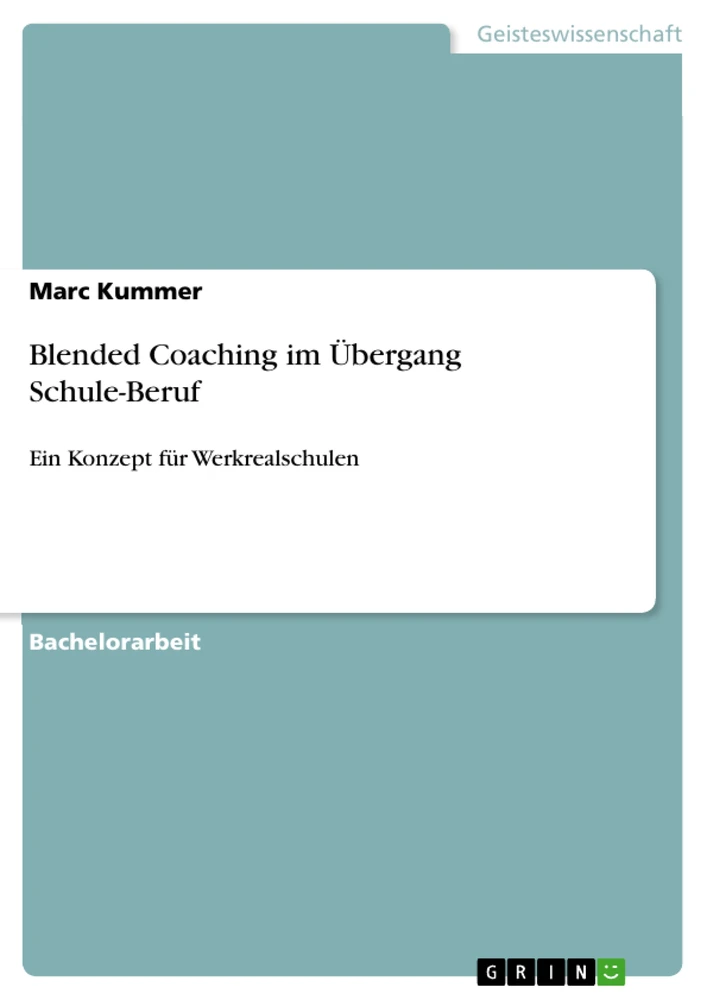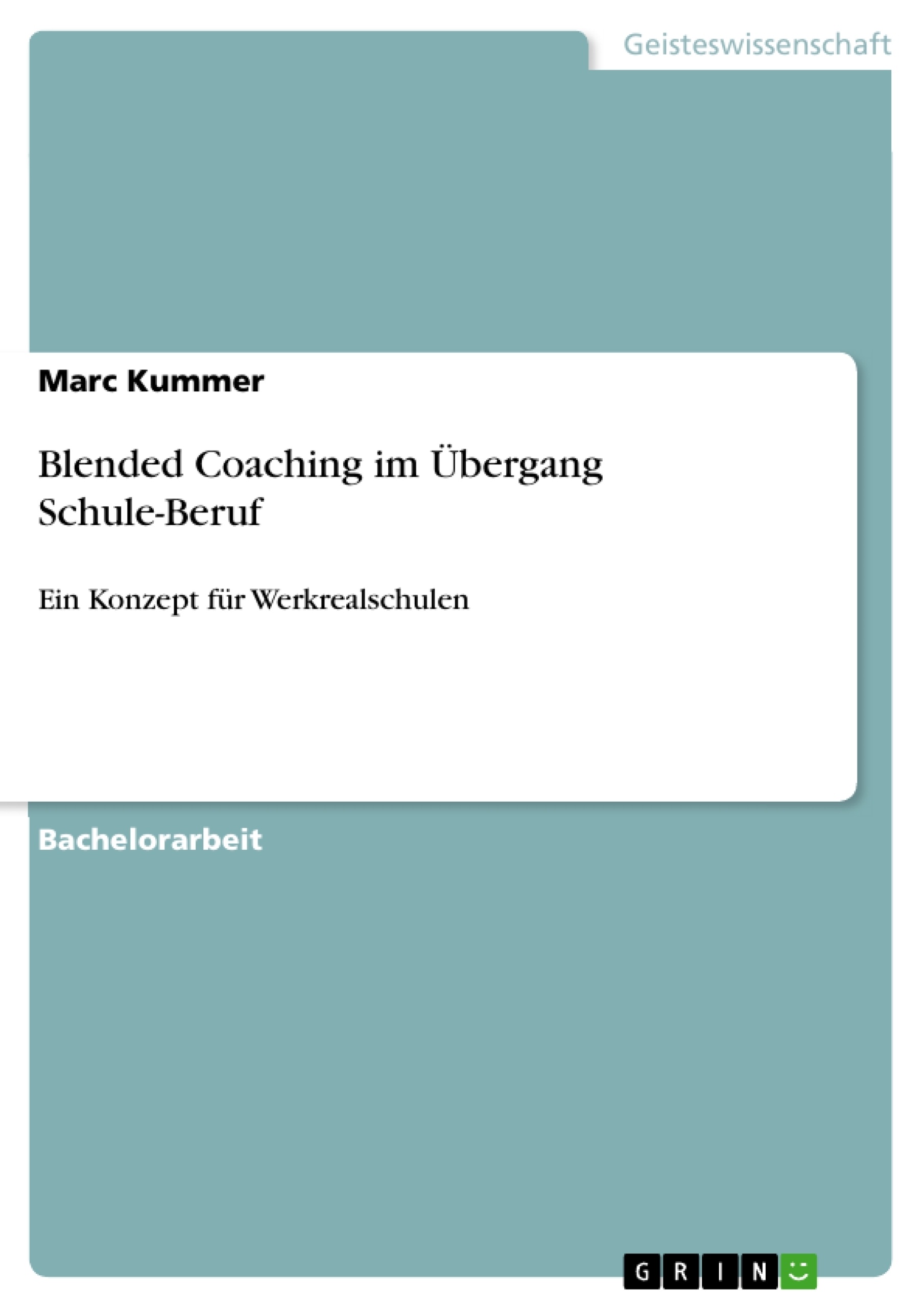Mit dieser Arbeit wird erforscht, wie ein Blended-Coaching Modul zur Berufsorientierung an Werkrealschulen aussehen könnte. Blended-Coaching wird hier definiert als ein „Mix“ aus Präsenzcoaching in der Schule und virtuellem Coaching durch neue (digitale) Medien. Die Arbeit zeigt die Ausgangslage der Berufsorientierung bzw. des Übergangs Schule-Beruf in deutschen Hauptschulen, die Grundlagen verschiedener Bereiche der Berufsorientierung, der Mediendidaktik und des Coachings und E-Coachings. Wie in Kapitel 2 zu sehen ist, kann Blended-Coaching eine Methode zur Berufsorientierung sein, die für Werkrealschulen von zentraler Bedeutung werden kann. Gerade bei der Umsetzung der Berufsorientierung an Schulen, wie in Kapitel 2 dargestellt, wird klar dass nicht alle Haupt- und Werkrealschulen über solch eine Infrastruktur für den Übergang Schule-Beruf verfügen. Jedoch können Schulen in Schulentwicklungsprozessen davon profitieren, wie das Konzept des Blended-Coachings in Berufsorientierungsphasen sinnvoll eingesetzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- EINLEITUNG
- 1 WISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN
- 1.1 AUSGANGSLAGE IM ÜBERGANG SCHULE-BERUF 2010
- 1.2 GRUNDLAGEN DER BERUFSORIENTIERUNG
- 1.3 ZIELE & ZIELGRUPPE
- 1.3.1 Ziele
- 1.3.2 Zielgruppe
- 1.3.3 Gender-/ Cultural Mainstreaming
- 1.3.4 Ausbildungsfähigkeit
- 1.4 GRUNDLAGEN DES CASE MANAGEMENT
- 1.5 GRUNDLAGEN DES COACHING
- 1.6 GRUNDLAGEN DES E-COACHING
- 1.6.1 Didaktisch offenes E-Coaching
- 1.6.2 Didaktisch vorstrukturiertes E-Coaching (virtuelles Coaching)
- 1.7 GRUNDLAGEN DER MEDIENDIDAKTIK
- 1.7.1 lerntheoretische Grundlagen
- 1.7.2 Bedeutung der lerntheoretischen Grundlagen für die Berufsorientierung
- 1.8 MEDIENHANDELN VON HAUPTSCHÜLERN
- 1.9 ZWISCHENFAZIT WISSENSCHAFTLICHER GRUNDLAGEN
- 2 BLENDED-COACHING KONZEPTION ZUR BERUFSORIENTIERUNG
- 2.1 ANALYSEVERFAHREN
- 2.1.1 Screening
- 2.1.2 Kompetenzanalyse „Profil AC“
- 2.1.3 Zieldefinitionen
- 2.2 PRÄSENZCOACHING BEI DER BERUFSORIENTIERUNG
- 2.2.1 Ausbildungsberufe
- 2.2.2 Bewerbungsunterlagen
- 2.2.3 Feedbackverfahren
- 2.3 E-COACHING BEI DER BERUFSORIENTIERUNG
- 2.3.1 Persönliche Coachingumgebung
- 2.3.2 Medienwahl
- 2.4 EXEMPLARISCHER BLENDED-COACHING PROZESS
- 2.5 ZWISCHENFAZIT BLENDED-COACHING KONZEPT
- 3 SCHLUSSBETRACHTUNG
- 3.1 ZUSAMMENFASSUNG
- 3.2 FAZIT
- 3.3 AUSBLICK
- ANHANG
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Blended-Coaching-Konzepts für die Berufsorientierung an Werkrealschulen. Ziel ist es, den Übergang von der Schule in den Beruf für Schüler zu erleichtern und sie bei der Berufswahl und -findung zu unterstützen.
- Die Herausforderungen des Übergangs Schule-Beruf
- Die Bedeutung von Berufsorientierung für Schüler
- Die Konzeption eines Blended-Coaching-Ansatzes
- Die Integration von Präsenz- und E-Coaching-Elementen
- Die Verwendung von geeigneten Medien und Technologien
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die wissenschaftlichen Grundlagen des Themas, beginnend mit der Analyse der aktuellen Situation im Übergang Schule-Beruf. Es werden die wichtigsten Aspekte der Berufsorientierung sowie die Ziele und die Zielgruppe des Projekts beschrieben. Die Kapitel behandeln außerdem die Konzepte des Case Managements, des Coachings und des E-Coachings. Abschließend wird auf die didaktischen Grundlagen des E-Coachings und das Medienhandeln von Hauptschülern eingegangen.
Kapitel 2 präsentiert das Blended-Coaching-Konzept zur Berufsorientierung. Das Konzept beinhaltet ein Analyseverfahren mit Screening, Kompetenzanalyse und Zieldefinitionen. Das Kapitel beschreibt die Einsatzmöglichkeiten des Präsenzcoachings, des E-Coachings und des Blended-Coaching-Prozesses.
Schlüsselwörter
Blended Coaching, Berufsorientierung, Übergang Schule-Beruf, Werkrealschule, Case Management, E-Coaching, Medienpädagogik, Kompetenzanalyse, Präsenzcoaching, Screening, Zieldefinition, virtuelles Coaching.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Blended Coaching"?
Blended Coaching ist ein Mix aus klassischen Präsenzsitzungen in der Schule und virtuellem Coaching (E-Coaching) über digitale Medien.
Wie unterstützt Blended Coaching den Übergang Schule-Beruf?
Es hilft Schülern an Werkrealschulen bei der Berufsorientierung, der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und der Kompetenzanalyse (z.B. Profil AC).
Welche Rolle spielt die Mediendidaktik in diesem Konzept?
Sie liefert die lerntheoretischen Grundlagen, um digitale Medien so einzusetzen, dass sie das Medienhandeln von Hauptschülern sinnvoll für die Berufswahl nutzen.
Was ist der Unterschied zwischen didaktisch offenem und vorstrukturiertem E-Coaching?
Offenes E-Coaching ist flexibler in der Gestaltung, während vorstrukturiertes (virtuelles) Coaching klare Abläufe und vorgegebene Medien nutzt.
Was versteht man unter "Ausbildungsfähigkeit"?
Es bezeichnet die Summe der Kompetenzen, die ein Schüler mitbringen muss, um erfolgreich in eine Berufsausbildung zu starten; ein zentrales Ziel des Coachings.
- Quote paper
- Marc Kummer (Author), 2011, Blended Coaching im Übergang Schule-Beruf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191307