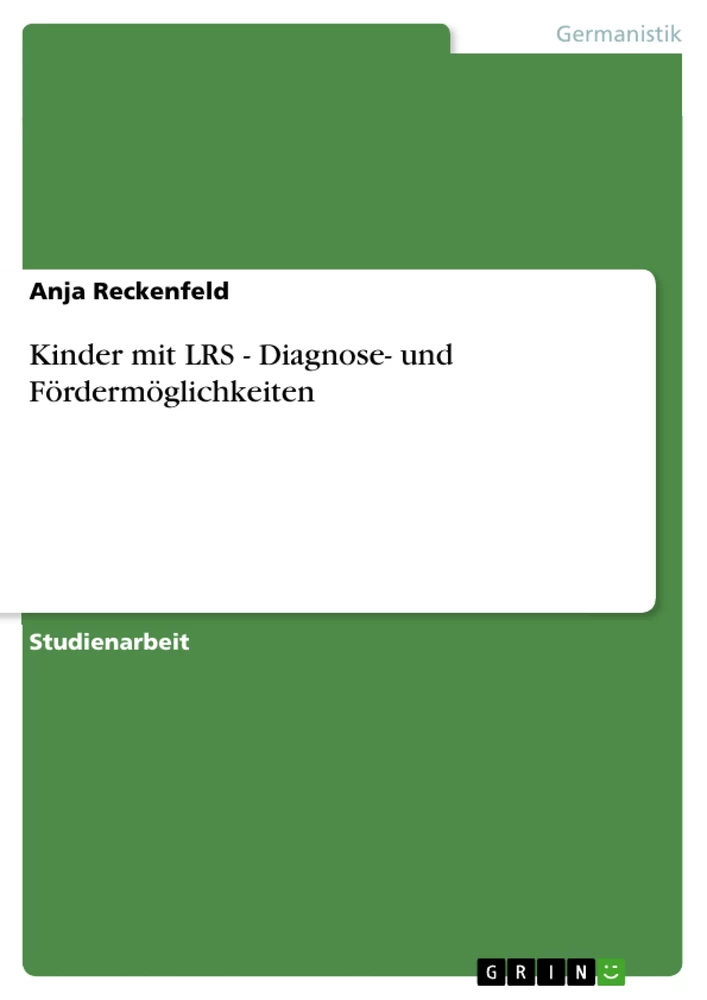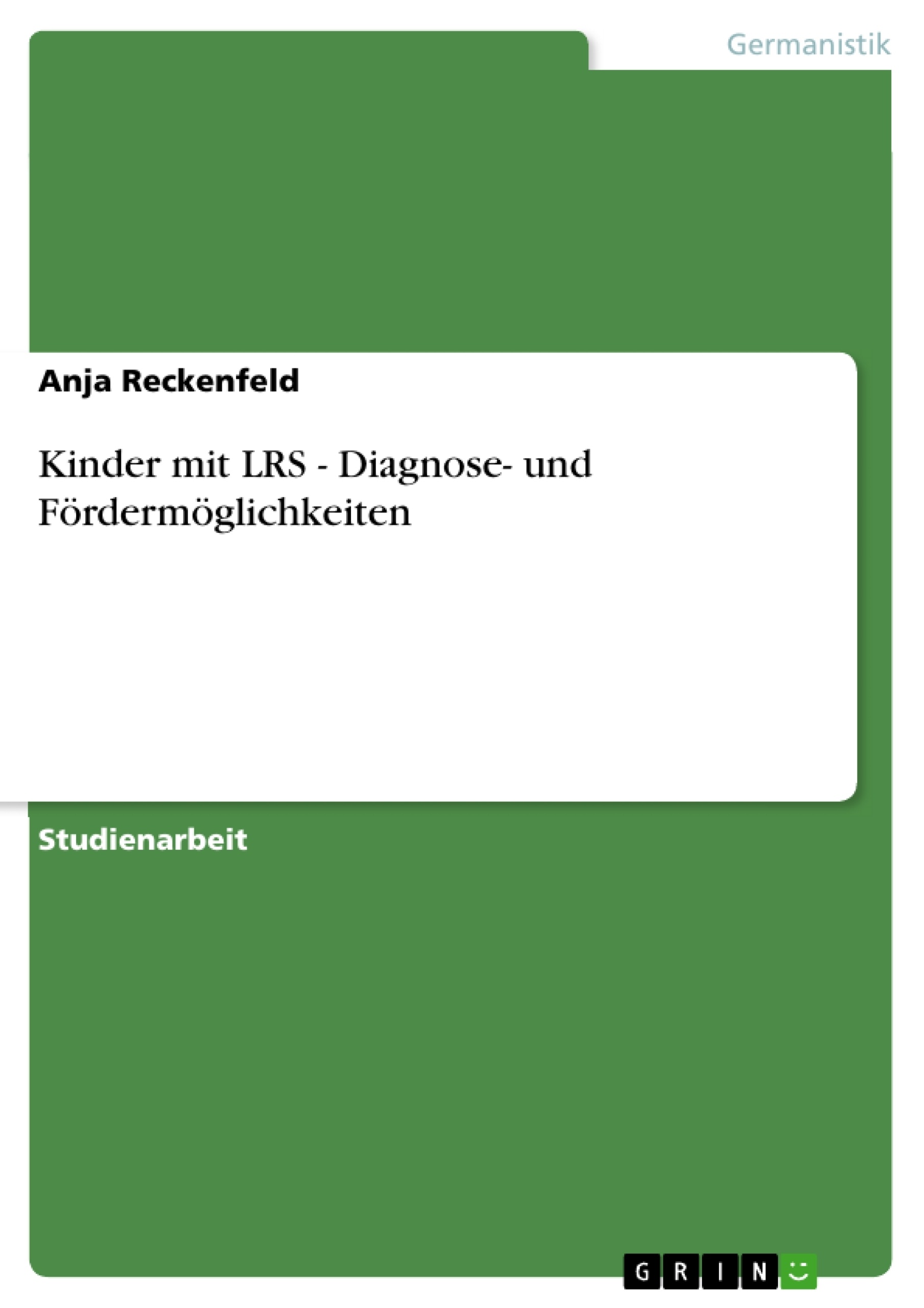1 Einleitung
Die Hausarbeit setzt sich mit Problemen beim Lesen und Rechtschreiben auseinander. Dabei werden besonders die Möglichkeiten zur Diagnose und Förderung betrachtet. Bevor näher auf LRS und Legasthenie eingegangen wird, erfolgt zunächst eine kurze Darstellung von zwei Modellen des Schriftspracherwerbs. Diese geben Auskunft darüber wie Kinder den Prozess des Lesen- und Schreibenlernens idealtypisch vollziehen und bilden somit die Voraussetzung für die Fähigkeit des Erkennens von Symptomen, die einen Hinweis auf Probleme beim Lesen und Rechtschreiben darstellen können. In der Wissenschaft haben zahlreiche Modelle Eingang in die Diskussion zum Schriftspracherwerb gefunden, häufig wurden sie ergänzt oder als Grundlage für weitere Modelle verwendet. Die Hausarbeit geht exemplarisch auf die Modelle von Frith und Valtin ein.
Nach kurzer Einführung in den Prozess des Schriftspracherwerbs stellt sich die Frage, wie sich bei einem Kind LRS/Legasthenie erkennen lässt. Was lässt sich zum Erscheinungsbild, zu Ursachen und Diagnosemöglichkeiten sagen? Diese Fragen sind vor allem sehr bedeutsam für Menschen, die täglich mit Kindern umgehen. Dazu gehören z.B. Eltern, Erzieher und Lehrer/-innen. Durch mein Lehramtsstudium mit dem Schwerpunkt Grundschule ist es für meinen zukünftigen Beruf unerlässlich mich mit diesem Thema so grundlegend auszukennen, dass ich betroffene Kinder erkennen und ihnen so gut es geht im Schullalltag helfen kann. Daher gibt die Hausarbeit im letzten Kapitel Informationen zum Umgang mit betroffenen Kindern sowie zu Fördermöglichkeiten. Ebenso will sie Mut machen, auf Expertenhilfe zurückzugreifen, wenn Grenzen des Helfens erreicht sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Entwicklung des Lesens und Schreibens
- 2.1 Das Modell von Uta Frith (1985)
- 2.2 Das Stufenmodell nach Valtin (2000)
- 2.3 Kritische Betrachtung der Modelle
- 3 Was ist eine Lese-Rechtschreibschwäche, wann spricht man von Legasthenie?
- 3.1 Begriffsklärung
- 3.2 Zum Erscheinungsbild
- 3.3 Über die Ursachen
- 3.4 Diagnostische Verfahren
- 4 Kinder mit LRS in der Grundschule
- 4.1 Umgang und Fördermöglichkeiten durch die Lehrkraft
- 4.2 Grenzen der Klassenlehrer: Wenn Expertenhilfe herangezogen werden muss
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Probleme beim Lesen und Schreiben, insbesondere die Möglichkeiten der Diagnose und Förderung von Lese-Rechtschreibschwächen (LRS) und Legasthenie. Zunächst werden Modelle des Schriftspracherwerbs vorgestellt, um ein Verständnis für den idealtypischen Lernprozess zu schaffen und somit die Erkennung von Symptomen zu erleichtern. Die Arbeit beleuchtet die Erscheinungsformen, Ursachen und diagnostischen Verfahren von LRS/Legasthenie. Schließlich werden der Umgang mit betroffenen Kindern in der Grundschule und mögliche Fördermaßnahmen, inklusive des Hinzuziehens von Experten, diskutiert.
- Modelle des Schriftspracherwerbs (Frith und Valtin)
- Erscheinungsbild, Ursachen und Diagnostik von LRS/Legasthenie
- Fördermöglichkeiten für Kinder mit LRS in der Grundschule
- Rolle der Lehrkraft bei der Unterstützung von Kindern mit LRS
- Grenzen der Lehrkraft und Notwendigkeit externer Hilfe
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein, welches die Probleme beim Lesen und Schreiben, insbesondere die Diagnose und Förderung von LRS und Legasthenie, behandelt. Bevor auf LRS und Legasthenie eingegangen wird, werden zwei Modelle des Schriftspracherwerbs kurz dargestellt. Diese Modelle liefern die Grundlage zum Verständnis des idealtypischen Lernprozesses und ermöglichen somit die Erkennung von Symptomen, die auf Probleme beim Lesen und Schreiben hinweisen. Die Arbeit betont die Bedeutung des Themas für den zukünftigen Beruf der Autorin als Grundschullehrerin und ihren Wunsch, betroffene Kinder zu erkennen und zu unterstützen.
2 Die Entwicklung des Lesens und Schreibens: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung des Lesens und Schreibens als Schlüsselqualifikation für die gesellschaftliche Teilhabe. Es wird betont, dass der Schriftspracherwerb ein langwieriger Prozess mit individuellen Unterschieden ist und bereits vor dem Schuleintritt beginnen kann. Der Einfluss von Vorlesen, Bilderbüchern und der sprachlichen Umgebung auf den Lernerfolg wird hervorgehoben. Fehler werden als wichtiger Bestandteil des Lernprozesses betrachtet, der Aufschluss über den Entwicklungsstand des Kindes gibt.
2.1 Das Modell von Uta Frith (1985): Dieses Kapitel beschreibt das dreistufige Modell des Schriftspracherwerbs nach Uta Frith: die logographische Phase (visuelles Erkennen von Wörtern), die alphabetische Phase (Verbindung von Buchstaben und Lauten) und die orthographische Phase (Anwendung von Rechtschreibregeln). Das Modell wird als deskriptiv charakterisiert und seine Bedeutung für die gezielte Förderung von Kindern erläutert. Die Herausforderungen in jeder Phase werden detailliert beschrieben, z.B. das willkürliche Schreiben in der alphabetischen Phase.
2.2 Das Stufenmodell nach Valtin (2000): Dieses Kapitel erläutert das siebenstufige Modell des Schriftspracherwerbs nach Renate Valtin, welches auf dem Modell von Uta Frith aufbaut. Es beschreibt die einzelnen Stufen, beginnend von der Kritzelstufe bis zu fortgeschritteneren Stadien der lautorientierten Schreibung. Jedes Stadium wird charakterisiert und die Entwicklungsschritte des Kindes im Schriftspracherwerb verdeutlicht. Der Text betont die Bedeutung der einzelnen Entwicklungsstufen für das Verständnis des Lernprozesses.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Legasthenie, Schriftspracherwerb, Modelle des Schriftspracherwerbs, Uta Frith, Renate Valtin, Diagnose, Förderung, Grundschule, Lehrkraft, Expertenhilfe, phonologische Bewusstheit, Graphem-Phonem-Korrespondenz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) und Legasthenie
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich umfassend mit Problemen beim Lesen und Schreiben, insbesondere mit der Diagnose und Förderung von Lese-Rechtschreibschwächen (LRS) und Legasthenie. Sie untersucht Modelle des Schriftspracherwerbs, beschreibt Erscheinungsformen, Ursachen und diagnostische Verfahren von LRS/Legasthenie und diskutiert den Umgang mit betroffenen Kindern in der Grundschule sowie mögliche Fördermaßnahmen, inklusive der Notwendigkeit externer Hilfe.
Welche Modelle des Schriftspracherwerbs werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt das dreistufige Modell von Uta Frith (1985) mit den Phasen der logographischen, alphabetischen und orthographischen Schreibung und das siebenstufige Modell von Renate Valtin (2000) vor. Beide Modelle dienen als Grundlage zum Verständnis des idealtypischen Lernprozesses und ermöglichen die Erkennung von Abweichungen und Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben.
Wie werden LRS und Legasthenie definiert und charakterisiert?
Die Hausarbeit klärt die Begriffe LRS und Legasthenie und beschreibt deren Erscheinungsbild, Ursachen und diagnostische Verfahren. Sie betont die Bedeutung der frühzeitigen Erkennung und gezielten Förderung.
Welche Rolle spielt die Lehrkraft in der Grundschule bei der Unterstützung von Kindern mit LRS?
Die Arbeit beleuchtet den Umgang der Lehrkraft mit Kindern mit LRS in der Grundschule und die Möglichkeiten der Förderung. Sie betont aber auch die Grenzen der Lehrkraft und die Notwendigkeit, bei Bedarf Experten hinzuzuziehen.
Wann ist Expertenhilfe bei Kindern mit LRS notwendig?
Die Hausarbeit verdeutlicht, wann die Unterstützung durch die Lehrkraft an ihre Grenzen stößt und die Hinzuziehung von Experten (z.B. Sonderpädagogen) notwendig wird, um eine effektive Förderung zu gewährleisten.
Welche Schlüsselwörter sind für die Hausarbeit relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), Legasthenie, Schriftspracherwerb, Modelle des Schriftspracherwerbs, Uta Frith, Renate Valtin, Diagnose, Förderung, Grundschule, Lehrkraft, Expertenhilfe, phonologische Bewusstheit, Graphem-Phonem-Korrespondenz.
Welche Kapitel enthält die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entwicklung des Lesens und Schreibens (inkl. der Modelle von Frith und Valtin), ein Kapitel zu LRS/Legasthenie (Begriffsklärung, Erscheinungsbild, Ursachen, Diagnostik), ein Kapitel zum Umgang mit LRS in der Grundschule und ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der Hausarbeit detailliert zusammengefasst.
Für wen ist diese Hausarbeit relevant?
Diese Hausarbeit ist relevant für Studierende der Pädagogik, Lehramtskandidaten (insbesondere Grundschule), Lehrkräfte und alle, die sich mit der Diagnose und Förderung von Lese-Rechtschreibschwächen und Legasthenie auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Anja Reckenfeld (Auteur), 2012, Kinder mit LRS - Diagnose- und Fördermöglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192322