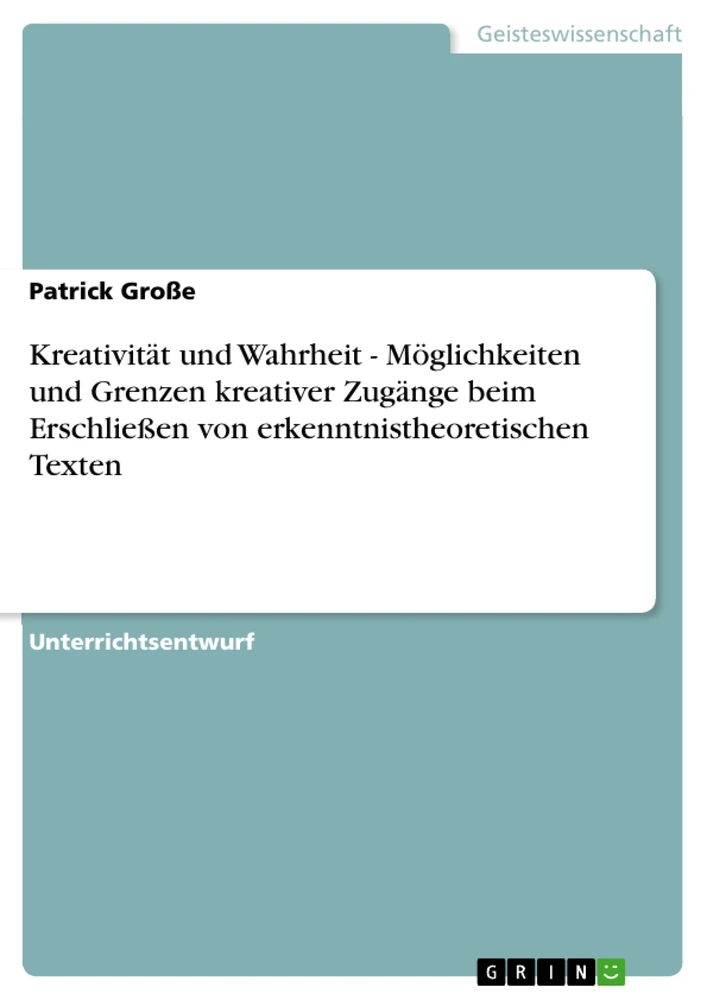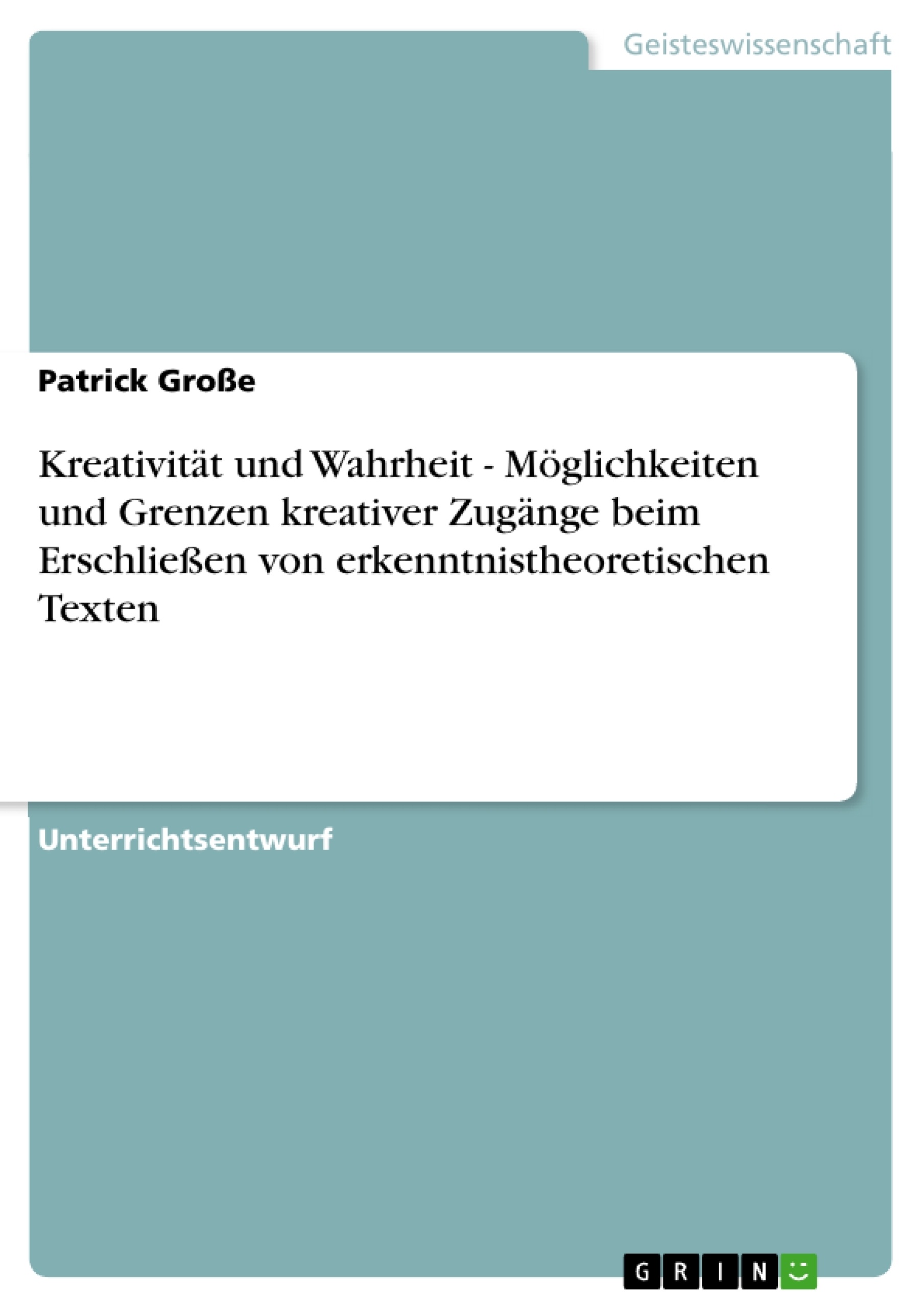Im Ausgang der schriftlichen Arbeit wird […] das Verhältnis der kognitiven und kreativen Leistungen in der Erarbeitung erkenntnistheoretischer Grundfragen beleuchtet. Dabei erfolgt der […]Verweis auf die mögliche anthropologische Grundbestimmung des Menschen in der Figur kreativen Handelns und der sich daraus ergebene systematische Bezug zur philosophischen Bildung. Die entsprechend abgeleiteten methodischen Konsequenzen werden […] in der Fragestellung verdichtet.
In der sinnfälligen Parallelisierung der Verhältnisse von Kreativität / Wahrheit und Kunst / Philosophie wird ein Überblick über die sich inhaltlich kreuzenden didaktischen Fluchtlinien geschaffen und, entgegen der fachüblichen didaktischen Abgrenzung jener Denkweisen, eine Symbiose vorgeschlagen. […]
In der Sachanalyse wird ausgehend vom kantischen Erkenntnismodell gezeigt, dass Erkenntnisprozesse auf Aporien auflaufen, die die logische Begründbarkeit subversieren und somit immanent auf ästhetische Komponenten verweisen. Dabei wird das philosophisch ungelöste Problem der Selbstbezüglichkeit […] berücksichtigt und […] als Ausgangspunkt für die Materialanalyse angenommen. […]
Im thematischen Fokus zur Unterrichtsdurchführung zeigt sich, dass die fachliche Grundlage der […] Hausarbeit ein sehr weites Feld umfasst und zu entsprechenden Unterrichtsverläufen führt – von der Gottesfrage zur Frage nach der formalen Begründbarkeit von Wahrheit.
[Auszug aus dem Bewertungsgutachten.]
Inhaltsverzeichnis
- Übersicht
- Abkürzungsverzeichnis und Hinweise
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1 Themaanalyse
- 2.2 Sachanalyse
- 2.3 Materialanalyse
- 3. Durchführung des Unterrichtsvorhabens
- 3.1 Zur Lerngruppe
- 3.2 Zu den Lernvoraussetzungen
- 3.3 Didaktische Überlegungen
- 3.4 Methodische Überlegungen
- 3.5 Thematischer Fokus zur Unterrichtsdurchführung
- 4. Reflexion und Auswertung
- 4.1 Zu den Zielen und Kompetenzen der Stunde
- 4.2 Zur Lerngruppe
- 4.3 Zum Lehrerverhalten
- 4.4 Zum verwendeten Material und den Aufgabenstellungen
- 4.5 Zum methodischen Vorgehen und zur Planung
- 5. Fazit
- 6. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Anwendung kreativer Methoden beim Erschließen erkenntnistheoretischer Texte im Fach Werte und Normen. Der Fokus liegt auf der Doppelstunde, die im Rahmen eines 12. Jahrgangs der gymnasialen Oberstufe durchgeführt wurde, und befasst sich mit den Chancen und Grenzen kreativer Ansätze in der Auseinandersetzung mit philosophischen Texten.
- Kreativität als Methodengrundlage für die Erschließung erkenntnistheoretischer Texte
- Verknüpfung von Kreativität und Wahrheit im Kontext des Wissensbegriffs
- Didaktische und methodische Überlegungen zur Integration kreativer Ansätze im Unterricht
- Reflexion der Anwendung von kreativen Methoden in der Praxis
- Bedeutung der philosophischen Methodik für die systematische Einordnung kreativer Ansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Zielsetzung und den Kontext der durchgeführten Unterrichtsstunde vor. Der theoretische Rahmen beleuchtet die Beziehung zwischen Kreativität und Wahrheit, wobei der kreative Prozess als eine Form der Entdeckung, Reifung und Ausarbeitung betrachtet wird. Es wird die Notwendigkeit betont, dass kreative Ansätze, insbesondere im Unterricht, eine methodische Grundlage in der Philosophie finden.
Die Durchführung des Unterrichtsvorhabens beschreibt die Lerngruppe, die Lernvoraussetzungen, didaktische und methodische Überlegungen sowie den thematischen Fokus der Doppelstunde.
Die Reflexion und Auswertung beurteilt die Ziele und Kompetenzen der Stunde, die Lerngruppe, das Lehrerverhalten, das verwendete Material, die Aufgabenstellungen sowie das methodische Vorgehen und die Planung.
Schlüsselwörter
Kreativität, Wahrheit, Erkenntnistheorie, Philosophie, Methodengrundlage, Unterrichtsvorhaben, didaktische und methodische Überlegungen, philosophische Texte, kreative Methoden, Doppelstunde.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Kreativität und Wahrheit in der Philosophie zusammen?
Kreativität wird hier als Methode verstanden, um komplexe erkenntnistheoretische Wahrheiten zu erschließen, indem kognitive Leistungen durch ästhetische Zugänge ergänzt werden.
Welche Rolle spielt Kant in diesem Kontext?
Ausgehend vom kantischen Erkenntnismodell wird gezeigt, dass rein logische Prozesse oft an Grenzen (Aporien) stoßen, die auf die Notwendigkeit ästhetischer Komponenten verweisen.
Was sind kreative Zugänge zu philosophischen Texten?
Dies umfasst Methoden, die über die reine Textanalyse hinausgehen, um philosophische Probleme durch gestalterische oder assoziative Prozesse greifbar zu machen.
Für welche Klassenstufen ist dieser Ansatz geeignet?
Der Ansatz wurde erfolgreich in der gymnasialen Oberstufe (Jahrgang 12) im Fach Werte und Normen getestet, um abstrakte Erkenntnistheorie zu vermitteln.
Wo liegen die Grenzen kreativer Methoden im Philosophieunterricht?
Die Herausforderung besteht darin, die fachliche Tiefe zu bewahren und sicherzustellen, dass die kreative Arbeit stets auf einer soliden methodischen und philosophischen Basis steht.
- Arbeit zitieren
- Patrick Große (Autor:in), 2012, Kreativität und Wahrheit - Möglichkeiten und Grenzen kreativer Zugänge beim Erschließen von erkenntnistheoretischen Texten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192429