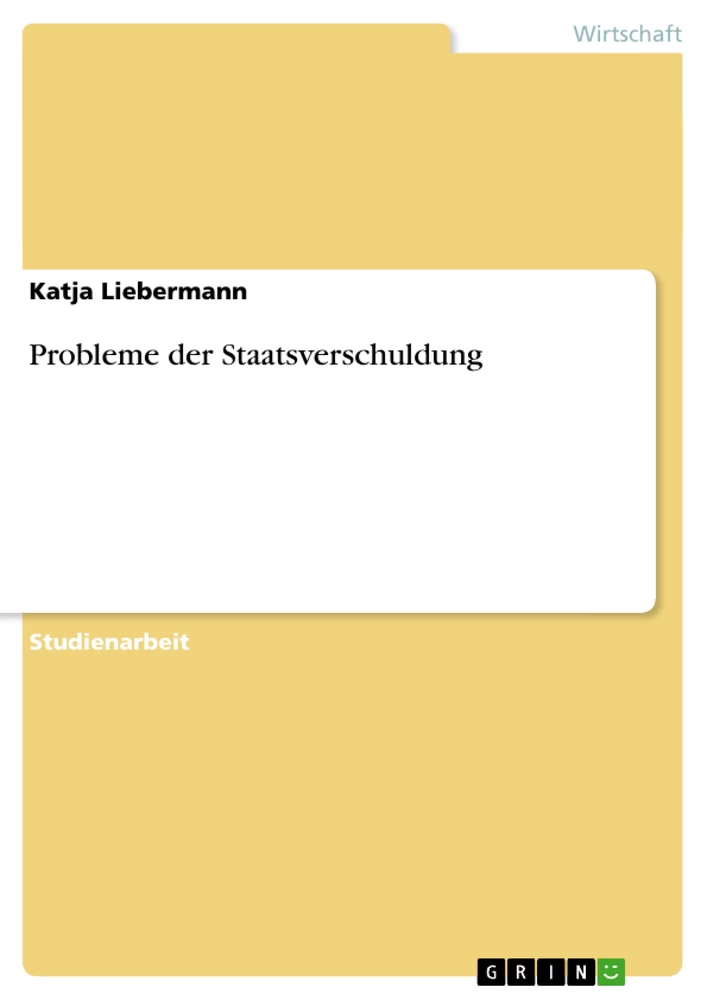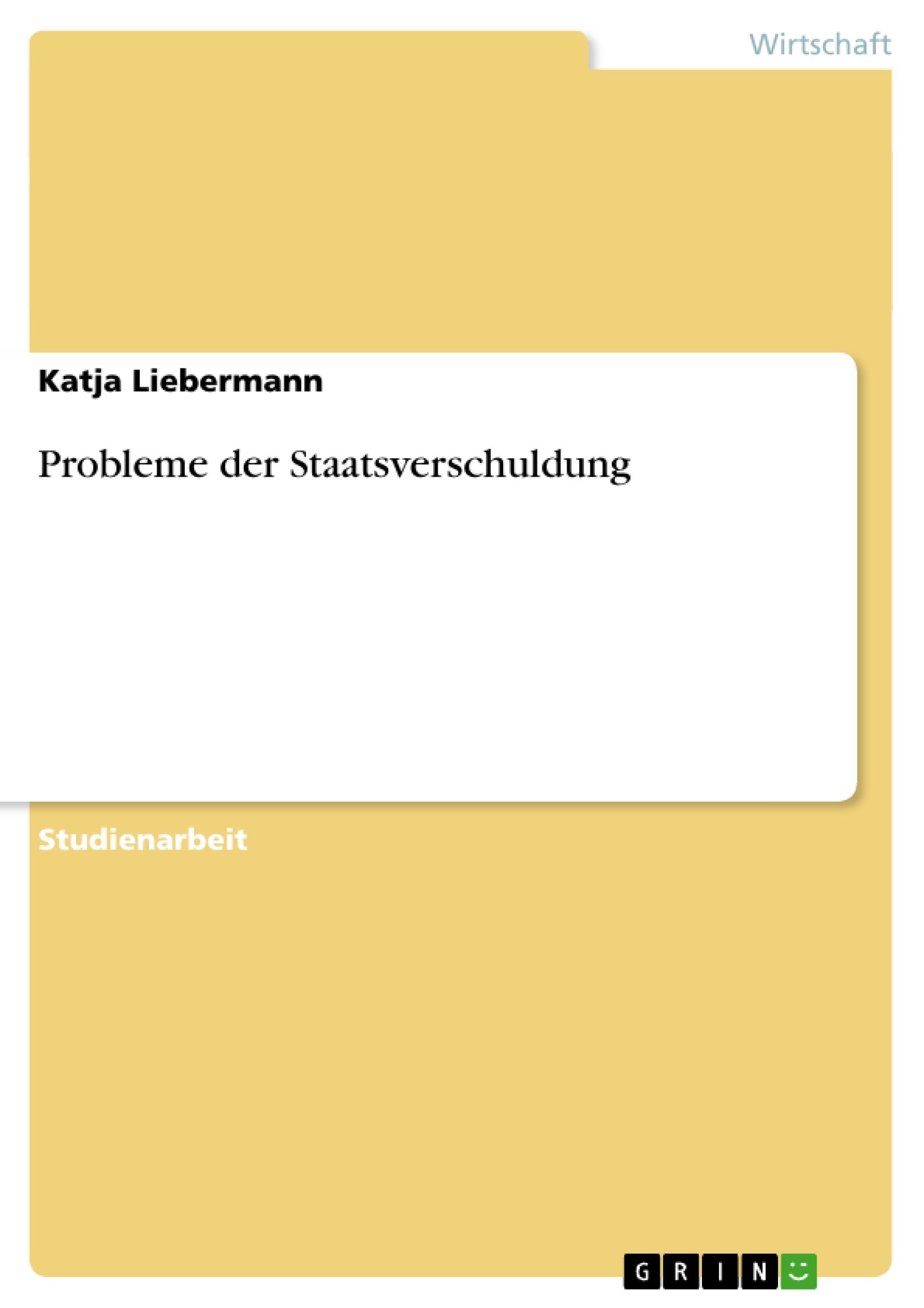Das Phänomen der Staatsverschuldung ist nicht neu. Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts verstärkten
viele Staaten im Rahmen der Industrialisierung ihre unternehmerische Tätigkeit und
finanzierten ihre Investitionsvorhaben mittels der Aufnahme von Krediten. Ein weiterer wichtiger
Verschuldungsgrund der letzten Jahrhunderte waren Kriege, nach denen für Reparationszahlungen
und Wiederaufbau erhebliche Beträge benötigt wurden. Die Staatsverschuldung im
heutigen Sinne ist jedoch nicht auf umfangreiche Investitionsvorhaben, Katastrophen oder
Kriege zurückzuführen und betrifft vor allem hoch industrialisierte Länder.
Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der
Wirtschaft (StWG) wurde 1967 in Deutschland die antizyklische Fiskalpolitik nach dem Modell
von John Maynard Keynes eingeführt, nach dem im Aufschwung und Boom die staatliche
Nachfrage gedrosselt und Rücklagen gebildet werden. Diese sollen in Zeiten der Rezession zur
Anregung der Konjunktur mittels erhöhter staatlicher Ausgaben genutzt werden, wobei ein
kurzfristiges Haushaltsdefizit bedenkenlos in Kauf genommen werden kann (deficit spending).
1 Da die entscheidende Komponente der Rücklagenbildung jahrelang nicht in ausreichendem
Maße durchgeführt wurde und somit die erforderlichen Mittel zur Ausgabenerhöhung
in der Rezession fehlten, sammelte sich ein immenser Schuldenberg an, der von Beginn
an nicht aus Haushaltsmitteln sondern durch Umschuldungen zurückgeführt wurde2, und dessen
steigende Zinslast den Staatshaushalt mehr und mehr belasten.
Ursächlich für diese Entwicklung waren zunächst steigende Ansprüche der Bevölkerung an
die Regierung und der damit verbundene Ausbau des Wohlfahrtsstaates zu Beginn der 70er
Jahre. Die anschließende Rezession, ausgelöst durch den ersten „Ölpreisschock“, war der
Ausgangspunkt für eine erste Explosion der staatlichen Kreditaufnahme. In den folgenden
Jahren konnte durch strikte Konsolidierungsmaßnahmen die Neuverschuldung bis zum Jahr
1989 beinahe vollständig zurückgeführt werden. Die im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung
übernommenen Altlasten der ehemaligen DDR und die Förderung der neuen Bundesländer
führten jedoch erneut zu einer kritischen Situation des deutschen Staatshaushalts.3 [...]
1 Vgl. Lachmann (1987), S. 32 f.
2 Vgl. http://home.t-online.de/home/dieter.meyer/homepage.htm (download 04.10.2002, 11:29 Uhr).
3 Vgl. Halstenberg (2001), S. 22 ff.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Definitorische und gesetzliche Grundlagen
- 2.1 Der Staatshaushalt
- 2.2 Begriffsabgrenzungen
- 2.3 Gesetzliche Grenzen und Zulässigkeiten der Staatsverschuldung
- 2.3.1 Haushalts- und verfassungsrechtliche Bestimmungen in Deutschland
- 2.3.2 EG-Vertrag und Stabilitäts- und Wachstumspakt auf europäischer Ebene
- 3. Welche Probleme resultieren aus der Kreditaufnahme des Staates?
- 3.1 Finanzwirtschaftliche Folgen
- 3.2 Monetäre Folgen
- 3.2.1 Wachsende Inflationsgefahr
- 3.2.2 Finanzielles Crowding-Out
- 3.3 Realwirtschaftliche Folgen
- 3.3.1 Realwirtschaftliches Crowding-Out
- 3.3.2 Wachstumseinbußen
- 3.4 Erwartungseffekte
- 3.4.1 Preistreibende Erwartungseffekte durch Inflationsbefürchtungen
- 3.4.2 Expectations-Crowding-Out
- 3.4.3 Empirische Aspekte
- 3.5 Verteilungspolitische Folgen
- 3.5.1 Interpersonelle Verteilung
- 3.5.2 Intertemporale Allokation
- 4. Lösungsansätze zum Abbau der Staatsverschuldung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Problem der Staatsverschuldung in Deutschland und der Europäischen Union. Ziel ist es, die Ursachen, Folgen und Lösungsansätze der Staatsverschuldung zu analysieren und die Problematik in ihrer komplexen Dimension zu beleuchten.
- Definitorische und gesetzliche Grundlagen der Staatsverschuldung
- Finanzwirtschaftliche Folgen der Staatsverschuldung
- Monetäre und realwirtschaftliche Auswirkungen der Staatsverschuldung
- Verteilungspolitische Folgen der Staatsverschuldung
- Lösungsansätze zum Abbau der Staatsverschuldung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit bietet eine Einführung in das Thema Staatsverschuldung und skizziert die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den definitorischen und gesetzlichen Grundlagen der Staatsverschuldung, wobei der Fokus auf dem deutschen und europäischen Rechtsrahmen liegt. Hier werden wichtige Begriffe wie Staatshaushalt, Schuldenstand und Verschuldungsgrenzen definiert und gesetzliche Vorgaben erläutert. Im dritten Kapitel werden die verschiedenen Folgen der Staatsverschuldung analysiert. Hier werden sowohl finanzwirtschaftliche, monetäre als auch realwirtschaftliche und verteilungspolitische Auswirkungen untersucht. Es werden wichtige Konzepte wie Crowding-Out und Inflationsbefürchtungen beleuchtet. Das vierte Kapitel widmet sich den Lösungsansätzen, die zur Reduzierung der Staatsverschuldung beitragen können.
Schlüsselwörter
Staatsverschuldung, Staatshaushalt, Haushaltsdefizit, Schuldenstand, Finanzwirtschaft, Monetäre Folgen, Realwirtschaft, Crowding-Out, Inflationsgefahr, Verteilungspolitik, Lösungsansätze, Stabilitäts- und Wachstumspakt, EG-Vertrag, EU-Vertrag, Haushaltsgrundsätzegesetz, Deutschland, Europäische Union.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Ursachen für die hohe Staatsverschuldung in Deutschland?
Ursachen sind unter anderem der Ausbau des Sozialstaates, Ölpreisschocks, die Kosten der Wiedervereinigung und die mangelnde Rücklagenbildung in Boomphasen.
Was versteht man unter 'Deficit Spending'?
Ein wirtschaftspolitisches Konzept nach Keynes, bei dem der Staat in Krisenzeiten Kredite aufnimmt, um die Konjunktur durch Ausgabenprogramme anzukurbeln.
Welche Probleme verursacht eine hohe Staatsverschuldung?
Mögliche Folgen sind steigende Zinslasten, Inflationsgefahr, Wachstumseinbußen und das sogenannte 'Crowding-Out' privater Investitionen.
Was ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt?
Eine europäische Vereinbarung, die die Neuverschuldung der EU-Mitgliedstaaten auf 3 % und den Gesamtschuldenstand auf 60 % des BIP begrenzt.
Was bedeutet 'Crowding-Out'?
Es beschreibt die Verdrängung privater Nachfrage oder Investitionen durch staatliche Aktivitäten, oft infolge steigender Zinsen durch hohe Staatsverschuldung.
- Arbeit zitieren
- Katja Liebermann (Autor:in), 2002, Probleme der Staatsverschuldung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19346