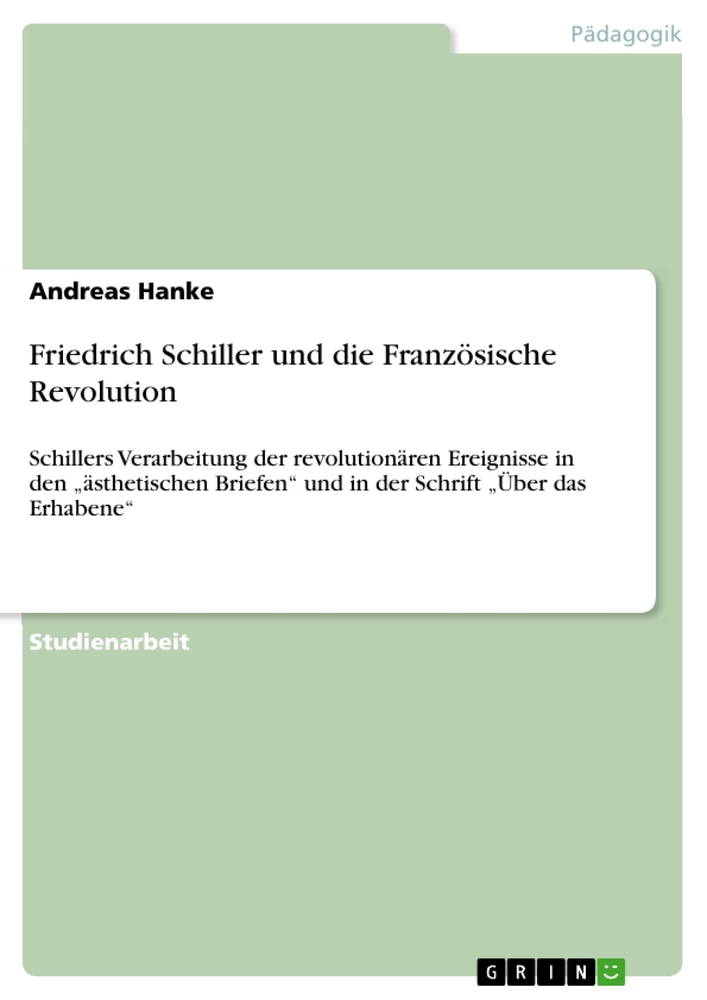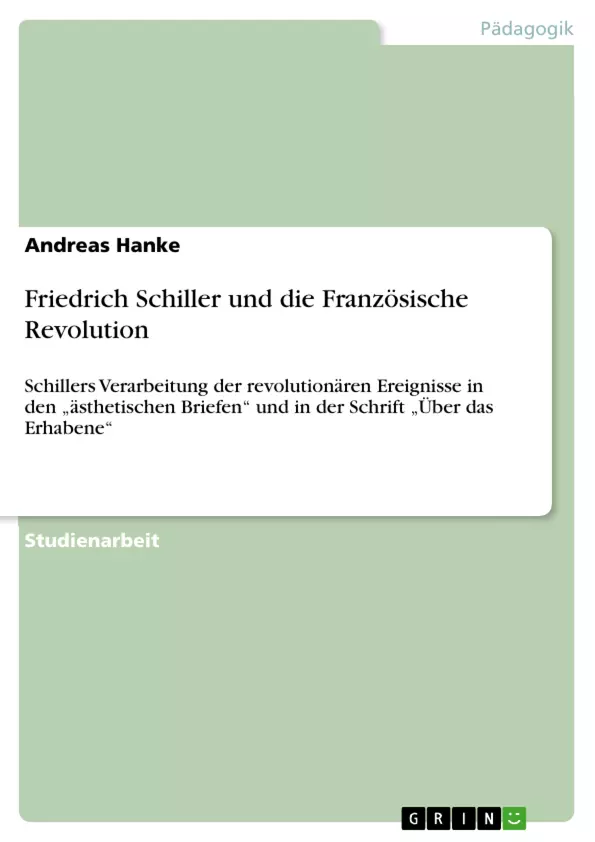Im folgenden soll Schillers Haltung zur Französischen Revolution und dem damit unlösbar verbundenen Projekt der Moderne am Beispiel seiner „Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen“ und seiner Schrift „Über das Erhabene“ einer genaueren Analyse unterzogen werden. Dabei sollen vor allem folgende Fragen im Mittelpunkt stehen: Welche aufschlussreichen und aussagekräftigen Untersuchungsgegenstände über Schillers Einstellung zur Französischen Revolution existieren neben seinen mittlerweile bereits überbeanspruchten Dramen und wie können sie für diese Arbeit und die weitere Forschung fruchtbar gemacht werden?
Wie beurteilt Schiller die Auswirkungen der Französischen Revolution und der modernen Zivilisation und welche Alternativkonzeptionen entwickelt er in den „ästhetischen Briefen“ und in der Schrift „Über das Erhabene“?
Wie definiert Schiller den Begriff des menschlichen Spiels und der menschlichen Vollkommenheit?
Was versteht Schiller unter dem optimalen Gleichgewicht zwischen Gefühl und Verstand und wie will er dieses Gleichgewicht erreichen?
Inwiefern sind Schillers ästhetisch-pädagogische Forderungen und Handlungsstrategien heute noch aktuell und realisierbar?
Inhalt
1. Einleitung
2. Die Besonderheiten der Französischen Revolution
3. Die Grundzüge der Französischen Revolution
3.1 Zeitgeschichtliche Voraussetzungen
3.2 Periodisierung und Ablauf elementarer Ereignisse
3.3 Gesellschaftliche Folgen und ihre Bewertung
4. Schillers grundsätzliche Haltung zur Französischen Revolution
4.1 Der persönliche Erfahrungs- und Erwartungsraum
4.2 Die Bewertung der Ereignisse
4.3 Allgemeine Alternativkonzeptionen
5. Schillers gesellschaftliche Gegenwartsdiagnose und Zielperspektiven in den Briefen „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“
6. Schillers ästhetisch-pädagogische Forderungen und Handlungsstrategien in den Briefen
7. Die Weiterentwicklung der ästhetischen Konzeption Schillers in der Schrift „über das Erhabene“
8. Zusammenfassung und Ausblick: Aktualität und Realisierbarkeit der Forderungen
9. Literatur
Häufig gestellte Fragen
Wie beurteilt Friedrich Schiller die Auswirkungen der Französischen Revolution?
Schiller unterzieht die Auswirkungen der Französischen Revolution und der modernen Zivilisation einer kritischen Analyse, insbesondere in seinen Schriften zur ästhetischen Erziehung, und entwickelt dort Alternativkonzeptionen zur rein politischen Umwälzung.
Was versteht Schiller unter dem Begriff des menschlichen Spiels?
Für Schiller ist das Spiel ein zentraler Begriff der menschlichen Vollkommenheit. Im Spieltrieb vereinigen sich Stofftrieb und Formtrieb, wodurch der Mensch seine wahre Freiheit und Ganzheitlichkeit erreicht.
Wie definiert Schiller das Gleichgewicht zwischen Gefühl und Verstand?
Schiller strebt ein optimales Gleichgewicht zwischen Sinnlichkeit (Gefühl) und Vernunft (Verstand) an. Er möchte dieses durch die ästhetische Erziehung erreichen, die den Menschen veredelt, ohne seine Natur zu unterdrücken.
Welche Werke Schillers dienen als Hauptquellen für seine Haltung zur Moderne?
Neben seinen Dramen sind vor allem die theoretischen Schriften „Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen“ und „Über das Erhabene“ maßgebliche Untersuchungsgegenstände für seine Einstellung zur Revolution und Moderne.
Sind Schillers ästhetisch-pädagogische Forderungen heute noch aktuell?
Die Arbeit untersucht die Realisierbarkeit von Schillers Strategien in der heutigen Zeit und kommt zu dem Schluss, dass seine Forderungen nach einer ganzheitlichen Bildung und der Harmonisierung menschlicher Kräfte weiterhin Relevanz besitzen.
- Quote paper
- Andreas Hanke (Author), 2000, Friedrich Schiller und die Französische Revolution, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195888