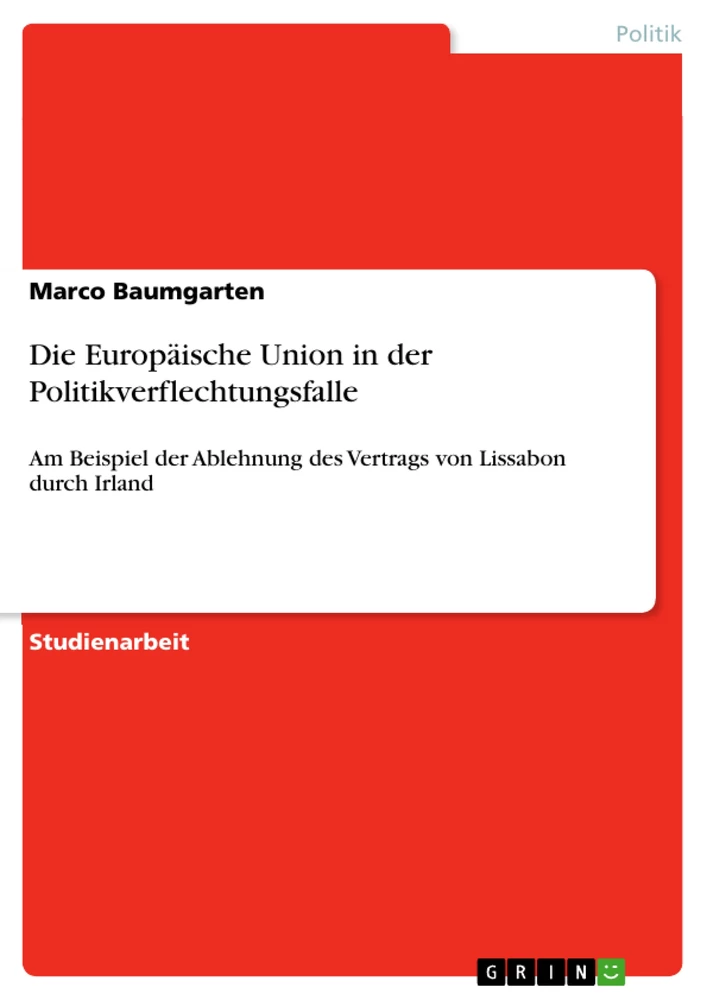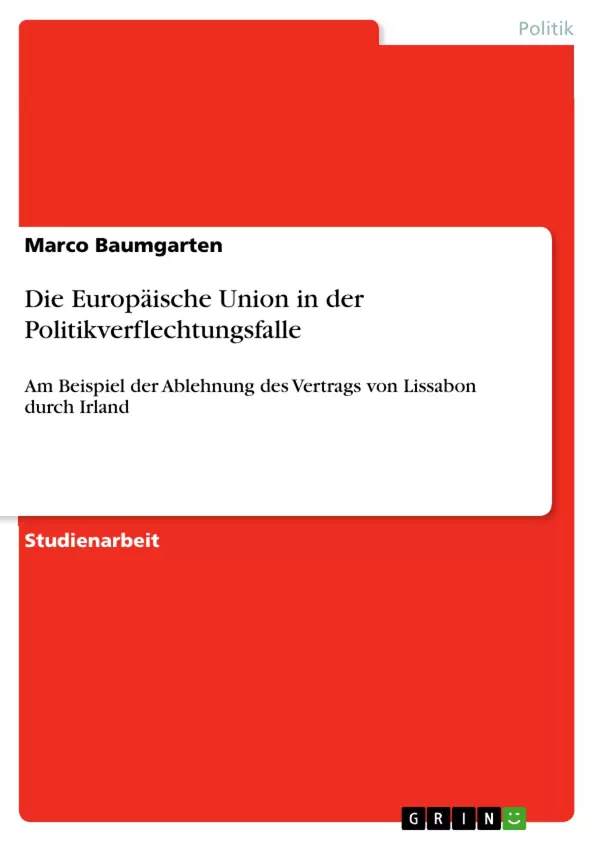Am 13. Dezember 2007 wurde der ‚Vertrag von Lissabon‘ von den europäischen Regierungschefs unterzeichnet und damit die mehrjährigen Verhandlungen über die institutionellen Reformen der Europäischen Union beendet. Dadurch wurden die bereits verabschiedeten Verträge nicht etwa ersetzt, sondern lediglich verändert und erweitert.
Die offizielle Aussage war zusammenfassend: „Durch den neuen Vertrag erhält die Europäische Union den rechtlichen Rahmen und die Mittel, die notwendig sind, um künftige Herausforderungen zu bewältigen und auf die Bedürfnisse der Bürger einzugehen.“
Der Vertrag von Lissabon konnte schließlich von allen Mitgliedern ratifiziert werden. Von allen, bis auf Irland. Da dieser Vertrag die Verfassung der Länder berührte, war es per irischem Grundgesetz notwendig, in Irland eine Volksabstimmung durchzuführen, die für eine Verfassungsänderung positiv ausfallen musste. Und genau an diesem Punkt sollte der Ratifizierungsprozess des Vertrags scheitern.
Dabei zeigte sich, dass die Europäische Union in der klassischen Politikverflechtungsfalle nach F. Scharpf steckte. Es reichte eine irische Minderheit und ein amerikanischer Finanzierer, um die Entscheidung für die gesamte EU-Bevölkerung zu blockieren.
Inhaltsübersicht
1. Einleitung
2. Die Europäische Union
2.1. Der Vertrag von Lissabon: Inhalte
3. Irland
3.1. Daten und Entwicklung
3.2. Das politische System Irlands
3.3. Politische Akteure zum Zeitpunkt des Referendums
4. Die Politikverflechtungsfalle nach W. Scharpf
5. Die Europäische Union und die Politikverflechtungsfalle
6. Fazit
7. Quellenangaben
Häufig gestellte Fragen
Was ist die „Politikverflechtungsfalle“ nach Fritz Scharpf?
Die Politikverflechtungsfalle beschreibt eine Situation, in der notwendige Reformen blockiert werden, weil Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen und einzelne Akteure ein Vetorecht haben, was zu suboptimalen Kompromissen oder Stillstand führt.
Welche Bedeutung hatte der Vertrag von Lissabon?
Der Vertrag von Lissabon sollte die Institutionen der EU reformieren, um sie effizienter und demokratischer zu machen, indem er unter anderem die Befugnisse des Europäischen Parlaments stärkte und neue Abstimmungsregeln einführte.
Warum scheiterte die Ratifizierung zunächst in Irland?
Irland war das einzige Land, in dem aufgrund der Verfassung eine Volksabstimmung nötig war. Eine Mehrheit der irischen Wähler lehnte den Vertrag im ersten Referendum ab, was den gesamten EU-Prozess blockierte.
Welche Rolle spielten externe Akteure beim irischen Referendum?
Kritiker weisen darauf hin, dass finanzstarke Akteure, unter anderem aus den USA, die Nein-Kampagne in Irland unterstützten, was die Blockademacht einer kleinen Minderheit innerhalb der EU verdeutlichte.
Wurde der Vertrag von Lissabon schließlich doch noch gültig?
Ja, nach Zugeständnissen der EU an Irland (z. B. in Bezug auf die Neutralität und Steuerhoheit) stimmten die Iren in einem zweiten Referendum zu, sodass der Vertrag am 1. Dezember 2009 in Kraft treten konnte.
- Quote paper
- Marco Baumgarten (Author), 2009, Die Europäische Union in der Politikverflechtungsfalle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197476