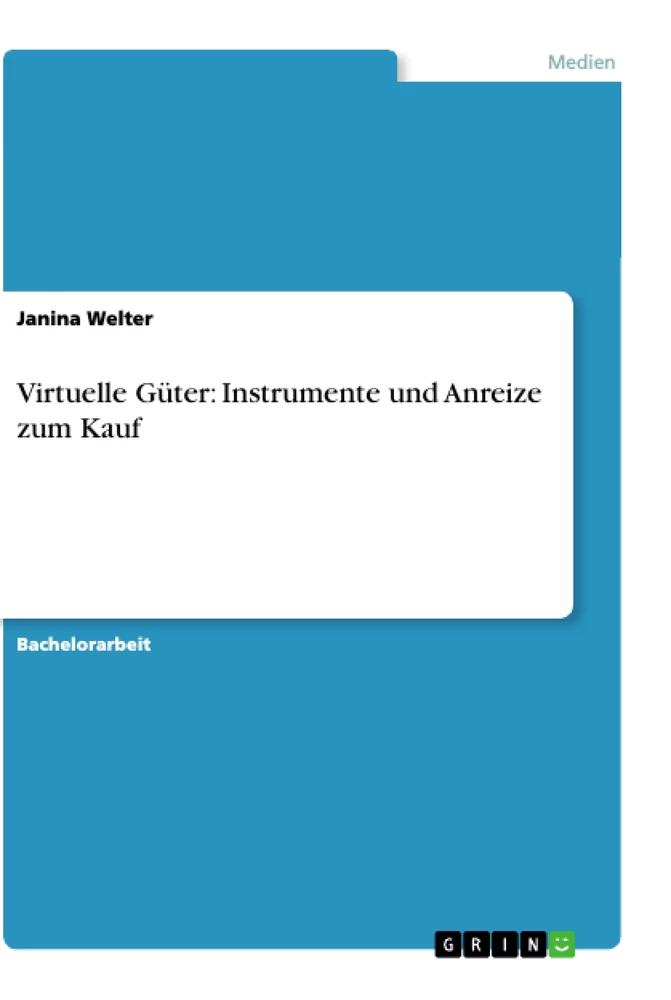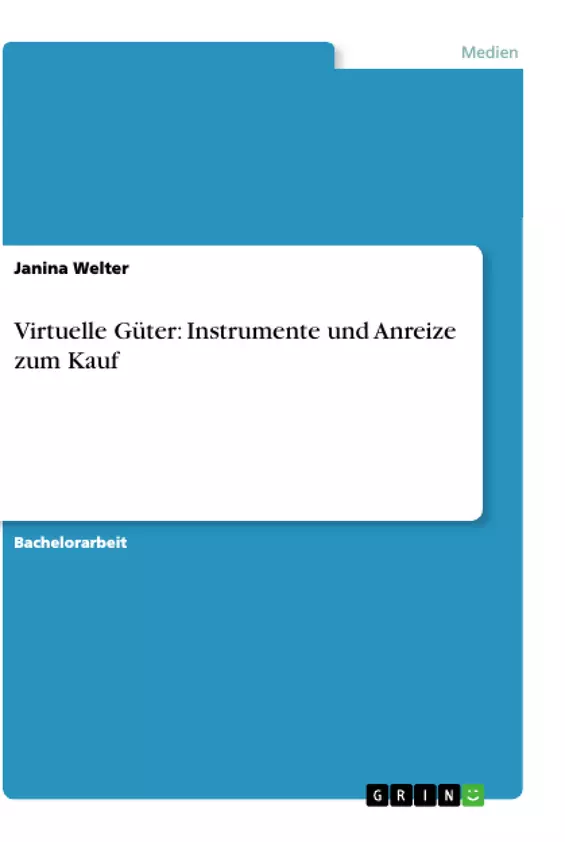Die Entwickler virtueller Welten, sozialer Netzwerke und Online-Spiele setzen zunehmend auf ein Erlösmodell, welches auf dem Verkauf von virtuellen Gütern basiert. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, anhand von Beispielen die Instrumente und Anreize der Unternehmen herauszuarbeiten, mit deren Hilfe die Nutzer zum Kauf virtueller Güter motiviert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Güter - Eine volkswirtschaftliche Betrachtung
- Virtuelle Güter
- Funktionale virtuelle Güter
- Repräsentative virtuelle Güter
- Soziale virtuelle Güter
- Virtuelle Güter und deren materielle Pendants im Vergleich
- Das Wertverständnis des Konsumenten in Bezug auf virtuelle Güter
- Zahlungsmodelle für virtuelle Güter
- Direct-Payment
- Offer-Payment
- Virtuelle Güter innerhalb verschiedener Marktsegmente
- Virtuelle Welten
- Spielorientierte virtuelle Welten
- World of Warcraft
- „Metin2“
- Sozialorientierte virtuelle Welten
- „Second Life“
- „Habbo Hotel“
- Gold-Farmer
- Spielorientierte virtuelle Welten
- Virtuelle Güter im Computerspiel „Die Sims“
- Virtuelle Güter in sozialen Netzwerken
- StudiVZ
- Virtuelle Güter innerhalb von Mobile-Applications als In-App-Käufe
- Die Applikation „Angry Birds“
- „Rock Battle Live“
- Virtuelle Welten
- Die Entstehung von Bedürfnissen und die Einordnung virtueller Güter in die klassische Güterklassifikation
- Das Wertverständnis der Konsumenten für virtuelle Güter und die damit verbundenen Kaufanreize
- Die unterschiedlichen Zahlungsmodelle für virtuelle Güter und deren jeweilige Vor- und Nachteile
- Die Anreizsysteme für den Kauf virtueller Güter in verschiedenen Marktsegmenten, wie z.B. spielorientierten virtuellen Welten, sozialen Netzwerken und Mobile-Applications
- Die Bedeutung von virtuellen Währungen und Paketbündelung für die Gestaltung von Kaufanreizen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Anreizsystemen und Instrumenten, die Unternehmen nutzen, um Nutzer zum Kauf virtueller Güter in Onlinespielen, virtuellen Welten und sozialen Netzwerken zu motivieren. Die Arbeit analysiert verschiedene Beispiele aus diesen Marktsegmenten und untersucht, wie die Unternehmen Bedürfnisse bei den Nutzern erzeugen und sie zum Kauf von digitalen Zusatzinhalten bewegen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 behandelt die klassischen Güter und die Entstehung von Bedürfnissen. Kapitel 3 definiert virtuelle Güter und ordnet diese in die klassische Güterklassifikation ein. Kapitel 4 analysiert das Wertverständnis des Konsumenten für virtuelle Güter. Kapitel 5 erläutert die verschiedenen Zahlungsmodelle für virtuelle Güter. In Kapitel 6 werden die Anreizsysteme für den Kauf virtueller Güter in verschiedenen Marktsegmenten anhand von konkreten Beispielen untersucht. Dieses Kapitel betrachtet sowohl spielorientierte virtuelle Welten, wie „World of Warcraft“ und „Metin2“, als auch sozialorientierte virtuelle Welten, wie „Second Life“ und „Habbo Hotel“. Darüber hinaus werden die virtuellen Güter in sozialen Netzwerken, wie „StudiVZ“ und „Facebook“, sowie in Mobile-Applications, wie „Angry Birds“ und „Rock Battle Live“, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen virtuellen Gütern, Kaufanreizen, Anreizsystemen, virtuellen Währungen, Paketbündelung, Online-Spielen, virtuellen Welten, sozialen Netzwerken, Mobile-Applications, In-App-Käufen, Direct-Payment, Offer-Payment, „World of Warcraft“, „Metin2“, „Second Life“, „Habbo Hotel“, „StudiVZ“, „Facebook“, „Angry Birds“, „Rock Battle Live“. Die Arbeit untersucht auch die Bedeutung von „branded virtual goods“ und die Rolle von „Gold-Farmern“ im Markt für virtuelle Güter.
Häufig gestellte Fragen
Was sind virtuelle Güter?
Es handelt sich um digitale Zusatzinhalte in Online-Spielen, sozialen Netzwerken oder Apps, die keinen materiellen Gegenwert haben, aber für den Nutzer einen funktionalen oder sozialen Nutzen bieten.
Welche Anreize bewegen Nutzer zum Kauf virtueller Güter?
Häufige Anreize sind Zeitersparnis, Status innerhalb einer Community (repräsentative Güter), Spielvorteile oder soziale Interaktion.
Welche Zahlungsmodelle gibt es für virtuelle Güter?
Man unterscheidet primär zwischen Direct-Payment (direkte Bezahlung) und Offer-Payment (Erhalt durch Teilnahme an Umfragen oder Werbeaktionen).
Was ist der Unterschied zwischen spiel- und sozialorientierten Welten?
In Welten wie „World of Warcraft“ steht der Spielvorteil im Fokus, während in „Second Life“ oder „Habbo Hotel“ die Selbstdarstellung und soziale Kontakte wichtiger sind.
Was sind In-App-Käufe?
Dies sind Käufe innerhalb einer mobilen Applikation (z.B. „Angry Birds“), um zusätzliche Level, Funktionen oder virtuelle Währungen freizuschalten.
Welche Rolle spielen virtuelle Währungen?
Virtuelle Währungen entkoppeln den Kaufakt vom realen Geldwert, was die Hemmschwelle für Ausgaben senken und die Kundenbindung erhöhen kann.
- Citar trabajo
- Janina Welter (Autor), 2011, Virtuelle Güter: Instrumente und Anreize zum Kauf, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199567