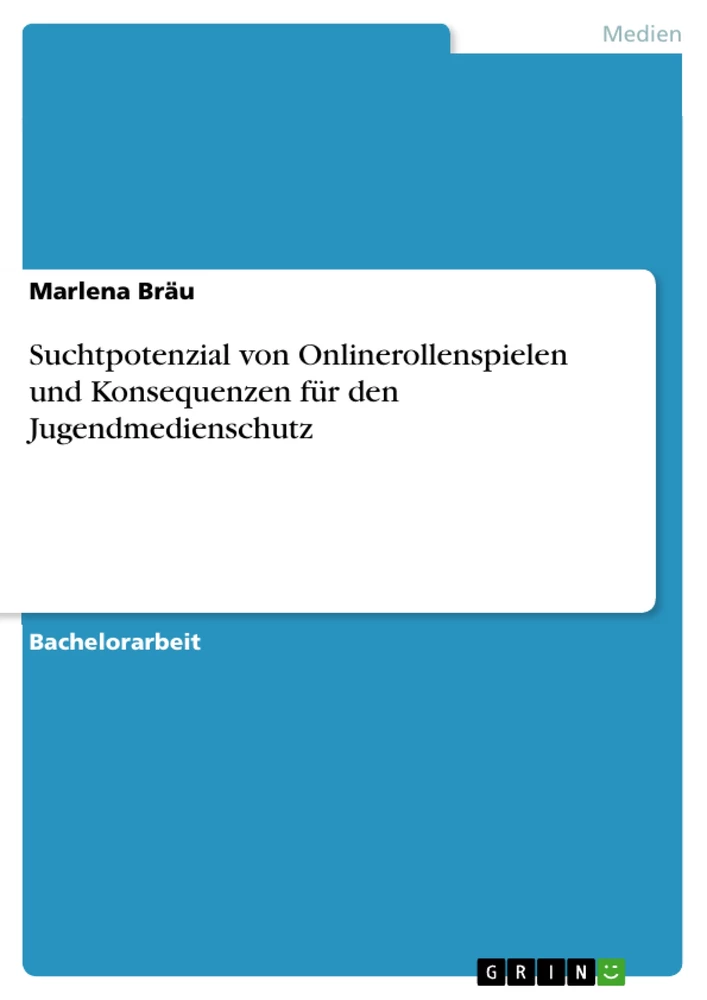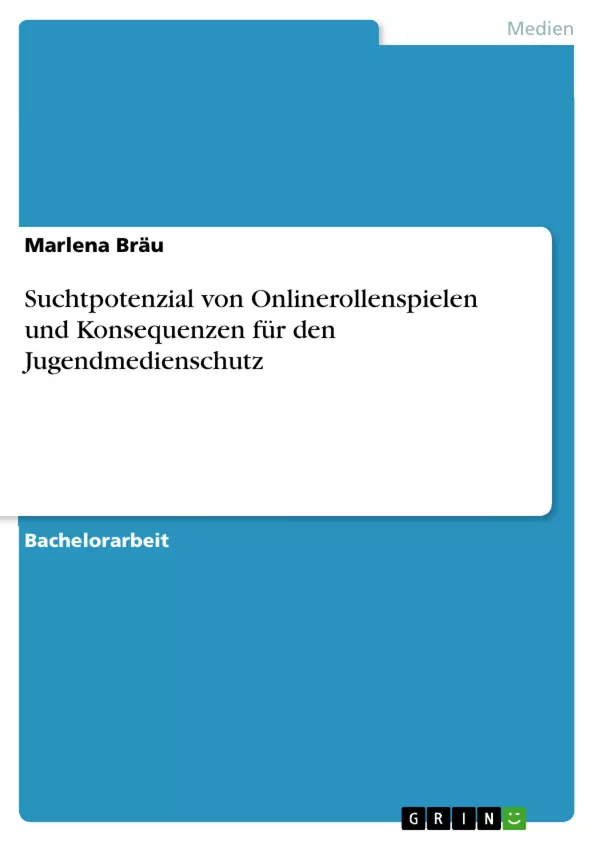Onlinespiele, vor allem die Untergruppe der Onlinerollenspiele zeichnen sich nicht durch brutale Gewaltdarstellungen aus, sondern durch die deutlich längeren Nutzungszeiten, die inzwischen in mehreren Studien belegt wurden. Der Verkaufsschlager „World of Warcraft“ ist inzwischen nach Counter Strike zum zweitbeliebtesten Onlinespiel der deutschen Jugendlichen avanciert.
Spiele wie dieses bergen durch spezielle spielimmanente Faktoren ein erhöhtes Abhängigkeitspotenzial. Neben der Diskussion, ob Computerspiele überhaupt eine „Sucht“ im psychologischen Sinne hervorrufen können, was diese ausmacht und wie sie in Zukunft gehandhabt werden soll, soll in dieser Arbeit auch auf die sich daraus ergebenden Ansprüche an den gesetzlichen Jugendmedienschutz eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nutzungs- und Wirkungsforschung zu Computerspielen
- Nutzungsmotive
- Wirkungsforschung
- Onlinespiele: Definition und Nutzungsdaten
- Definition und Merkmale am Beispiel des Spiels „World of Warcraft"
- Nutzungsdaten zu Onlinerollenspielen
- Jugendgefährdende Komponenten in Onlinerollenspielen
- Abhängigkeitspotenzial
- Problematik des Begriffs „Onlinesucht"
- Anzeichen und Kriterien einer Computerspielsucht
- Entwicklungsbeeinträchtigung durch übermäßiges Spielen
- Konsequenzen für den Jugendmedienschutz
- Regelungskompetenz
- Die USK: Struktur, Prüfverfahren und Kritik
- Bewertung der USK-Einstufung von Onlinerollenspielen
- Forderungen zum Schutze Jugendlicher
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit dem Suchtpotenzial von Onlinerollenspielen und den daraus resultierenden Konsequenzen für den Jugendmedienschutz. Ziel ist es, die spezifischen Merkmale von Onlinerollenspielen, insbesondere im Vergleich zu anderen Computerspielgenres, zu beleuchten und deren Einfluss auf das Spielverhalten von Jugendlichen zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die Frage gelegt, ob und inwiefern Onlinerollenspiele ein Suchtpotenzial besitzen und welche Auswirkungen dies auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von Jugendlichen haben kann.
- Nutzungsmotive und Wirkungsforschung zu Computerspielen
- Definition und Merkmale von Onlinerollenspielen, insbesondere am Beispiel von „World of Warcraft"
- Abhängigkeitspotenzial von Onlinerollenspielen und die Problematik des Begriffs „Onlinesucht"
- Entwicklungsbeeinträchtigungen durch übermäßigen Konsum von Onlinerollenspielen
- Konsequenzen für den Jugendmedienschutz, insbesondere die Rolle der USK und die Notwendigkeit einer adäquaten Altersfreigabe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Suchtpotenzial von Onlinerollenspielen" ein und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext des Jugendmedienschutzes. Es wird die aktuelle Debatte um „Killerspiele" und deren vermeintliche Auswirkungen auf Jugendliche angesprochen und im Gegenzug auf das Suchtpotenzial von Onlinerollenspielen hingewiesen, das bisher weniger Beachtung fand. Die Einleitung stellt außerdem die wichtigsten Quellen und Forschungsarbeiten vor, auf die sich die Arbeit stützt.
Kapitel 2 befasst sich mit der allgemeinen Nutzungs- und Wirkungsforschung zu Computerspielen. Es werden verschiedene Nutzungsmotive, wie Unterhaltung, Stressabbau, Eskapismus und die Bedürfnisbefriedigung nach Macht und Kontrolle, sowie die spezifischen Merkmale von Computerspielen, wie Interaktivität und Leistungshandeln, vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird auch der Flow-Zustand erläutert, der durch die individuelle Anpassung von Levels an das Können des Spielers erreicht werden kann. Die Wirkungsforschung zu Computerspielen konzentriert sich bisher vor allem auf violente Spiele und deren Einfluss auf die Gewaltbereitschaft des Spielers. Es werden die Katharsis- und Habitualisierungsthese sowie die Ergebnisse von Studien, die einen Zusammenhang zwischen Mediennutzung, schulischen Leistungen und Jugendgewalt belegen, diskutiert.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Definition und den Nutzungsdaten von Onlinerollenspielen. Es wird die Bedeutung des Begriffs „MMORPG" (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) erklärt und anhand des Spiels „World of Warcraft" die typischen Merkmale von Onlinerollenspielen, wie Persistenz der Spielwelt, soziale Interaktion, Teamplay, Kommunikation und das Belohnungssystem, dargestellt. Die chapter summary beleuchtet auch die Ergebnisse von Studien zur Nutzungsdauer von Onlinerollenspielen, die zeigen, dass diese deutlich höher sind als bei anderen Computerspielgenres. Es werden verschiedene Spielertypen, wie „Vielspieler" und „Hardcore-Spieler", unterschieden und die Bedeutung des „realweltlichen Defizits" für die Spielmotivation und das Spielverhalten von Onlinerollenspielern erläutert.
Kapitel 4 analysiert die jugendgefährdenden Komponenten von Onlinerollenspielen, insbesondere das Abhängigkeitspotenzial. Es wird die Problematik des Begriffs „Onlinesucht" diskutiert und die Ähnlichkeiten zwischen Computerspielsucht und stoffgebundenen Süchten herausgestellt. Die chapter summary geht auf die Anzeichen und Kriterien einer Computerspielsucht ein und stellt die Ergebnisse von Studien vor, die die Prävalenz von Computerspielsucht bei Jugendlichen untersuchen. Es werden auch die Auswirkungen von übermäßigem Spielen auf die Entwicklung von Jugendlichen, wie beispielsweise reduzierte soziale Integration, schulische Probleme und körperliche Beschwerden, beleuchtet.
Kapitel 5 befasst sich mit den Konsequenzen für den Jugendmedienschutz. Es wird die Regelungskompetenz im Bereich des Jugendmedienschutzes, die Unterscheidung zwischen Träger- und Telemedien und die Komplexität des Jugendmedienschutzrechts im Kontext von Onlinerollenspielen erläutert. Die chapter summary stellt die USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) als Prüfinstitution für Computerspiele vor und geht auf die Struktur, das Prüfverfahren und die Kritik an der USK ein. Es wird die Bewertung der USK-Einstufung von Onlinerollenspielen diskutiert und die Forderung nach einer Überarbeitung der Prüfkriterien und einer Berücksichtigung des Suchtpotenzials von Onlinerollenspielen in der Prüfung erhoben. Abschließend werden verschiedene Forderungen zum Schutze von Jugendlichen, wie beispielsweise eine freiwillige Kennzeichnung von Spielen, eine Heraufsetzung der Altersfreigabe oder die Einführung von Spielzeitbegrenzungen, vorgestellt und deren Umsetzbarkeit sowie Wirksamkeit diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Onlinerollenspiele, Jugendmedienschutz, Abhängigkeitspotenzial, Computerspielsucht, „World of Warcraft", USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle), Altersfreigabe, Spielzeitbegrenzung, Medienkompetenz, Entwicklungsbeeinträchtigung, Nutzungsmotive, Wirkungsforschung, Persistenz, Soziale Interaktion, Teamplay, Belohnungssystem, „Realweltliches Defizit", Kompensatorisches Verhalten.
Häufig gestellte Fragen
Warum haben Onlinerollenspiele ein hohes Suchtpotenzial?
Durch spielimmanente Faktoren wie Belohnungssysteme, soziale Interaktion in Gilden und die Persistenz der Spielwelt (die Welt läuft weiter, auch wenn man offline ist) wird ein hoher Nutzungsdruck erzeugt.
Was sind Anzeichen für eine Computerspielsucht?
Dazu gehören Kontrollverlust über die Spielzeit, Vernachlässigung sozialer Kontakte und Pflichten sowie Entzugserscheinungen bei Nicht-Nutzung.
Welche Rolle spielt die USK beim Jugendschutz?
Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) vergibt Altersfreigaben. Die Arbeit kritisiert jedoch, dass das Suchtpotenzial bisher bei der Einstufung oft zu wenig berücksichtigt wird.
Was ist das „realweltliche Defizit“?
Es beschreibt eine Situation, in der Spieler mangelnde Anerkennung oder Erfolg im realen Leben durch virtuelle Erfolge im Spiel kompensieren, was die Suchtgefahr erhöht.
Welche Konsequenzen werden für den Jugendmedienschutz gefordert?
Diskutiert werden Forderungen nach Spielzeitbegrenzungen, einer Heraufsetzung der Altersfreigabe aufgrund von Suchtgefahr und einer besseren Kennzeichnung der Spiele.
- Quote paper
- Marlena Bräu (Author), 2009, Suchtpotenzial von Onlinerollenspielen und Konsequenzen für den Jugendmedienschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/212474