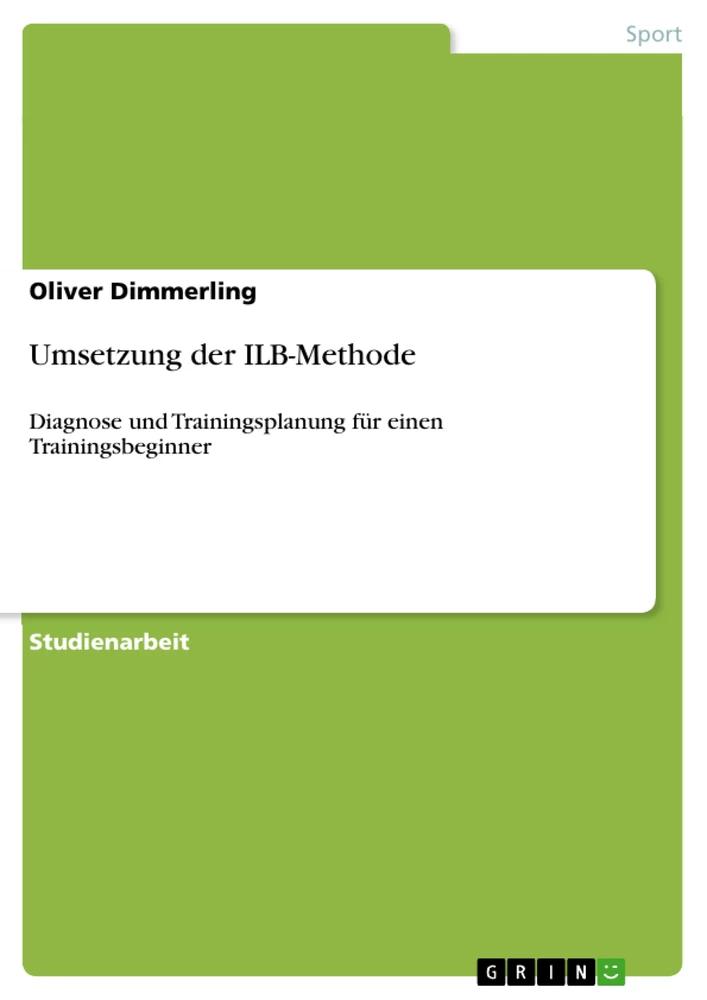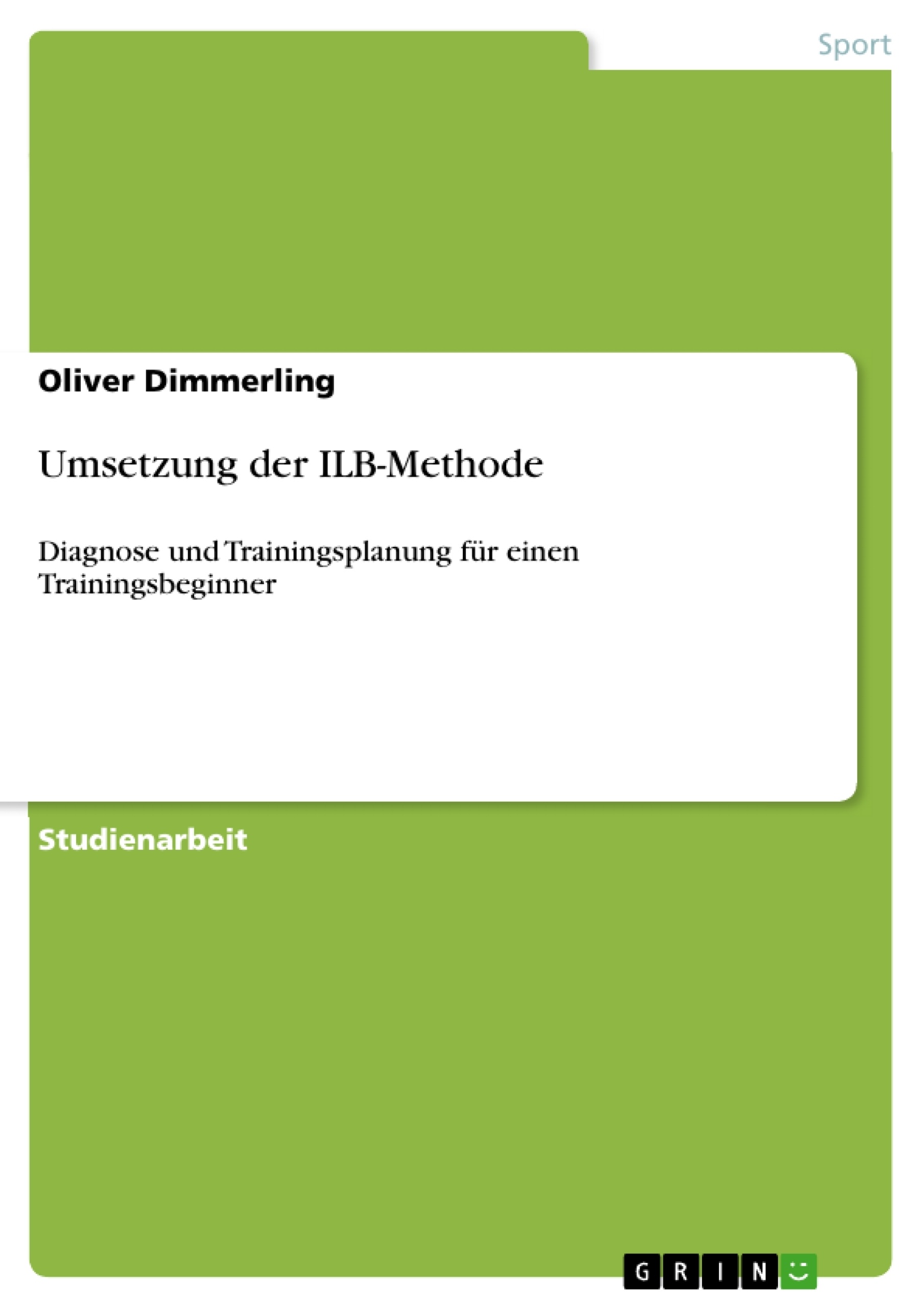Auf den folgenden Seiten wird ein Trainingsprogramm für Frau M. erstellt und die Entstehung begründet. Frau M. ist Trainingsbeginner und hat noch keinerlei Erfahrungen in gerätegestützem Krafttraining. Zu Beginn werden allgemeine und biometrische Daten von ihr erhoben.
Inhaltsverzeichnis
1) Diagnose
2) Zielsetzung/Prognose
3) Trainingsplanung Makrozyklus
4) Trainingsplanung Mesozyklus
5) Literaturrecherche
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Excerpt out of 24 pages
- scroll top
- Quote paper
- Oliver Dimmerling (Author), 2013, Umsetzung der ILB-Methode, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/213886
Look inside the ebook